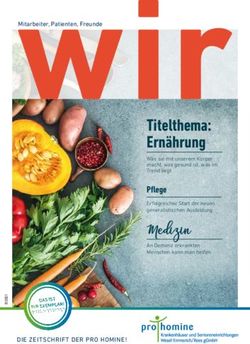Kommunikative Kompetenzen von Ärztinnen und Ärzten - IMPP
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Kommunikative Kompetenzen
von Ärztinnen und Ärzten
Leitfaden zur Implementierung des nationalen
longitudinalen Mustercurriculums
Kommunikation in der Medizin
„Pilot-
implem
entieru
longitu ng
dinales
Muster
curricu
Kommu lum
nik
in der M ation
edizin“
geförde
r
Bundesm t vom
inist
für Gesu erium
ndheit
1PROJEKTLEITUNG
Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP), Mainz
Leitung: Prof. Dr. med. Jana Jünger, MME (Bern)
Wissenschaftliche Gesamtkoordination: Dr. phil. Barbara Hinding
KOOPERATIONSPARTNER/INNEN
Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf, Institut und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie
Leitung: PD Dr. med. Christian Brünahl
Wissenschaftliche Mitarbeiterin: Jennifer Höck
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Rudolf Frey Lernklinik – Zentrale Lehrplattform
Leitung: Dr. med. Holger Buggenhagen, MME
Wissenschaftliche Mitarbeiterin: Dr. rer physiol. Anke Hollinderbäumer, MME
Universitätsklinikum Heidelberg, Abteilung allgemeine Innere Medizin und Psychosomatik
Leitung: PD Dr. med. Jobst-Hendrik Schultz, MME
Wissenschaftliche Mitarbeiterin: Nadine Gronewold
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Klinik für Nieren- und Hochdruckkrankheiten, Diabetologie und
Endokrinologie, Magdeburg, Deutschland
Leitung: Dr. med. Kirsten Reschke, MME
Wissenschaftliche Mitarbeiterin: Tanja Pohl
AUTORINNEN UND AUTOREN
Barbara Hinding, Maryna Gornostayeva, Richard Lux, Christian Brünahl, Holger Buggenhagen, Nadine Gronewold,
Anke Hollinderbäumer, Kirsten Reschke, Jobst-Hendrik Schultz, Jana Jünger
Impressum:
Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen
Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts
Rheinstraße 4 F · 55116 Mainz
Mainz, Juni 2020
Bildnachweis:
Titel - iStock, YakobchukOlena
S. 34 - IMPP
2 3DANKSAGUNG
Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen, die an der Entwicklung und Umsetzung
des nationalen longitudinalen Mustercurriculums Kommunikation mitgewirkt haben.
Ihre Expertise, Motivation und Ihr Engagement haben es ermöglicht, der ärztlichen
Kommunikation in der medizinischen Ausbildung einen höheren Stellenwert einzu-
räumen und die Gesundheitspolitik für die nachhaltige Integration in Curricula und
Staatsexamina zu gewinnen.
Insbesondere danken wir dem Bundesministerium für Gesundheit, das die Wichtigkeit
des Themas anerkannt und mit seiner finanziellen Förderung ermöglicht hat, Konzepte
sowie Strukturen und Prozesse zur nachhaltigen Implementierung kommunikativer
Kompetenzen zu entwickeln und zu pilotieren. Dadurch wurden wertvolle und
zukunftsweisende Erkenntnisse gesammelt, wie die für die ärztliche Tätigkeit wichtige
Kernkompetenz „Kommunikation“ flächendeckend an den medizinischen Fakultäten
vermittelt und überprüft werden kann.
Wir freuen uns sehr, diese Erkenntnisse allen Interessierten zur Verfügung zu stellen,
um möglichst viele medizinische Fakultäten bei der Implementierung von Kommunika-
tionscurricula zu unterstützen. Unser Ziel ist es, den zukünftigen Ärztinnen und Ärzten
bereits während der Ausbildung wichtige Werkzeuge für das Arzt-Patienten-Gespräch
zu vermitteln. Durch die verpflichtende Integration kommunikativer Inhalte in die
Staatsexamina möchten wir einen Beitrag zur Stärkung der Patientensicherheit und
Optimierung der Patientenversorgung leisten.
4 5INHALT
1. An wen richtet sich der Leitfaden und worum geht es darin? 10
2. Warum brauchen wir Lehre in der Kommunikation? 14
3. Wie lehren wir Kommunikation auf einer gemeinsamen Grundlage? 17
3.1. Das nationale longitudinale Mustercurriculum Kommunikation 18
3.2. Pilotierung des Mustercurriculums 23
4. Strategie ist wichtig! 25
4.1. Standortbestimmung: Informationen sammeln und den gegenwärtigen Stand beurteilen 26
4.1.1. Erkennen, wo wir stehen – Entwicklungsstand 27
4.1.2. Auf die Details kommt es an – Curricular Mapping 28
4.2. Rahmenbedingungen klären und optimieren 30
4.2.1. Institutionelle Veränderungsbereitschaft 31
4.2.2. Interne Rechtsgrundlagen 31
4.2.3. Ausstattung und Ressourcen 32
4.3. Umsetzung: Maßnahmen und Werkzeuge anpassen und nutzen 33
4.3.1. Realitätsnahe Gesprächssituationen üben – Simulationspersonenprogramme 33
4.3.2. Kommunikation lehren will gelernt sein – Qualifikation von Dozierenden 34
4.3.3. Prüfen rechtzeitig einplanen – Abstimmung mit Lehrinhalten 35
4.3.4. Umsetzungsschritte planen – Lenkung und Koordination 38
5. Wie gelingt die Implementierung an Ihrem Standort? 42
5.1. Gefühl der Dringlichkeit wecken 43
5.2. Starkes Leitungs-Veränderungs-Team aufbauen 44
5.3. Veränderungsziele und Strategieentwicklung festlegen 45
5.4. Um Verständnis und Akzeptanz werben 47
5.5. Breite Umsetzungsbasis schaffen 47
5.6. Kurzfristige Erfolgserlebnisse sichtbar machen 48
5.7. Kontinuität und Dynamik ermöglichen 48
5.8. Institutionalisierung und Nachhaltigkeit sicherstellen 49
6. Kommunikation in die Staatsexamina integrieren und auf die Weiterbildung vorbereiten! 51
6.1. Welche Vorgaben gilt es zu erfüllen? 52
6.2. Was genau muss man wissen und können? 54
7. Der Weg zum Ziel!
Das Sieben-Punkte-Programm 60
8. Literatur 63
6 71. AN WEN RICHTET SICH DER LEITFADEN
UND WORUM GEHT ES DARIN?
Der vorliegende Leitfaden richtet sich in erster Linie an Schritt für Schritt erläutert dieser Leitfaden das Vorgehen
Verantwortliche für die Curricula medizinischer Fakultä- bei der (Weiter-)Entwicklung und Implementierung eines
ten, die an ihrem Standort für die Integration kommuni- Kommunikationscurriculums. Er beginnt mit der Frage,
kativer Inhalte in Lehre und Prüfung zuständig sind. Der auf welchem Stand sich eine Fakultät mit der systemati-
Leitfaden bietet Unterstützung: bei Umsetzung der poli- schen Vermittlung kommunikativer Kompetenzen in der
tischen Vorgaben für die Stärkung kommunikativer Kom- Ausbildung befindet. Als Grundlage für diese Standort-
petenzen in der medizinischen Ausbildung und bei der bestimmung werden Konzepte und Methoden vorge-
Implementierung oder der Weiterentwicklung eines stellt, mit deren Hilfe die vorhandene Kommunikations-
Kommunikationscurriculums lehre in ihrem Entwicklungsstand beurteilt werden kann.
Dargestellt werden Verfahren zur Klärung der strukturellen
Der Leitfaden fokussiert auf konkrete Aspekte zur Gestal- Voraussetzungen, der Ressourcen und Schwierigkeiten
tung kommunikativer Lehre und Prüfungen. Darüber sowie Maßnahmen zur strategischen Planung des Imple-
hinaus präsentiert er Strategien und Werkzeuge für mentierungsprozesses mit konkreten Beispielen.
Veränderungsprozesse. Diese wurden im Rahmen des
vom Bundesministerium für Gesundheit geförderten Der vorliegende Leitfaden soll dazu beitragen:
Projekts „Kommunikative Kompetenzen von Ärztin-
nen und Ärzten – Pilotimplementierung, Begleite- – die politischen Vorgaben für die Integration
valuation und Erarbeitung von Implementierungs- kommunikativer Kompetenzen in die medizinische
strategien für ein longitudinales Mustercurriculum Ausbildung umzusetzen,
Kommunikation in der Medizin“ erarbeitet.
– die medizinischen Fakultäten bei der Implementie-
rung von Lehre und Prüfungen im Bereich Kommu-
nikation zu unterstützen,
– Forschungsaktivitäten zur Wirkung der Kommuni-
kationslehre auf die spätere Patientenversorgung
anzuregen.
10 112. WARUM BRAUCHEN WIR LEHRE
IN DER KOMMUNIKATION?
Das Gespräch mit Patientinnen und Patienten gehört zur Die Grundlagen der Kommunikationskompetenz als ein In den letzten Jahren entstanden an einigen Fakultäten Angesichts dieser Vielfalt stellt sich die Frage nach den
täglichen Routine praktizierender Ärztinnen und Ärzte. zentrales Element des Arztberufs müssen demnach Curricula, die das Einüben grundlegender Fertigkeiten in fakultätsübergreifenden Anforderungen an eine gute
Eine Ärztin oder ein Arzt führt im Lauf ihres bzw. seines bereits in der Ausbildung gelehrt werden. Auch die der Kommunikation mit Patientinnen und Patienten in Lehre zu kommunikativen Kompetenzen. Deren überge-
Arbeitslebens etwa 160.000 bis 300.000 Patientenge- nationale und internationale Forschung legt nahe, dass der medizinischen Ausbildung umfassen [6, 12–16]. ordnetes Ziel besteht darin, dass zukünftige Ärztinnen
spräche. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass eine Kommunikationskompetenz während des Medizinstudi- Beispielsweise wurde an der Medizinischen Fakultät und Ärzte über eine Kommunikationskompetenz ver-
gute Arzt-Patienten-Kommunikation einen positiven Ein ums gelehrt und geprüft werden sollte [3, 4]. Für die Heidelberg bereits 2001 mit der Implementierung eines fügen, mit der sie auf den Start in die Weiterbildung und
fluss sowohl auf subjektive (z.B. Schmerzskalen) als auch Entwicklung und Beurteilung kommunikationsbezogener interdisziplinären longitudinalen Curriculums zur nach- das Berufsleben angemessen vorbereitet sind. Damit dies
auf objektive Gesundheitsindikatoren (z. B. Blutdruck) Kompetenzen während der medizinischen Ausbildung haltigen Förderung kommunikativer und klinischer Kom- gewährleistet werden kann, sind einheitliche Qualitäts-
haben kann. Die Literatur spricht dafür, dass eine quali- wird ein einheitliches, integriertes, longitudinales Curri- petenzen begonnen. Ergebnis ist ein bis heute innovati- kriterien erforderlich. Nur so kann eine größere Homoge-
tativ hochwertige Kommunikation von großer Bedeu- culum empfohlen, im Unterschied zur konventionellen ves Curriculum, das mit einem integriert-klinischen Teil in nität der vermittelten Inhalte und eine bessere Vergleich-
tung für die Patientenversorgung ist. Ganz besonders bei Blockpraktika [2, 5]. Ein einheitliches Prüfungskonzept der vorklinischen Phase beginnt und sich in Form eines barkeit der Lehre an den Fakultäten erreicht werden.
fortgeschrittenen Erkrankungen mit limitierter Prognose kommunikationsbezogener Kompetenzen liefert wieder- medizinischen Kommunikations- und Interaktionstrai- Die Orientierung an einem übergeordneten Konzept zu
zeigen sich positive Effekte auf die Lebensqualität [1]. holt Gelegenheiten für Beurteilung und Feedback und nings über alle klinischen Semester erstreckt [12]. An der Inhalt und Umfang von Kommunikationscurricula stellt
Daher kann Kommunikation als eine klinische Kernkom- verstärkt sowohl grundlegende als auch komplexe Kom- Medizinischen Fakultät in Düsseldorf wurde die beste- sicher, dass alle Studierenden mit der gleichen Vorberei-
petenz betrachtet werden, die gelehrt und gelernt werden munikationsfertigkeiten [2]. Studien haben gezeigt, dass hende Kommunikationslehre in einem mehrstufigen Pro- tung und dem gleichen Stand zu kommunikativen Kom-
muss. Das Training kommunikativer Fertigkeiten sollte ein integriertes longitudinales Curriculum bessere Lern- zess longitudinal und interdisziplinär erweitert [16]. In petenzen bei den Staatsexamina antreten und das Stu-
deshalb auch in medizinische Ausbildungscurricula ein- ergebnisse mit sich bringt als ein einzelner konzentrierter Witten-Herdecke, an der Berliner Charité und in Ham- dium beenden.
gebunden werden, als ein fortschreitender Entwicklungs- Kurs [5, 6]. Weitere Stärken integrierter longitudinaler burg wurden im Rahmen der Einrichtung von Modell-
prozess [1, 2]. Curricula bestehen in einer größeren Patientenorientie- studiengängen Kommunikationscurricula entwickelt und Mit dem „Nationalen longitudinalen Mustercur-
rung und der klinischen Unabhängigkeit des Gelernten, integriert [15, 17, 18]. Auch in Tübingen, Leipzig oder riculum Kommunikation in der Medizin“ liegt ein
Internationale medizinische Ausbildungseinrichtungen da die Studierenden die Inhalte über verschiedene Kon- Dresden wurde ein Ausbildungsbereich „Kommunikation umfassendes, abgestimmtes Konzept vor. Das Muster-
erkennen die Wichtigkeit der Lehre und Prüfung kommu- texte hinweg immer wieder hören [7, 8]. Dieser Ansatz in der Medizin“ aufgebaut. Dabei sind innovative, aber curriculum zeigt, wie Lehre und Prüfung kommunika-
nikationsbezogener Fertigkeiten in der medizinischen hilft den Studierenden auch, vertrauensvolle Beziehun- auch sehr unterschiedliche Curricula entstanden. tiver Kompetenzen an den Fakultäten inhaltlich weiter-
Ausbildung an (z.B. Institute for International Medical gen zu den Lehrpersonen aufzubauen und ihre Rolle in entwickelt werden können. Auf dieser Grundlage ist
Education [IIME]; General Medical Council [GMC]; der Patientenversorgung zu finden und auszufüllen [9–11]. eine vergleichbare Umsetzung an den Fakultäten
Liaison Committee on Medical Education [LCME]; möglich.
Committee on Accreditation of Canadian Medical
Schools [CACMS]; Association of American Medical In Maßnahme des Masterplans Medizinstudi-
Colleges [AAMC], Association of Canadian Medical um 2020 wird die ärztliche Gesprächsführung aus-
Colleges [ACMC]) [2]. drücklich als Gegenstand der ärztlichen Ausbildung
und Inhalt der abschließenden Staatsprüfung vorge-
geben. In diesem Sinne unterstützt der Masterplan
Medizinstudium 2020 explizit die Umsetzung des
nationalen longitudinalen Mustercurriculums Kom-
munikation [19].
14 153.1 DAS NATIONALE LONGITUDINALE
MUSTERCURRICULUM KOMMUNIKATION
Das Mustercurriculum Kommunikation stellt den Aus- Das Mustercurriculum Kommunikation für die medizini- Der Baustein I zur ärztlichen Gesprächsführung bildet
1. Problem-/
gangspunkt für ein einheitliches Vorgehen bei der Ent- Bedarfsanalyse sche Ausbildung sieht insgesamt drei Bausteine für die das „Kerncurriculum Ärztliche Kommunikation“ mit
wicklung eines Kommunikationscurriculums in der Medi- Kommunikationslehre vor (vgl. Abbildung 2): 300 Unterrichtseinheiten, welche die sechs Kompetenz-
zin dar. Es wurde im vom Bundesministerium für Gesund- bereiche des NKLM-Kapitels 14c abbilden (Tabelle 1).
heit im Rahmen des Nationalen Krebsplans geförderten 2. Übergeordnete Baustein I: Kerncurriculum „Ärztliche Kommuni- Dieses Kerncurriculum ist veröffentlicht und über eine
6. Feedback
Ziele
Projekt „Nationales longitudinales Mustercurriculum- kation“ (Umfang: 300 UE) Internetseite zugänglich [25].
Kommunikation in der Medizin“ (kurz: Longkomm) ent- Baustein II: Interprofessionelle Kommunikation
wickelt. In einer interdisziplinären und interprofessionel- (Umfang: 50 UE) Die Kompetenzbereiche werden im Studienverlauf longi-
len Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern aus 5. Implementierung 3. Lernziele Baustein III Spezialisierung/ Vertiefung Kommuni- tudinal angeboten. Grundlagen, Konzepte, Modelle und
36 medizinischen Fakultäten in Deutschland wurde ge- kation (Umfang: 100 UE). einfache Fertigkeiten werden in den Einführungskursen
meinsam von November 2012 bis November 2015 ein und den ersten Studienjahren vermittelt. Darauf aufbau-
Entwurf ausgearbeitet [20, 21]. Dieser wurde beim 4. Lern-, Lehr- und Während die Bausteine I und II als verpflichtendes Ange- end werden komplexere Skills zur Bewältigung von her-
Abschlusssymposium im Jahr 2016 konsentiert. Zudem Prüfungsformate bot für alle Studierenden empfohlen werden, ist Baustein ausfordernden Situationen integriert in die klinischen
wurde die Heidelberger Erklärung zur Förderung III Teil des Wahlpflichtangebots, aus dem die Studieren- Inhalte gelehrt. Im Rahmen des Praktischen Jahres (PJ)
kommunikativer Kompetenzen verabschiedet. In Anlehnung an: DE Kern, PA Thomas, DM Howard (1998). Curriculum Development den spezifische Kurse mit kommunikativen Inhalten aus- wird die Kommunikationslehre versorgungsnah fortge-
for Medical Education: A six step Approach. Baltimore: John Hopkins University Press
https://www.medtalk-education.de/wp-content/ wählen können. führt, zum Beispiel als Training der kommunikativen
uploads/2016/02/heidelberger-erklaerung.pdf Abbildung 1: Der Six-Step-Approach zur Curriculumsentwicklung Aspekte bei der Visite [26, 27].
Grundlage für die Entwicklung des oben genannten nalen kompetenzbasierte Lernzielkatalog Medizin aus Tabelle 1: Übersicht über die je NKLM-Kompetenzbereich empfohlenen UE für den Baustein I des
Mustercurriculums war der Six-Step-Approach zur dem Jahr 2015 (NKLM) [20, 23]. Mustercurriculums
Curriculumsentwicklung von Kern [22] (vgl. Abbildung
1). Der Bedarf für ein Mustercurriculum Kommunikation Bei der Erstellung des Mustercurriculums wurde der Kompetenzbereiche des Bausteins I „Ärztliche Kommunikation“ (Kapitel 14c des NKLM) UE
entstand durch die Änderung der ärztlichen Approbati- Schritt 4 „Lern-, Lehr- und Prüfungsformate“ vertiefend
onsordnung im Jahr 2012, nach der die Lehre und das ausgearbeitet. Ausgehend von einer Studie zum Ist-Stand 1. Konzepte, Modelle und allgemeine Grundlagen 20
Prüfen kommunikativer Kompetenzen im Medizinstudi- der Kommunikationslehre in Deutschland und einer 2. Fertigkeiten und Aufgaben der ärztlichen Kommunikation 106
um verpflichtend wurden. Die übergeordneten Ziele Sammlung von Best-Practice-Beispielen wurde jedem 3. Emotional herausfordernde Situationen 68
entstammen den „Canadian Medical Education Directi- Lernziel des NKLM zur ärztlichen Gesprächsführung ein 4. Herausfordernde Kontexte 35
ves for Specialists“ (CanMEDS) und den dort enthaltenen zeitlicher Umfang zugeordnet. Der Gesamtumfang 5. Soziodemographische und sozioökonomische Einflussfaktoren 43
Kompetenzen, die spezifischen Lernziele aus dem Natio- beträgt 450 Unterrichtseinheiten (UE) [24]. 6. Andere mediale Kanäle und Settings 28
Gesamtumfang Kerncurriculum 300
Abbildung 2: Das longitudinale Mustercurriculum Kommunikation für die medizinische Ausbildung
18 19Den Baustein II „Interprofessionelle Kommunikation“ Der Baustein „Interprofessionelle Zusammenarbeit gesucht werden. Beispielsweise führt die Recherche nach munikation weiterentwickeln möchten. Zudem gibt es
gestaltete die berufsübergreifende Arbeitsgruppe im von und Kommunikation“ sieht 50 Unterrichtseinheiten den Lernzielen zur Risikokommunikation (14c.4.2) zu zahl- Lehrenden wertvolle Anregungen für die Unterrichtsge-
der Robert Bosch Stiftung geförderten Projekt „Muster- (UE) vor, die exemplarisch aus acht Tagen à sechs UE reichen Best-Practice-Beispielen, die zu unterschiedlichen staltung und die Konzeption von Prüfungen [31].
curriculum interprofessionelle Zusammenarbeit und Lehre und zwei UE Prüfungen bestehen. Der inhaltliche Krankheitsbildern strukturierte Unterrichtseinheiten zum
Kommunikation“ [28]. Gemeinsam mit Vertreterinnen Rahmen wurde evidenzbasiert auf Grundlage der Versor- Erlernen und Üben der Risikoeinschätzung und -informa- Qualifizierung Dozierender
und Vertretern verschiedener Gesundheitsberufe identi- gungsanlässe aus beruflichen Alltagssituationen, beispiels- tion für Beratungsgespräche und eine partizipative Ent-
fizierten Projektmitglieder in einem mehrstufigen Abstim- weise Übergabe, Visite, Entlassungsmanagement etc. scheidungsfindung zur Verfügung stellen. Diese entstam- Im Rahmen des Longkomm-Projektes wurde zudem ein
mungsprozess interprofessionelle Themen, die in das definiert (vgl. Tabelle 2). men zum Teil einem spezifischen Curriculum zu Interes- Qualifizierungskonzept für Dozierende zur Vorbereitung
Mustercurriculum aufgenommen wurden sollten. senkonflikten, zur Risikokommunikation und partizipati- auf die Lehre zur Förderung kommunikativer Kompeten-
ver Entscheidungsfindung, das im Rahmen einer kontrol- zen entwickelt [32, 33]. Daran waren Vertreterinnen und
Tabelle 2: Interprofessionelle Versorgungsanlässe zur verpflichtenden curricularen Integration (Blueprint) lierten, randomisierten Studie getestet wurde. Die Ergeb- Vertreter verschiedener Gesundheitsberufe (z. B. Medizin,
nisse zeigen bei den Teilnehmenden im Vergleich zu Psychologie, Gesundheits-, Therapie- und Pflegewissen-
Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 einer Kontrollgruppe eine statistisch signifikante Zunahme schaften) beteiligt. Das Konzept umfasst zwei aufeinan-
der Fähigkeit zur Risikokommunikation sowohl unmittel- der aufbauende Module, um unterschiedliche Ausgangs-
• Entlassungs- bar nach dem Training als auch in einer Follow-up-Unter- bedingungen, Vorkenntnisse und Bedürfnisse der Teil-
• Aufnahme • Aufklärung
management
• Übergabe suchung 30 Wochen später [32]. Im Rahmen des Projekts nehmenden zu berücksichtigen: eine Schulung für Ein-
• Anamnese • Sicherheitskultur /
• Sozialrechtliche „Kommunikative Kompetenzen von Ärztinnen und steigerinnen und Einsteiger sowie eine Aufbau-Schulung
• Dokumentation (II) Fehlerkommunikation
• Dokumentation (I) Entscheidungs- Ärzten“ wurden Unterrichtseinheiten zum Thema Risiko- mit jeweils 16 Unterrichtseinheiten (Tabelle 3).
und -offenbarung
findung
kommunikation an einem Standort in die Kommunikati-
onslehre aufgenommen und an einem weiteren als Pilot- Tabelle 3: Module und zeitlicher Rahmen der Einstei-
Tag 5 Tag 6 Tag 7 Tag 8
projekt umgesetzt. gerinnen- und Einsteiger-Schulung und der
Aufbau-Schulung für Dozierende auf dem
• Visite (I) • Visite (II) Die Vielfalt, Detailliertheit und der Praxisbezug machen Gebiet der Arzt-Patient-Kommunikation.
• Klinische • Überbringen
• Fallbesprechungen (I) • Fallbesprechungen (II) Entscheidungs- schlechter die Best-Practice-Beispiele insbesondere am Anfang der
findung Nachrichten Curriculumsentwicklung, wenn neue Unterrichtseinhei- Modul Einsteigerinnen und Einsteiger-Schulung
• Therapieplanung (I) • Therapieplanung (II)
ten konzipiert werden müssen, zu einem wertvollen Hilfs-
(16 UE gesamt)
mittel bei der Umsetzung des Mustercurriculums. Weiter-
hin dient es der externen Vernetzung und dem Austausch
Theoretische Grundlagen der Kommunikation 2 UE
Die Wahlpflichtangebote des Bausteins III „Speziali- Die Toolbox zum Austausch von Best-Practice- zwischen Dozierenden innerhalb einer Ausbildungsein-
sierung/Vertiefung Kommunikation“ können an den Beispielen in der Kommunikationslehre richtung sowie standortübergreifend. Die Toolbox und Gesprächsstrukturierung 2 UE
medizinischen Fakultäten abhängig von den fakultätsspe- einzelne Best-Practice-Beispiele sind online einsehbar Beziehungsaufbau, Emotion und Empathie 2 UE
zifischen Schwerpunkten flexibel gestaltet werden. Die „Toolbox“ ist eine moderierte Plattform, auf der unter https://www.medtalk-education.de/toolbox/.
Feedback 2 UE
Lehr- und Prüfbeispiele zwischen Lehrenden ausge-
tauscht werden und wechselseitig zugänglich sind [29, Die Toolbox ergänzt seit dem Jahr 2018 das Lehrbuch Hospitation 4 UE
Während der Entwicklung des Mustercurriculums ent- 30]. Die Inhalte sind so aufbereitet, dass sie ganz oder in „Ärztliche Kommunikation – Praxisbuch zum Praxiseinheit mit begleitender Reflexion 4 UE
standen mehrerer Begleitinstrumente, darunter Schu- Teilen in die eigene Lehre übernommen werden können. Masterplan Medizinstudium 2020“. In sechs Kapiteln
lungskonzepte zur Vermittlung kommunikativer Kompe- Sie umfassen Fallbeispiele, Präsentationen, Anleitungen entsprechend den sechs Kompetenzbereichen des Kapi-
tenzen für die Weiterbildung von Dozierenden und zur zur Durchführung von Rollenspielen, Skripte für Unter- tels 14c des NKLM werden die zugehörigen Lernziele in Module Aufbau-Schulung
Qualifizierung studentischer Tutorinnen und Tutoren. richtseinheiten mit Simulationspersonen und weitere mehr als hundert Einzelbeiträgen adressiert. Anhand (16 UE gesamt)
Hierzu wurden u.a. Best-Practice-Beispiele aus verschie- Informationsmaterialien, die zur Gestaltung des Unter- konkreter Fallbeispiele werden die verschiedenen Pro-
denen Standorten gesammelt und einheitlich aufberei- richts hilfreich bzw. erforderlich sind. Jedem Best-Practice- blemfelder erläutert und Vorschläge zur optimalen Überbringen schlechter Nachrichten 4 UE
tet. Alle aufbereiteten Best-Practice-Beispiele sind in Beispiel sind zudem die Kommunikationslernziele des Gesprächsführung ausführlich vorgestellt. Übungsaufga-
Fehlerkommunikation 4 UE
einer „Toolbox“ gebündelt, um sie zu erhalten und den NKLM aus dem Jahr 2015 zugeordnet. Dadurch kann ben, Checklisten und Selbsttests ergänzen die Empfeh-
Fakultäten zugänglich zu machen. über einen Index gezielt nach bestimmten Inhalten lungen und Handlungsanleitungen. Das Buch wendet Interprofessionelle Kommunikation 4 UE
sich sowohl an Studierende als auch an Ärztinnen und Sensible Themen (je nach Fachgebiet) 4 UE
Ärzte, die sich auf dem Gebiet der Arzt-Patienten-Kom-
20 213.2 PILOTIERUNG DES MUSTERCURRICULUMS
Schulung „Von Studierenden zu Tutorinnen und Das Mustercurriculum wurde im Rahmen des Projekts
Tutoren“ „Kommunikative Kompetenzen von Ärztinnen und Am Ende der Pilotierung lagen vier Curricula vor,
Ärzten – Pilotimplementierung, Begleitevaluation und welche die Vorgaben des Mustercurriculums an-
Im Medizinstudium fest etabliert sind Peer-Assisted-Lear- Erarbeitung von Implementierungsstrategien für ein nähernd erfüllen und dennoch fakultätsspezifische
ning-Konzepte (PAL), beispielsweise in Kursen zur Ana- longitudinales Mustercurriculum Kommunikation in Schwerpunkte abbilden.
tomie, Klinischen Untersuchung oder zum problemorien- der Medizin“ exemplarisch umgesetzt. Dabei wurde
tierten Lernen (POL). Die Etablierung und Durchführung der Baustein I „Kerncurriculum Ärztliche Gesprächs- Das Mustercurriculum gibt zwar Lernziele vor, deren
von peer-gestützten Tutorien erweist sich als vergleichs- führung“ an vier Fakultäten unter wissenschaftlicher Umsetzung in Unterrichtseinheiten muss im Zuge der
weise ressourcensparend. Hinsichtlich der Vielzahl an Begleitung pilotimplementiert. Die vier Fakultäten wurden Implementierung jedoch spezifisch ausgestaltet werden.
curricularen, zeitlichen, institutionellen und strukturellen so ausgewählt, dass sie möglichst unterschiedliche Aus- Neben der Frage, in welchen Fächern und in welchen
Variationen handelt es sich zudem um ein sehr flexibel gangsbedingungen aufwiesen, um eine große Bandbreite Lehrveranstaltungen welche Lernziele aufgegriffen wer-
einsetzbares Lehr-Lernformat [34, 35]. Die Schulung im Entwicklungsstand ihrer vorhandenen Curricula und den sollen, müssen zum Beispiel Unterrichtsmethoden
studentischer Tutorinnen und Tutoren unterscheidet sich ihrer institutionellen Rahmenbedingungen abzubilden. definiert und Fallbeispiele formuliert werden. Dadurch
jedoch zwischen den medizinischen Fakultäten stark, von Dadurch war es möglich, Pilotierungsprozesse unter ver- wird eine Anpassung an die Gegebenheiten der Fakultät
einer informellen Anleitung durch erfahrene Dozierende schiedenen Voraussetzungen zu beobachten, zu beschrei- möglich. Diese können ihren inhaltlichen Fokus schärfen
bis hin zu einem strukturierten Curriculum mit einer Ab- ben und typische Herausforderungen in verschiedenen sowie ihre vorhandenen Schwerpunkte weiter ausbauen
schlussprüfung [38]. Daher wurde ein Qualifizierungs- Phasen zu erkennen. und gezielt profilieren.
programm für Tutorinnen und Tutoren für den Bereich Abbildung 3: Standorte des Qualifizierungsprogramms für
studentische Tutorinnen und Tutoren
der Arzt-Patient-Kommunikation erarbeitet und laufend Zunächst wurde der Ist-Stand der Kommunikations- Der vorliegende Leitfaden baut auf den Erfahrungen aus
weiterentwickelt. Neben Medizinstudierenden werden lehre an jedem Projektstandort erfasst und die Abde- dem Pilotimplementierungsprojekt auf und soll mit seinen
auch Studierende der Pharmazie, Auszubildende der ckung des Kerncurriculums „Ärztliche Kommunikation“ Empfehlungen die Umsetzung des nationalen longitudi-
Psychotherapie sowie Studierende und Auszubildende (Baustein I) analysiert. So konnte der Entwicklungsbe- nalen Mustercurriculums Kommunikation in der Medizin
anderer Heil- und Gesundheitsberufe eingeladen [36–38]. darf des bisherigen fakultären Curriculums beschrieben an den weiteren medizinischen Fakultäten unterstützen.
sowie Ziele und Strategien für eine Anpassung an das
Das Schulungskonzept umfasst zwei Basismodule, die Kerncurriculum „Ärztliche Kommunikation“ formuliert
Studierende zunächst in Medizindidaktik, Grundlagen werden. Im Anschluss erfolgte eine circa 18-monatige
der Kommunikation und Gruppenleitung sowie in spe- Pilotierungsphase und eine abschließende Evaluation
zifischer Kommunikation qualifizieren. Diese werden hinsichtlich Quantität und Qualität. Aus den Erfahrungen
ergänzt um eine spezifische Vorbereitung auf die Durch- mit der Pilotimplementierung und Ergebnissen der Eva-
führung von Tutorien, eine Praxisphase mit eigener Lehr- luation wurden Strategien und Maßnahmen abgelei-
tätigkeit und einer Vertiefung zu spezifischen Themen im tet, wie die Implementierung eines Kommunikationscur-
Bereich Kommunikation (Überbringen schlechter Nach- riculums erfolgreich umgesetzt werden kann.
richten, interprofessionelle Kommunikation, partizipative
Entscheidungsfindung, Überprüfung kommunikativer
Kompetenzen).
22 23STRATEGIE IST WICHTIG! 24 25
4.1 STANDORTBESTIMMUNG: INFORMATIONEN SAMMELN 4.1.1. ERKENNEN, WO WIR STEHEN – ENTWICKLUNGSSTAND
UND DEN GEGENWÄRTIGEN STAND BEURTEILEN
Wo steht Ihre Fakultät mit der Implementierung des Kom- stäbe erforderlich. Mit dem Konzept des Reifegrads von Zum Entwicklungsstand von Kommunikationscurricula nikationsunterricht. Auf der nächsten Stufe nimmt zwar
munikationscurriculums? Was wurde bisher erreicht? Kommunikationscurricula sowie dem Curricular Mapping hat Silverman ein Konzept vorgelegt, das einen prototy- die Zahl der Kurse zu, sie finden aber nur in den ersten
Was ist schon vorhanden und was müsste noch hinzu- zum Vergleich mit den Empfehlungen des Mustercurricu- pischen Verlauf einer Curriculumsimplementierung an Studienjahren statt und erst auf einer weiteren Stufe
kommen, um alle inhaltlichen Bereiche abzudecken? Ist lums werden im Folgenden Kriterien formuliert, die bei Fakultäten abbildet [39]. Silverman beschreibt den je- über die gesamte Studienzeit. Einen qualitativen Sprung
das Curriculum wirklich longitudinal? Um diese und wei- der Beschreibung des Entwicklungsstands eines vorhan- weiligen Entwicklungsstand in sechs qualitativ unter- bietet Stufe vier mit einem longitudinalen Curriculum,
tere Fragen beantworten zu können, sind Vergleichsmaß- denen Curriculums helfen. scheidbaren Stufen. Diese sind in Form einer Pyramide das helikal integriert (in Lernspiralen aufeinander auf-
angeordnet (vgl. Abbildung 3), wobei die Qualität von bauend) und in den klinischen Unterricht eingebunden
unten nach oben zunimmt. An der Basis der Pyramide ist. An der Spitze auf Stufe sechs bilden die Prüfungen
steht ein lediglich in Einzelkursen stattfindender Kommu- das Kommunikationsthema vollständig ab.
Fully
integrated
into assessment
(multi methodological)
Increasing maturity
Increasing number of
communication domains covered
(longitudinal curriculum with clinical integration)
Integrated helcaly and with clinical teaching
thoughout curriculum (longtudinal curriculum)
Multible stand-alone courses throughout all years
Multible stand-alone courses in early years
Single stand-alone course in early years
Abbildung 4: Pyramide des zunehmenden Reifegrads von Kommunikationscurricula nach Silverman [39]
Mit der Silverman-Pyramide ist eine qualitative, auf Kri- deckt? Gibt es Kommunikationsprüfungen und sind diese
terien basierte Einschätzung des Reifegrads eines Curri- im Sinne des Constructive Alignment auf die Lehre abge-
culums möglich. Gibt es an Ihrer Fakultät eher nur ein- stimmt?
zelne Kurse oder Unterrichtseinheiten? Finden diese nur
in der vorklinischen Phase statt oder über die gesamte Ein Überblick über die aktuelle Lehre mit kommunikati-
Studienzeit? Ist das Curriculum longitudinal, mit aufein- ven Inhalten ist wesentlich. Aber erst eine umfassende
ander aufbauenden Unterrichtseinheiten und Veranstal- Befragung der Dozierenden gewährleistet eine vollstän-
tungen, integriert in die klinische Lehre? Sind die ge- dige Bestandsaufnahme.
wünschten Kommunikationsthemen überwiegend abge-
26 274.1.2. AUF DIE DETAILS KOMMT ES AN – CURRICULAR MAPPING
Das Curricular Mapping ist eine Methode zur Beschrei- Inhalten geht und (3) einer Inhaltsanalyse, in der die Neben diesem veranstaltungsübergreifenden Teil werden – ob das Kommunikationsthema in klinische Inhalte
bung der Lehrinhalte und -prozesse. Mit einem Curricular behandelten Lernziele erhoben werden. für jede Lehrveranstaltung mit Unterrichtseinheiten zur eingebettet ist,
Mapping wird erfasst, was inhaltlich gelehrt und geprüft Im Einzelnen umfasst das Befragungsinstrument zur Kommunikation im Teil II der Strukturanalyse (Abbil- – welches Lehrformat die Veranstaltung hat und
wird, mit welchen Methoden und zu welchem Zeitpunkt. Strukturanalyse Teil I Fragen zur: dung 4) folgende Merkmale identifiziert: – welche Lehrmethoden eingesetzt werden.
[40]. Die Umsetzung von Lernzielen wird systematisch
dokumentiert. Dies ermöglicht den Vergleich zwischen – Koordination der Kommunikationslehre – in welchem Semester die Veranstaltung durchgeführt Für die Inhaltsanalyse wurden die Lernziele aus dem
dem, was gelehrt wird und dem, was das Mustercurricu- – Ausstattung der Kommunikationskurse wird, Kapitels 14c „Ärztliche Gesprächsführung“ des NKLM
lum vorsieht. (inkl. personeller Ressourcen, Simulationspersonen, – zu welchem Fach sie gehört, aus dem Jahr 2015 vorgelegt. Die Dozierenden gaben für
Räumlichkeiten, Technik) – wie groß der Anteil an Kommunikation im Verhältnis jede ihrer Veranstaltungen mit Kommunikationsinhalt an,
Im Projekt „Kommunikative Kompetenzen von Ärz- – Evaluation der Kommunikationslehre/ zur Gesamtveranstaltung ist, welche Lernziele behandelt werden (vgl. Abbildung 5).
tinnen und Ärzten“ wurde hierfür ein Befragungsinst- Veranstaltungen
rument spezifisch zur Beschreibung des Kommunikati- – Finanzierung der Kommunikationslehre
onscurriculums entwickelt. Es besteht aus drei Teilen: – Prüfung kommunikativer Kompetenzen (Formate,
(1) einer Strukturanalyse I, in der übergeordnete Aspekte Organisation)
des Kommunikationscurriculums erfragt werden, (2) einer – Ausbildung der Dozierenden.
Strukturanalyse II, in der es um die Merkmale der einzel-
nen Lehrveranstaltungen mit kommunikationsbezogenen
Abbildung 6: Auszug aus dem Fragebogen zur Inhaltsanalyse (Lernzielabdeckung)
Abbildung 5: Auszug aus dem Fragebogen Strukturanalyse II
28 294.2.1. INSTITUTIONELLE VERÄNDERUNGSBEREITSCHAFT
Das Instrument ist das Ergebnis eines mehrstufigen Ent- Terminvereinbarung hat den Vorteil, dass eine höhere Die Bereitschaft einer Organisation, die geplante Ver- Es ist wichtig, sich im Vorfeld einer detaillierten Planung
wicklungsprozesses. Grundlage war ein im oben bereits Rücklaufquote erwartet werden kann als bei einer schrift- änderung durchzuführen, ist von großer Bedeutung für der Implementierung einen Überblick über diese und ge-
beschriebenen Longkomm-Projekt entwickelter teilstan- lichen oder online durchgeführten Befragung. Ein mög- den Veränderungsprozess. Das Ausmaß, in dem eine gebenenfalls weitere Faktoren zu verschaffen. Somit
dardisierter Interviewleitfaden. Dieser wurde von den licher Nachteil ist, dass insbesondere bei einem umfang- Organisation und ihre Mitglieder auf die Umsetzung der lassen sich Möglichkeiten und Grenzen aufzeigen und
Beteiligten des Projekts „Kommunikative Kompetenzen reicheren Kommunikationscurriculum, an dem viele Veränderungsmaßnahme vorbereitet, motiviert und dazu notwendige Anpassungen struktureller Bedingungen
von Ärztinnen und Ärzten“ mit langjährigen Erfahrun- Dozierende beteiligt sind, ein hoher Aufwand für die befähigt sind, ist richtungsweisend für die Entscheidun- identifizieren. Daher werden im Folgenden einige ausge-
gen in der medizinischen Ausbildung in einem iterativen Terminkoordination entsteht und größere zeitliche Res- gen bei der Planung und Implementierung von Verände- wählte Punkte eingehender erläutert.
Prozess überarbeitet. Der Fokus lag dabei auf der inhalt- sourcen für die Einzelgespräche eingeplant werden rungsprozessen und erfordert Berücksichtigung bei der
lichen Relevanz, der Vollständigkeit sowie der Handhab- müssen. Kommunikation [41–43].
barkeit für die anstehende Ist-Standanalyse der Kommu-
nikationscurricula an den am Projekt beteiligten Fakultäten. Die anschließende Auswertung der erhobenen Daten
zielt auf die Gegenüberstellung mit den Empfehlungen Veränderungsbereitschaft betrifft sowohl individuelle als auch strukturelle Faktoren,
Die Durchführung dieser Befragung zum Ist-Stand der des Mustercurriculums und damit auf die Aufdeckung die den Implementierungsprozess fördern oder hemmen. Dazu gehören beispielsweise:
Kommunikationslehre erfordert zunächst die Identifizie- von Lücken und Redundanzen. Gibt es Lernziele, die
• die Unterstützung durch die Führungsebene,
rung möglichst aller Lehrveranstaltungen mit kommuni- bisher nicht oder nicht in ausreichendem Umfang abge-
• die grundsätzliche Einstellung zu Kommunikationslehre bei
kationsbezogenen Inhalten an der Fakultät. Erste An- deckt werden? Gibt es Lernziele, die häufiger behandelt
Lehrenden und Studierenden,
sprechpartnerinnen und -partner hierfür sind die Lehr- werden als durch das Mustercurriculum empfohlen?
• das aktive Mitwirken durch die Fachverantwortlichen,
verantwortlichen der Institute, Abteilungen oder Fächer.
• das Vorhandensein qualifizierter Dozierender,
Anschließend werden die entsprechenden Dozierenden Hilfreich ist auch die zusammenfassende Analyse der
zu jeder ihrer Veranstaltungen mit dem Interviewleitfa- Lernziele, die zu einem Kompetenzbereich gehören (vgl. • die Zurverfügungstellung von Zeitfenstern für
kommunikationsbezogene Unterrichtseinheiten,
den (Strukturanalyse Teil II) und dem Fragebogen zur Tabelle 1). Die Analyse zeigt, ob möglicherweise ganze
Inhaltsanalyse in einem Face-to-Face-Interview befragt. Themenbereiche überrepräsentiert sind während andere • die Existenz eines Steuerungsteams,
Ein persönlich durchgeführtes Interview mit vorheriger eher wenig abgedeckt werden. • die Verfügbarkeit finanzieller Ressourcen.
4.2. RAHMENBEDINGUNGEN KLÄREN UND OPTIMIEREN 4.2.2. INTERNE RECHTSGRUNDLAGEN
Im Folgenden werden fördernde und hemmende Faktoren Bestehende Rechtsgrundlagen wie die Studien- und von Kommunikationsinhalten in die vorhandenen Veran-
vorgestellt, die den Implementierungsprozess beeinflus- Prüfungsordnungen der Medizinischen Fakultäten staltungen an, gegebenenfalls auch durch die Modifika-
sen können. Es handelt sich um Rahmenbedingungen, legen den Rahmen einer Einbettung neuer curricularer tion von Unterrichtskonzepten. Die Integration innovati-
die im Vorfeld einer Implementierung bezüglich ihrer Inhalte fest. Zusätzliche Lehrveranstaltungen sind meist ver Prüfungen hingegen erfordert in der Regel eine
Ausprägung und ihrer möglichen Wirkungen analysiert nur als Einzelprojekte mit freiwilliger Teilnahme möglich, Änderung der Prüfungs- oder Studienordnung und sollte
werden, um dann bei Bedarf Lösungsstrategien entwi- eine Verankerung als Pflichtveranstaltungen ist oft sehr daher möglichst frühzeitig geplant und initiiert werden.
ckeln zu können. schwierig. Aus diesem Grund bietet sich die Integration
30 314.2.3. AUSSTATTUNG UND RESSOURCEN 4.3. UMSETZUNG: MASSNAHMEN UND WERKZEUGE
ANPASSEN UND NUTZEN
Die Bereitstellung erforderlicher Ressourcen auf instituti- Für die Kalkulation zeitlicher Ressourcen stellt das 4.3.1. REALITÄTSNAHE GESPRÄCHSSITUATIONEN ÜBEN –
oneller Ebene ist die Voraussetzung für die Implementie- Nationale Longitudinale Mustercurriculum Kommunikati-
rung und Verstetigung eines Kommunikationscurriculums. on eine wichtige Orientierungshilfe dar. Dort sind insge-
SIMULATIONSPERSONENPROGRAMME
Im Voraus ist zu identifizieren, welche personellen, zeit- samt 450 Unterrichtseinheiten (UE) vorgesehen: 300 UE
lichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung davon sind für das Kerncurriculum „Ärztliche Kommuni-
der Kommunikationslehre und die Durchführung von kation“ festgelegt. 50 UE werden für „Interprofessionel-
Prüfungen im Minimum notwendig sind. le Kommunikation“ und 100 UE im Rahmen des Wahl-
fachangebots empfohlen. Der Einsatz von Simulationspersonen (SP) in der medizi- schaft für Medizinische Ausbildung (GMA) hat ein
Im Hinblick auf personelle Ressourcen ist ein zentrales nischen Aus- und Weiterbildung zählt zu den effektivsten Positionspapier erarbeitet und, basierend auf der For-
Steuerungsteam für die Kommunikationslehre zu emp- Für die Durchführung von Unterricht und Prüfungen Lernmethoden, um kommunikative Kompetenzen zu trai- schungslage sowie den internationalen Kriterien und
fehlen, das in Abhängigkeit von der Größe der Medizini- bedarf es geeigneter Räumlichkeiten mit entsprechen- nieren. So können realitätsnah unterschiedliche Gesprächs- Standards für SP-Einsätze, Mindestanforderungen und
schen Fakultät folgende Personalstellen, inklusive Stellen- der Ausstattung. Beispielweise wird für den Rotations- situationen geübt werden, darunter auch herausfordernde Entwicklungsperspektiven für die SP-Programme im
anteilen, umfasst: unterricht in Kleingruppen (circa sechs Studierende pro Kontexte wie das Überbringen schlechter Nachrichten, deutschsprachigen Raum formuliert [45].
Gruppe) eine ausreichende Anzahl geeigneter Räume den Umgang mit aggressiven Patientinnen und Patienten
Beispielplanung benötigt, ebenso für die praktischen Prüfungen in Form oder die partizipative Entscheidungsfindung. Mit dem Ziel, die Standardisierungsprozesse im deutsch-
• 1 wissenschaftliche Koordination von OSCEs. Auch darf die technische Ausstattung für die sprachigen Raum zu fördern, entstand das Buch „Simu-
• 1 wissenschaftliche Hilfskraft-Stelle Gestaltung des Unterrichts und der Prüfungen nicht Simulationspersonen-Programme sind mittlerweile an lationspatienten – Handbuch für medizinische und
(40 – 80 h/ Monat) fehlen. Hierzu gehören zum Beispiel Videokameras, Bea- fast allen medizinischen Fakultäten in Deutschland vor- Gesundheitsberufe“, das theoretische Grundlagen so-
• 1 - 2 Simulationspersonen (SP)-Trainerinnen mer, Lautsprecher, Tablets, Einwegspiegel etc. handen. Die Methode SP ist fest verankert. SPs werden wie viele praktische Hinweise für den SP-Einsatz inklusive
oder Trainer relativ häufig in Lehre und Prüfungen eingesetzt. Aller- konkreter Beispiele und Materialien beinhaltet [46].
• 1 administrative Koordination dings sind Gestaltung und Qualitätsanforderungen der
SP-Programme sehr unterschiedlich [44].
Für die Umsetzung und Implementierung der Kommuni- Der Ausschuss „Simulationspersonen“ der Gesell-
kationslehre empfiehlt es sich, den Einsatz von Simulati-
onspersonen im Unterricht und für Prüfungen zu nutzen,
um ärztliche Gesprächsführung realitätsnah üben zu
können. Hiermit sind neben den oben genannten SP-
Trainerinnen und Trainern zusätzliche Kosten für SP-
Honorare verbunden, für die ausreichende finanzielle
Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen.
Hinzu kommt die Entwicklung administrativer Prozes-
se und Strukturen, die den Implementierungsprozess
fördern und unterstützen. Beispielweise ist es hilfreich,
zentrale Strukturen zur Verwaltung von Simulationsper-
sonen aufzubauen, die der gesamten Fakultät zur Ver-
fügung stehen. Kooperationen mit anderen übergeord-
neten Bereichen, z.B. mit dem Skills Lab zur Mitnutzung
von Räumlichkeiten sind ebenfalls sinnvoll. Eine zentrale
Ansprechpartnerin bzw. ein zentraler Ansprechpartner
ist für die Kommunikation und die Abstimmungsprozesse
zwischen den einzelnen Abteilungen sowie die Organi-
sation regelmäßiger Arbeitstreffen hilfreich.
32 334.3.2. KOMMUNIKATION LEHREN WILL GELERNT SEIN – 4.3.3. PRÜFEN RECHTZEITIG EINPLANEN – ABSTIMMUNG
QUALIFIKATION VON DOZIERENDEN MIT LEHRINHALTEN
Die Etablierung und Ausdifferenzierung eines Kommuni- Auch wenn das Thema Prüfungen zu Beginn der Curri- fächerbezogen oder interdisziplinär ausgerichtet sind
kationscurriculums erfordert spezifische Kompetenzen in culumsimplementierung nicht selten nachrangig behan- und welche Inhalte genau geprüft werden. Idealerweise
verschiedenen Bereichen. Vordringlich ist die Qualifizie- delt wird, ist es vorteilhaft, diese frühzeitig zu konzipie- soll es einen Prüfungsblueprint geben, der die Planung
rung der Lehrenden. Auch für das Simulationspatienten- ren. Im Sinne eines Constructive Alignement (siehe einer ausgewogenen Überprüfung kommunikativer Kom-
programm müssen geschulte Trainerinnen und Trainer Abbildung 8) müssen Lehrinhalte und Prüfungen aufein- petenzen ermöglicht und Abstimmungsprozesse bezüg-
vorhanden sein. Die bereits vorhandene Expertise sollte ander abgestimmt werden. Daher ist es sinnvoll, Prü- lich der Prüfinhalte unterstützt. Weiterhin sollen die ein-
zu Beginn ermittelt und mit Blick auf die zukünftigen fungen gemeinsam mit den Lehrveranstaltungen und gesetzten Bewertungsinstrumente (Checklisten, Beur-
Anforderungen bewertet werden. Unterrichtseinheiten zur Kommunikation als Gesamtkon- teilungs-/Bewertungsbögen etc.) insbesondere im Hin-
strukt zu planen. blick auf den definierten Erwartungshorizont vereinheit-
Hierzu liegen im Rahmen des Mustercurriculums Schu- licht werden.
lungskonzepte vor, sowohl für Dozierende als auch für Wird an der Fakultät bereits Kommunikation geprüft, ist
studentische Tutorinnen und Tutoren (siehe oben). Das Abbildung 7: Verleihung der Zertifikate für die Absolventinnen eine Bestandsaufnahme dieser Prüfungen erforderlich, Daran anknüpfend wird dann in Zusammenarbeit mit
Ausbildungsprogramm für studentische Tutorinnen und und Absolventen des Qualifizierungsprogramms „Studentische/r um an die vorhandenen Formate und Konzepte anzu- den Fächern ein abgestimmtes Prüfungsprogramm ent-
Tutoren ist ein Kooperationsprojekt verschiedener Partner- Kommunikationstrainer/in“ vom 23.-24. Oktober 2018 in Mainz knüpfen und diese weiterentwickeln zu können. Zu klären wickelt. Das bedeutet, dass Prüfungen in Zusammen-
fakultäten, die an ihren Standorten Gastgeber für die sind grundlegende Fragen wie die Anzahl und der Zeit- hang mit den im Unterricht vermittelten Kompetenzen
Schulungen sind (Abbildung 6). Das Zertifikat „Studenti- punkt der Prüfungen, der Abschnitt bzw. das Fach, in dem stehen, longitudinal aufeinander aufbauen und auf die
sche/r Kommunikationstrainer/in“ erhalten alle erfolgrei- sie durchgeführt werden und das Format, z. B. OSCE oder Staatsexamina vorbereiten. Dabei muss analysiert wer-
chen Absolventinnen und Absolventen. MC-Fragen, Reflexionsbericht oder MiniCEX. Diese Fragen den, ob und inwieweit kommunikative Inhalte in beste-
lassen sich u.U. im Rahmen des Curricular Mappings be- hende Prüfungen integriert werden können und welche
Weitere Möglichkeiten zur Qualifizierung des Lehrperso- antworten. Vertiefend sollte geklärt werden, wer für die Prüfformate dafür in Betracht kommen.
nals bieten interne Hospitationen und das Erarbeiten Prüfungsinhalte und -formate verantwortlich ist, ob diese
kleiner Bausteine in gemeinsamen Projekten, auch mit
externen Expertinnen und Experten.
34 35SCHAUBILD CONSTRUCTIVE ALIGNEMENT
Struktur: Kompetenzorientierter Gegenstandskatalog und NKLM
I + II. Präambel (Ziele, Entstehungsgeschichte, Theorie und Menschenbild)
III. Absolventenprofil -> Med. Experte (10 – 15 EPAs)
IV. Arztrollen
Gelehrte/-r Gesundheitsberater/-in und -fürsprecher/-in
Kommunikator/-in Verantwortungsträger/-in und Manager/-in
Mitglied eines Teams Professionell Handelnde/-r
V. Konsultationsanlässe/Gesundheitsstörungen
VI. Erkrankungen mit Deskriptoren
VII. Übergeordnete und krankheitsbezogene Lernziele
1. a) Prinzipien normaler Struktur und Funktion
b) Prinzipien der Pathogenese & Pathomechanismen
2. Diagnostische Verfahren
3. Therapeutische Maßnahmen
4. Notfallmaßnahmen
VIII. Übergeordnete Kompetenzen
1. Medizinisch-wissenschaftliche Fertigkeiten
2. Ärztliche Gesprächsführung
3. Interprofessionelle Kompetenzen Lernziele:
4. Gesundheitsberatung, -förderung und Prävention
5. Führung und Management
6. Professionelles Handeln und Ethik, Geschichte u. Recht der Medizin
• Kompetenzorientierter
M4 Teil 1 Prüfung an der Patientin oder am Patienten
7. Klinisch-praktische Fertigkeiten Gegenstandskatalog
• NKLM
Longitudinales Mustercurriculum Kommunikation
Lern- und Lehrmethoden Prüfungsmethoden:
zur Erreichung der • Fakultätsinterne
definierten Lernziele Prüfungen
(Fakultäten)
• STEX
Abbildung 8: Constructive Alignment
36 374.3.4. UMSETZUNGSSCHRITTE PLANEN – LENKUNG UND
KOORDINATION
Ein Instrument zur Erfassung der institutionellen und Stärken auszubauen, die Schwächen zu minimieren oder Zudem ist die Gründung einer fakultätsübergreifenden Ausgehend von den Voraussetzungen und dem Bedarf
übergeordneten Rahmenbedingungen stellt die SWOT- zu kompensieren, Chancen zu nutzen und Bedrohungen Arbeitsgruppe Kommunikation zu empfehlen, in der Ver- bezüglich der genannten Faktoren wird ein Projektplan
Analyse dar. Dieses Verfahren diente ursprünglich der zu erkennen [47]. treterinnen und Vertreter aus möglichst vielen Fachberei- zur Implementierung des Kommunikationscurriculums
Unternehmensanalyse, kommt heute jedoch in vielen chen und Abteilungen sowie z. B. Mitarbeiterinnen und erstellt. Darin werden konkrete Schritte festgelegt und
Bereichen für Fragen nach der Positionierung zum Ein- Die SWOT-Matrix wird im Rahmen einer Gruppendiskus- Mitarbeiter des Studiendekanats repräsentiert sind. Entscheidungen dokumentiert, beispielsweise welche
satz. SWOT steht für strengths, weaknesses, opportuni- sion bearbeitet. Der Teilnehmendenkreis sollte möglichst Mittel bei welchen Stellen beantragt und welche Struktu-
ties und threats. Bei einer SWOT-Analyse werden die viele Sichtweisen umfassen und die Perspektiven sowohl Externe Vernetzungen und Kooperationen im Rahmen ren für die notwendigen Abstimmungsprozesse geschaf-
Stärken und Schwächen einer Organisation sowie die der Dozierenden als auch Studierenden, Lehrverantwort- verschiedener didaktischer Qualifizierungsprogramme fen werden müssen.
Chancen und Risiken ihres Umfelds systematisch analy- lichen und Vertreterinnen und Vertreter des Studiende- und Gesellschaften, beispielsweise das Programm
siert. Mit ihrer Hilfe werden die Stärken und Schwächen kanats abbilden. Master of Medical Education (http://www.mme-de. Am Ende steht ein Zeit- und Kostenplan. Dieser bein-
der vorhandenen Kommunikationslehre beschrieben und Damit verbunden ist das Ziel, auf den jeweiligen Stand- net/index.php), das MedizinDidaktikNetz (https:// haltet den zeitlichen Ablauf der Implementierung und
ein Bewusstsein für die lokalen und übergeordneten Chan- ort angepasste Lösungsvorschläge für die geplante Im- www.medidaktik.de/kompetenzzentrum/netzwerke/ die benötigten Finanzressourcen. Er bildet die Grundlage
cen und Risiken geschaffen. Die Methode dient dazu, die plementierung zu erarbeiten. medizindidaktiknetz/hintergrund-und-ziele/) und die für Verhandlungen (beispielsweise mit dem Dekanat) und
Gesellschaft für Medizinische Ausbildung (https:// ermöglicht die anschauliche Vorstellung des Vorhabens in
gesellschaft-medizinische-ausbildung.org/startseite.html) Gremien und gegebenenfalls bei weiteren Stakeholdern.
bieten eine gute Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen
Stärken Schwächen sowie Konzepte und Ressourcen zu bündeln. Zudem
Worin sind wir schon gut? Wo treten Probleme auf? können Forschungsgelder beantragt werden. Dabei sind
standortübergreifende Verbundanträge empfehlenswert.
• Zentrales SP-Programm • Geringe interprofessionelle Ausprägung
• Motivierte und engagierte Einzeldozierende • Dezentrale Lehrverantwortung
• Bewusstsein für notwendige Veränderungen • Mangel an klinischer Integration kommunikativer
• Interdisziplinäre und interprofessionelle Inhalte
Lehreinheiten • Fehlende Ressourcen
• Durchführung von OSCE-Prüfungen • Geringes Interesse der Studierenden
Chancen Risiken
Von welchen externen Entwicklungen kann Welche Entwicklungen könnten
das Vorhaben profitieren? Probleme bereiten?
• Masterplan Medizinstudium 2020 • Viele unterschiedliche Interessen
• Patientensicherheit • Definition „gute Kommunikation“
• Forderungen des Wissenschaftsrats • Erworbene Kompetenzen in der Praxis aufgrund
• Gesetzesänderungen von Zeitdruck nicht anwendbar
• Einbindung von Patientenverbänden • Abwanderung zentraler Personen/ Unterstützer-
innen und Unterstützer
• Öffentlichkeit, Gesellschaft, Medien
• Herausfordernde, neue Kontexte:
Diversity/ Migration
Abbildung 9: Beispiel für eine SWOT-Matrix
38 39Sie können auch lesen