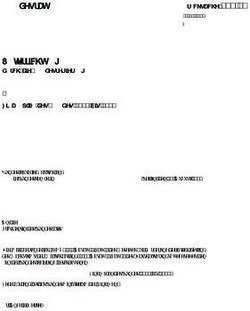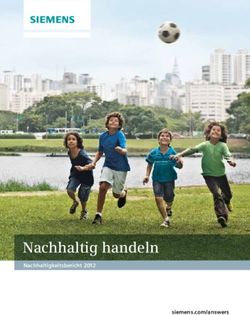UMWELTBILDUNG UND -ERZIEHUNG IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Bayerisches Staatsministerium für
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen
Bayerisches Staatsministerium für
Umwelt und Gesundheit
Familie und Jugend
UMWELTBILDUNG UND -ERZIEHUNG
IN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN
AUSGEWÄHLTE THEMEN UND PROJEKTE
BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNGUmweltbildung und
-erziehung in
Kindertageseinrichtungen
Ausgewählte Themen und Projekte
Handreichung für das pädagogische PersonalInhaltsverzeichnis
Vorwort 5
Umweltbildung / Bildung für nachhaltige Entwicklung 6–9
Bildungsverständnis und Bildung für nachhaltige
Entwicklung im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan 10 – 13
1 Boden/Erde
1.1 Hintergrundinformationen 14 – 15
1.2 Projektbeispiel „Wir erkunden den Boden“ 16 –25
In Zusammenarbeit mit dem Städtischen Kinderhaus,
Felicitas-Füss-Straße 14, München (Oberbayern)
2 Wasser
2.1 Hintergrundinformationen 26 –27
2.2 Projektbeispiel „Sauberes Wasser ist kostbar” 28 –39
In Zusammenarbeit mit dem Städtischen Kindergarten Sonneneck,
Kaufbeuren (Schwaben)
3 Energie und Klima
3.1 Hintergrundinformationen 40 – 41
3.2 Projektbeispiel „Energie entdecken und Klima schützen“ 42 – 49
In Zusammenarbeit mit der Kindertageseinrichtung „Hand in Hand“,
Hemhofen bei Forchheim (Oberfranken)
4 Ernährung
4.1 Hintergrundinformationen 50 – 51
4.2 Projektbeispiel „Ist Schokoladencreme gesund?“ 52 – 59
In Zusammenarbeit mit dem Städtischen Kinderhaus,
Felicitas-Füss-Straße14, München (Oberbayern)
5 Biologische Vielfalt (Biodiversität)
5.1 Hintergrundinformationen 60 – 61
5.2 Projektbeispiel „Die Entdeckerwiese” 62 – 73
In Zusammenarbeit mit dem LBV Kindergarten arche noah,
Hilpoltstein (Mittelfranken)
6 Abfallwirtschaft, Verbraucherschutz und Konsum
6.1 Hintergrundinformationen Abfallwirtschaft 74 – 75
6.2 Hintergrundinformationen Verbraucherschutz und Konsum 76 – 77
6.3 Projektbeispiel „Wir wünschen uns ein Baumhaus” 78 – 89
In Zusammenarbeit mit der Kindertageseinrichtung „Waldkinder-Regensburg“,
Pielenhofen bei Regensburg (Oberpfalz)
Bildnachweis 90
4Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
Kinder sind von Natur aus neugierig und begeisterungsfähig. Sie haben ein besonderes
Gespür für ihre Umwelt und nehmen sie intensiv mit allen Sinnen wahr. Hier setzt die
Umweltbildung an. Kindertageseinrichtungen bieten den Kindern vielfältige Möglichkeiten,
ihre Umgebung zu entdecken. Spielerisch und altersgerecht werden sie an die Zusammen-
hänge der Natur herangeführt und ihre kindlichen Kompetenzen gestärkt. Sie lernen
verstehen, dass Natur und Umwelt wichtige Bestandteile vieler Bereiche des täglichen
Lebens sind und wir Menschen Verantwortung für sie tragen.
Umweltbewusstes und umweltgerechtes Denken und Handeln sind Voraussetzung für die
Bewahrung der natürlichen Lebensressourcen nachfolgender Generationen. Umweltbil-
dung und -erziehung sind in Bayern gesetzlich verankert (§ 8 AVBayKiBiG) und gehören
seit jeher zum Bildungsauftrag von Kindertageseinrichtungen. Da die unterschiedlichsten
Lebensbereiche berührt sind, findet sich Umweltbildung als durchgängiges Prinzip in vielen
Bereichen des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans. Von „Werteorientierung und
Religiosität“ über „Gesundheit“, „Ästhetik, Kunst und Kultur“ bis hin zu „Naturwissenschaft
und Technik“.
Die Broschüre gibt neue Impulse bei der Arbeit in Kindertageseinrichtungen und der
Bildung für nachhaltige Entwicklung. Als Nachfolgeprojekt der 1997 aufgelegten und 2005
aktualisierten Broschüre „Umwelterziehung im Kindergarten. Gemeinsam geht es am
besten“ führt sie Sachinformationen und Zielvorstellungen sowie aktuelles pädagogisches
Fachwissen zusammen.
Für die pädagogische Arbeit stellt die Broschüre zentrale Themen aus dem Bildungsbereich
„Umwelt“ vor. Die Kapitel hierzu sind einheitlich gegliedert. Hintergrundinformationen
zeigen inhaltliche Ansatzpunkte für die Arbeit auf. Anschauliche Beispiele aus der Praxis
verdeutlichen, wie Kinder Zusammenhänge erkennen und verstehen und so einen nachhal-
tigen Lebensstil entwickeln können.
Die Broschüre richtet sich an alle, die Bildungsprozesse in Kindergarten- oder Grundschul-
einrichtungen begleiten. Sie soll Sie, liebe Leserinnen und Leser, dabei unterstützen,
umweltpädagogische Themen gemeinsam mit den Kindern zu erschließen.
Den an der Erstellung der Broschüre beteiligten Kindertageseinrichtungen, dem Landes-
bund für Vogelschutz in Bayern e.V. (LBV) und der Leuchtpol gGmbH danken wir für die
Bereitstellung der Projektbeispiele, dem LBV darüber hinaus für den Beitrag zur Umweltbil-
dung / Bildung für nachhaltige Entwicklung. Den Staatsministerien für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten sowie der Justiz und für Verbraucherschutz danken wir für ihre fachliche
Unterstützung bei den Themen Ernährung, Verbraucherschutz und Konsum.
Wir wünschen Ihnen und vor allem den Kindern beim Gestalten und Umsetzen der Anre-
gungen in die Praxis viel Freude und Erfolg!
Christine Haderthauer MdL Dr. Marcel Huber MdL
Bayerische Staatsministerin für Bayerischer Staatsminister für
Arbeit und Sozialordnung, Umwelt und Gesundheit
Familie und Frauen
5Umweltbildung /
Bildung für nachhaltige Entwicklung
Nachhaltige Entwicklung ist heute das Nachhaltige Entwicklung ist ohne intensive
allgemein anerkannte Leitbild, wirtschaft- Bildungsarbeit nicht möglich. Im Kapitel 36,
liche Leistungsfähigkeit, soziale Gerechtig- S. 261 der Agenda 21 ist dazu festgehalten:
keit, ökologische Verträglichkeit und demo- „Bildung ist eine unerlässliche Vorausset-
kratische Politikgestaltung zu verbinden zung für die Förderung einer nachhaltigen
und die Zukunftschancen unserer Gesell- Entwicklung und die Verbesserung der
schaft zu sichern. Fähigkeit der Menschen, sich mit Umwelt-
und Entwicklungsfragen auseinanderzu-
Ausgangspunkt war die Agenda 21. 1992 setzen…“
verpflichteten sich in diesem Aktionspro-
gramm 178 Staaten auf der Konferenz der
Vereinten Nationen in Rio de Janeiro, UN-Dekade
nachhaltige Entwicklung als Grundprinzip
ihrer Politik einzuführen. Nachhaltige Dieser Gedanke wurde auf der Konferenz
Entwicklung ist damit das zentrale Leitbild der Vereinten Nationen 2002 in Johannes-
für die Gestaltung der Zukunft weltweit. burg noch einmal aufgegriffen. Es wurde
Der dadurch eingeleitete Wandlungsprozess bekräftigt, dass auf Bildung für nachhaltige
bezieht alle gesellschaftlichen Gruppen mit Entwicklung nicht verzichtet werden darf,
ein. Er ist sehr lang und letztendlich auf die und der Beschluss gefasst, von 2005 bis
Bereitschaft und den Beitrag eines jeden 2014 eine UN-Dekade „Bildung für nach-
Einzelnen angewiesen. haltige Entwicklung“ auszurufen.
Ziel der Dekade ist es, die Idee der nach-
Prinzipiell geht es bei nachhaltiger Entwick- haltigen Entwicklung weltweit in den
lung um zweierlei: nationalen Bildungssystemen zu verankern.
t zum einen um die Herstellung von
Verteilungsgerechtigkeit in der jetzigen In der Bundesrepublik wurde auf Beschluss
Generation und des Deutschen Bundestages 2004 ein
t zum anderen um die Sicherung der nationaler Aktionsplan entwickelt, der vier
Entwicklungsmöglichkeiten kommender strategische Ziele verfolgt:
Generationen. t Die gute Praxis der Bildung für nachhal-
Derzeit verbrauchen die hochindustrialisier- tige Entwicklung soll weiterentwickelt
ten Länder des Nordens sehr viel mehr an und auf ein breites Fundament gestellt
Ressourcen als die weniger entwickelten werden. Dabei sollen alle Bildungseinrich-
Länder des Südens. Gleichzeitig tragen sie tungen von der Kindertageseinrichtung
zu einem weitaus höheren Schadstoffaus- bis zur Weiterbildungsstätte eingebunden
stoß weltweit bei. Raubbau an natürlichen sein, aber auch das breite Spektrum der
Ressourcen gilt es im Interesse der Entwick- informellen Bildung soll erreicht werden.
lungsmöglichkeiten zukünftiger Generatio- t die Vernetzung der Akteure
nen zu vermeiden. Klimawandel, der Verlust t die Verbesserung der öffentlichen Wahr-
der Artenvielfalt, die Ausbreitung der Wüsten nehmung und
oder die Tatsache, dass über 750 Millionen t die Stärkung internationaler Kooperatio-
Menschen keinen Zugang zu sauberem nen, da nachhaltige Entwicklung nicht an
Wasser haben, sind traurige Belege für unser Landesgrenzen Halt macht.
derzeitiges nicht-nachhaltiges Verhalten.
6Bayerischer Aktionsplan Schlagworten Kopf, Herz und Hand in der
Praxis viele Anhänger fand.
Aufgrund des föderalen Bildungssystems
der Bundesrepublik Deutschland entschloss Ziel der Bildung für nachhaltige Entwicklung
sich der Arbeitskreis Bildung für nachhal- ist die Stärkung von Kompetenzen und
tige Entwicklung unter Federführung des Werten im Sinne von Gestaltungskompe-
Bayerischen Staatsministeriums für Um- tenz. Sie bezeichnet die Fähigkeit, Wissen
welt und Gesundheit, einen bayerischen über nachhaltige Entwicklung anzuwenden
Aktionsplan zu entwickeln, der sich speziell und Probleme nicht-nachhaltiger Entwick-
mit den Akteuren von Umwelt, Bildung und lung zu erkennen. In einfachen Worten
Nachhaltigkeit im Freistaat befasst. Er zeigt bedeutet Gestaltungskompetenz nichts
maßgeschneiderte Perspektiven für Bildung anderes als: Hier nicht leben auf Kosten von
für nachhaltige Entwicklung in allen anderswo und heute nicht auf Kosten von
Bildungsbereichen auf. morgen.
Ausgehend von der Tatsache, dass nachhal-
tige Entwicklung nur auf der Grundlage von Bedeutung von BNE
Wissen und Werten erfolgen kann, wurden im Elementarbereich
Perspektiven für alle Bildungsbereiche ent-
wickelt und 2009 der Öffentlichkeit vorge- Bildung für nachhaltige Entwicklung will
stellt. Auf Seite 50 ist dort für den Elemen- nicht von Erwachsenen verursachte Proble-
tarbereich zu lesen: „Die moderne Lern- me in die Kindertageseinrichtung verlagern.
psychologie und Hirnforschung zeigt, dass Im Gegenteil, Bildung für nachhaltige Ent-
Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren weit wicklung bietet für die Kinder eine große
mehr bildungsbereit und bildungsfähig Chance, zu entdecken, welche Potentiale für
sind, als man bisher angenommen hat. sie in einer sich dynamisch entwickelnden
Wichtige Anlagen und Kompetenzen und vielfältigen Welt liegen und welche
werden in diesem Zeitraum in sensiblen Möglichkeiten zur Mitgestaltung vorhanden
Phasen angelegt und Werthaltungen sind. Zuversicht mit Blick auf eine lebens-
etabliert. Aus diesem Grund ist es wichtig, werte Zukunft erfahren Kinder vor allem
mit Inhalten und Methoden der Bildung für durch das Vorbild von Erwachsenen, die
nachhaltige Entwicklung diese Kompeten- sich engagiert für eine gesunde Umwelt
zen optimal zu fördern. Insbesondere sollen einsetzen, und dadurch, dass sie sich selbst
Initiativen gefördert werden, die sich mit am umweltgerechten Alltagshandeln in der
Bildung für nachhaltige Entwicklung im Kindertageseinrichtung beteiligen. Auf diese
Elementarbereich befassen, die Aus- und Weise entwickeln Kinder auch die Kompe-
Weiterbildung der Fachkräfte in diesem tenz zur Problemlösung und die Bereit-
Bereich verstärkt und Öffentlichkeitsarbeit schaft, Verantwortung für sich selbst, die
intensiviert werden.“ Gemeinschaft und die Umwelt zu überneh-
men. Bildung für nachhaltige Entwicklung
fördert durch Partizipation, Situations- und
Umweltbildung / Bildung für Handlungsorientierung gerade in heteroge-
nachhaltige Entwicklung nen Gruppen die Suche nach konstruktiven
Lösungen.
Ziel der Umweltbildung ist es, einen verant-
wortungsbewussten Umgang mit Umwelt Konkrete Anknüpfungsmöglichkeiten bietet
und den natürlichen Ressourcen zu vermit- unsere heimische Natur im Garten und im
teln. Dabei wird über einen ganzheitlichen Umfeld der Kindertageseinrichtung. Hier
Ansatz die affektiv-emotionale Ebene, die können Kinder als Entdecker und Erforscher
kognitive wie auch die aktionale Ebene ihrer Welt tätig werden und all ihre Fähig-
berücksichtigt. Ein Ansatz, der mit den keiten und Fertigkeiten stärken. Darüber
7hinaus hält der Kindergartenalltag vielfälti- higen Kommune werden. Auch in diesem
ge Möglichkeiten bereit, im demokratischen Kontext gibt es zahlreiche Anknüpfungs-
Miteinander Umweltprojekte zu planen, punkte für die aktive Beteiligung von Kindern
Schwerpunkte zu setzen und bei der Suche und Eltern (Maßnahmen zur Abfallvermei-
nach umweltgerechten Lösungen zu koope- dung, Mülltrennung, Kompostierung, zur
rieren. In der Zusammenarbeit mit fachkun- Reduzierung von Energieverbrauch, Aus-
digen Stellen (der lokalen Agenda 21, Um- wahl ortsnaher Zulieferer etc.), um umwelt-
welt- und Naturschutzverbänden, Umwelt- verantwortliches Denken und Handeln zu
stationen, Abfall- und Energieberatungs- stärken.
stellen, Forstämtern, Verbraucherschutz-
organisationen etc.) werden die vielfältigen Themenauswahl
Möglichkeiten von nachhaltigem umwelt-
bezogenen Denken und Handeln deutlich. Bei der Auswahl der Themen für die vorlie-
gende Broschüre haben wir neben dem
Mit Blick auf die anzustrebende Bildungs- eindeutigen Bezug zur nachhaltigen Ent-
und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern wicklung vor allem darauf geachtet, dass sie
ist es notwendig, dass sich diese mit den sich im ganz normalen Alltag der Kinderta-
Werthaltungen, die der Bildung für nachhal- geseinrichtung umsetzen lassen, ohne zu
tige Entwicklung zu Grunde liegen, ausein- große Anforderungen an spezielle natur-
anderzusetzen. Vor allem Beteiligungsmög- räumliche Gegebenheiten oder das Spiel-
lichkeiten, aber auch Informationen und ein und Experimentiermaterial zu stellen.
entsprechendes Angebot an Materialien
tragen dazu bei, dass Eltern die Methoden
der Bildung für nachhaltige Entwicklung Boden/Erde
auch im familiären Umfeld integrieren.
Als Grundlage menschlichen Lebens erfüllt
die Naturressource Boden unentbehrliche
Ökologie
Funktionen wie z. B. Trinkwasserversorgung,
Nahrungsmittelproduktion oder dient als
Bau- und Rohstofflager. Darüber hinaus ist
Soziales der Boden aber Lebensraum zahlreicher
Lebewesen, seien es Mikroorganismen,
Bakterien, Pilze, Tiere oder höhere Pflanzen.
Hier wird der Boden zum Entdeckungsraum
für die tägliche Kindergartenarbeit und
Ökonomie
bietet zahlreiche Erlebnis- und Untersu-
chungsmöglichkeiten.
Die Kindertageseinrichtung als
möglicher Modellort der zukunfts-
fähigen Kommune Wasser
Wird der Begriff der nachhaltigen Entwick- Aufgrund der Tatsache, dass unsere Erde zu
lung auf die Betriebsführung, die Auswahl drei Viertel von Wasser bedeckt ist, wird sie
der Lieferanten oder die Gestaltung von gerne auch als blauer Planet bezeichnet.
Außengelände und Gebäude ausgedehnt, Scheinbarer Wasserüberfluss relativiert sich
so müssen Träger und politische Entschei- schnell, wenn wir die Salzwasser- von den
dungsträger in der Gemeinde bzw. Kommu- Süßwasservorräten der Erde trennen und
ne einbezogen werden. Wird das Innova- sehen, wie wichtig der Zugang zu sauberem
tionspotential der Bildung für nachhaltige Trinkwasser für uns Menschen ist. Über den
Entwicklung genutzt, kann die Kindertages- achtsamen Umgang mit diesem Element
einrichtung zum Modellort einer zukunftsfä- hinaus bietet aber Wasser als Lebensraum
8viele Möglichkeiten, die besondere Tier- und Biologische Vielfalt (Biodiversität)
Pflanzenwelt darin zu entdecken, und
Gelegenheiten für einfache naturwissen- Die Erhaltung der biologischen Vielfalt ist
schaftliche Versuche. für uns Menschen überlebensnotwendig.
Zum einen gehen alle Nutztiere und Nutz-
pflanzen auf wildlebende Arten zurück, aber
Energie und Klima auch viele Wirkstoffe der Medizin lassen
sich auf Pflanzen zurückführen. Nicht nur die
Woher kommt unsere Energie? Warum sind besondere Bedeutung als Lebensgrundlage
wir manchmal energiegeladen oder eher für den Menschen macht biologische Vielfalt
schlapp? Woher bekommen Tiere und so faszinierend, sondern auch das Entde-
Pflanzen Energie? Welche Rolle spielt die cken der unterschiedlich angepassten Tiere
Sonne? Das Thema Energie lässt sich auf und Pflanzen in unserer unmittelbaren
vielfältige Weise in der Kindertageseinrich- Umgebung. Wie sehr die verschiedenen
tung erlebbar machen. Der sparsame Um- Arten voneinander abhängen, macht die
gang mit Energie und das Entdecken von Beschäftigung mit dem Thema biologische
neuen Möglichkeiten zum Energiesparen Vielfalt facettenreich und spannend.
machen das Thema auch über einen länge-
ren Zeitraum im Kindergarten interessant.
Abfallwirtschaft, Verbraucher-
schutz und Konsum
Ernährung
Der Frage nachzugehen, was mit den
Woher kommt all unser Essen? Ernähren Dingen geschieht, die wir nicht mehr
wir uns gesund? Wie ernähren sich Kinder brauchen, und gleichzeitig zu überlegen,
in anderen Teilen der Welt? Mit diesen ob es Abfall in der Natur gibt, eröffnet ein
Fragen ist man schon mittendrin im span- weites Feld von Betrachtungsmöglichkeiten
nenden Thema Ernährung und nachhaltige über unseren Umgang mit den Dingen des
Entwicklung. Geruchs- und Geschmackssinn täglichen Lebens. Ob bei Ernährung,
führen direkt zu einer aufschlussreichen Bekleidung oder Spielzeug – was passiert
Auseinandersetzung, wie weit z. B. unsere damit, wenn es nicht mehr gebraucht wird?
Lebensmittel reisen müssen oder welche Reparieren oder neu kaufen – hier ist man
Köstlichkeiten eine bunte Blumenwiese für schnell bei der Suche nach einem nachhalti-
uns zu bieten hat. gen Lebensstil.
Quellen:
t Zukunftsfähigkeit im Kindergarten vermitteln: Kinder stärken, nachhaltige Entwick-
lung befördern; Ein Diskussionsbeitrag der Deutschen UNESCO-Kommission
im Rahmen der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung (2005 – 2014)“;
Herausgeber: Deutsche UNESCO-Kommission e. V. (DUK); Bonn; 2010
t Akteure, Wege, Perspektiven: Bildung für nachhaltige Entwicklung in Bayern,
Aktionsplan im Rahmen der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung
2005-2014, Herausgeber: Arbeitskreis Bildung für nachhaltige Entwicklung unter
Federführung des StMUG in Bayern, Kempten, 2009
t Nationaler Aktionsplan für Deutschland, UN-Dekade „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ 2005 – 2014, V.i.S.d.P.: Prof. Dr. Gerhard de Haan, Freie Universität
Berlin, 2005
9Bildungsverständnis und Bildung für nachhaltige
Entwicklung im Bayerischen Bildungs- und Erzie-
hungsplan
Auf Bildung für nachhaltige Entwicklung Gemeinschaft vorfindet, sich eingebunden
ist im Bayerischen Bildungs- und Erzie- fühlt und Stärkung seiner Kompetenzen
hungsplan (BayBEP) Bezug genommen erfährt (Basiskompetenzen/BayBEP S. 54ff).
im themenbezogenen Bildungs- und
Erziehungsbereich „Umwelt“. Neben den Einen emotionalen Zugang zur Umwelt
Bildungszielen „Naturbegegnung“ und erhalten die Kinder, wenn sie die natürliche
„Nachsorgender Umweltschutz“ erscheint Umwelt als Quelle der Freude und Ent-
Bildung für nachhaltige Entwicklung als spannung erleben. Kinder unter 3 Jahren
weitere wichtige Dimension von Umweltbil- brauchen deshalb vielfältige Möglichkeiten
dung und -erziehung. „Bereits junge Kinder z.B. zum Staunen über die Artenvielfalt,
bringen die Voraussetzungen dafür mit, zum Gestalten mit Naturmaterialien und zu
diesem Ziel im Rahmen entwicklungsange- stärkenden Erfahrungen bei der Übernahme
messener Lernprozesse zu entsprechen.“ von Verantwortung (z. B. Blumenpflege).
(BayBEP, 2010, S. 292). Kinder sollen sich Durch Ausprobieren können sie selbsttätig
deshalb schon in der Familie und in Kinder- Antworten auf ihre „Warum-Fragen“ fin-
tageseinrichtungen in Kooperation mit an- den. Auch in Projekte können Kinder schon
deren für eine gesunde Umwelt engagieren sehr früh aktiv eingebunden werden. Das
und dabei Denken und Handeln im Sinne gemeinsame Tun mit Anderen lässt sie
der Bildung für nachhaltige Entwicklung in die Lerngemeinschaft der „Größeren“
einüben (vgl. BayBEP, S. 292f). hineinwachsen, in der Denkweisen nachhal-
tiger Entwicklung durch Dialog und sozialen
Austausch ko-konstruiert werden.
Prinzip der Entwicklungs-
angemessenheit Tragend hierbei ist gegenseitige Achtung
und Wertschätzung. Das sind auch die Wer-
Der BayBEP vertritt folgende Grundannah- te, die Grundlage der Bildung für nachhal-
men oder folgendes Bild vom Kind: Es ist tige Entwicklung sind. Nur in einem sozial
von Geburt an reich an Ressourcen und gerechten Klima kann sich ein Bewusstsein
Kompetenzen, es geht von Anfang an neu- für umweltverantwortliches Denken und
gierig und wissenshungrig auf die Welt zu, Handeln entwickeln. Darüber hinaus müs-
es will die Welt verstehen und hat Freude sen umweltpädagogische Bildungsprozesse
daran, sie mitzugestalten (vgl. BayBEP, S. anknüpfen an die speziellen Bedürfnisse
23ff). Aufgabe von Kindertageseinrichtun- und den aktuellen Entwicklungs- und Lern-
gen ist es, diese Lernfreude zu erhalten und stand des einzelnen Kindes. Gelingt beides,
mit Prozessen zu verbinden, die Kinder zu kann in Kindertageseinrichtungen eine
selbsttätigem und verantwortlichem Han- Lernkultur wachsen, in der Kinder ermu-
deln in der sozialen Gemeinschaft befähi- tigt werden, miteinander zu forschen und
gen. Voraussetzung hierfür ist, dass das selbsttätig Lösungen für umweltgerechtes
Kind ein positives emotionales Klima in der Denken und Handeln zu finden.
10Bildung für nachhaltige Ent- (vgl. Vygotsky, 1987). Kinder oder Erwach-
wicklung durch Lernen im Dialog sene, die mehr über einen bestimmten
und sozialen Austausch (Ko-Kon- Sachverhalt wissen, die weiterführende Fra-
struktion) gen stellen, die das Nachdenken anregen,
die neue Perspektiven auf einen Sachverhalt
Der Bayerische Bildungs- und Erziehungs- öffnen, können das Kind zum Denken auf
plan baut auf einem ko-konstruktiven Lern- dem nächsthöheren Niveau herausfordern.
ansatz auf (vgl. BayBEP, 2010, S. 31ff). Dabei Wird diese „Zone der nächsten Entwick-
wird davon ausgegangen, dass sich der Auf- lung“ betreten, wird die Entwicklung beste-
bau von Wissen und das Verstehen von Ge- hender Problemlösefähigkeiten unterstützt.
gebenheiten, Situationen, Deutungen und
Bedeutungen im sozialen Austausch voll- Aufgabe der pädagogischen Fachkraft ist es,
ziehen. In offenen Dialogen, im Austausch im sozialen Austausch mitzuwirken und ihn
von Perspektiven und Vorstellungen werden gleichzeitig zu unterstützen. Durch weiterfüh-
gemeinsame Ziele ausgehandelt und eine rende Fragen ermutigt sie die Kinder Hypo-
Verständigung auf das für alle Bedeutsame thesen aufzustellen (z. B. über den Grund
herbeigeführt. An Ko-Konstruktionsprozes- dafür, dass Raupen sich an Brennnesseln
sen sind Kinder und Erwachsene (Erzieher, nicht verbrennen), regen zur Auseinanderset-
Eltern, Experten u. a.) zugleich aktiv beteiligt zung mit verschiedenen Vorstellungen und
(Demokratieprinzip/BayBEP S. 34f). zum Finden gemeinsamer Lösungen an. Die
Qualität des individuellen Lernfortschritts ist
Jedes einzelne Kind bereichert den Ko- dabei von der Qualität der Zusammenarbeit
Konstruktionsprozess mit seiner ganz und der Interaktionen zwischen den Beteilig-
eigenen Perspektive auf einen Sachverhalt. ten beeinflusst. Insofern werden Sprache und
Vielfältige und unterschiedliche Perspekti- Gespräch zu zentralen, Lern- und Bildungs-
ven können so zur Erweiterung individueller prozesse steuernden Elementen (vgl. Textor,
Denk- und Handlungsmöglichkeiten beitra- 2000; Siraj-Blatchford, 2007).
gen und ebenso zur Entwicklung der Denk-
und Handlungsmöglichkeiten der Lernge- Umweltpädagogische Ansätze, die allein die
meinschaft führen. Entscheidend für den Begegnung mit der Natur, die Erfahrungen
Lernertrag des einzelnen Kindes ist, dass es mit Tieren und Pflanzen und den Umgang
mit seinen ganz speziellen Erfahrens- und mit Naturmaterialien ins Zentrum stellen,
Denkweisen, seinen Wissensvoraussetzun- greifen vor diesem Hintergrund zu kurz.
gen, Interessen und lebensweltlichen und Auch Ansätze, die die sozialen Interaktionen
kulturellen Bezügen an die gemeinsamen der Kinder untereinander als das allein Ent-
Überlegungen anknüpfen kann und zu scheidende sehen, sind aus dieser Perspek-
weiterführenden Reflexionen angeregt wird. tive nicht hinreichend, (umweltpädagogi-
Nur wenn die „ganze Perspektive“ des Kin- sche) Bildungsprozesse anzuregen. Bildung
des im Lernprozess Berücksichtigung findet, für nachhaltige Entwicklung greift die Prinzi-
wenn Aufgaben individuell anschlussfähig pien des ko-konstruktiven Lernansatzes auf
sind, will und kann das Kind sich in vollem und trägt dazu bei, dass Kinder ein tiefer
Umfang seinen Aufgaben zuwenden (vgl. gehendes Verständnis von Lebenszusam-
Hellfritsch, 2007). menhängen entwickeln, in Verbindung mit
der Orientierung an Werten selbstgesteuer-
Erwachsene bzw. kompetentere Lernpartner tes Denken aufbauen und die erworbenen
werden beim Lernen durch sozialen Aus- Kompetenzen in verantwortungsvolles
tausch als die wichtigsten Mittler bei der Alltagshandeln umsetzen können (Lernme-
Wissenskonstruktion des Kindes gesehen thodische Kompetenz/BayBEP S. 66ff).
11Lernen in Projekten Projekte eignen sich hervorragend dazu, um
umweltpädagogische Entwicklungsprozesse
Eine hervorragende Möglichkeit, in sozialen in Gang zu setzen. Kinder können im Verlauf
Austauschprozessen zu lernen und die ge- der Projekte umweltgerechtes und wert-
nannten Fähigkeiten zu unterstützen, ist das orientiertes Denken und Handeln erkennen,
Lernen in Projekten. Kinder und Erwachsene ausprobieren und in ihren Alltagsbezügen
bestimmen gleichermaßen die Themen und umsetzen. Die Quellen der Bildungsarbeit
den Projektprozess. Am Anfang steht eine sind auch hier Vermutungen, Hypothesen
Idee, ein Impuls, eine Frage, der die Kinder und Fragestellungen. Diese werden im
gemeinsam mit der Erzieherin und ande- sozialen Austausch überdacht und geprüft.
ren Erwachsenen im Verlauf des Projekts Das Verstehen der Zusammenhänge führt
auf den Grund gehen. Dabei sind vielfäl- zu nachhaltigen Lösungen.
tige Herangehensweisen an das gewählte
Thema und die ins Auge gefassten Inhalte
möglich. Es können vielfältige Bezüge zu Auswahl der Projekte
den explizit als zentral bestimmten Bil-
dungsbereichen und den integrierten oder Die nachfolgend ausgeführten Projekt-
impliziten Bildungsbereichen hergestellt beispiele aus verschiedenen Kindertages-
und bildungsbereichsübergreifendes Lernen einrichtungen stellen jeweils eines der
unterstützt werden. ausgewählten Themen in den Mittelpunkt.
Sie wollen aufzeigen, wie Erzieherinnen
Die kooperative Auseinandersetzung mit und Erzieher umweltpädagogische Bil-
Themen und das gemeinsame Finden dungsprozesse vor dem Hintergrund des
von Lösungsansätzen und -strategien ko-konstruktiven Ansatzes begleiten und
verbinden die Stärkung personaler und Kinder zu gemeinsam ausgehandelten und
sozialer Kompetenzen mit der Vertiefung verantworteten Lösungen führen können.
von inhaltlichem Wissen. Lernmethodische Das ist auch der Weg, auf dem sich selbsttä-
Kompetenzen werden durch die regelmä- tiges Denken und wertorientiertes Handeln
ßige Reflexion auf gemeinsame Erlebnisse aufbaut.
und Erkenntnisse, auf Lösungsstrategien
und Lernwege ausgebaut. Unterstützend Jedem der sechs Projekte sind Hintergrund-
dabei wirkt die fortlaufende Dokumentation informationen vorangestellt. Sie führen
der Lernprozesse durch Aufzeichnungen, die Inhalte der jeweiligen Themenbereiche
Fotos, Tagebücher etc. Sie bietet Kindern, umfassend aus und sind als Hilfe und Anre-
Fachkräften und Eltern die Möglichkeit gung für die Entwicklung eigener Projekte
sich an den Prozessverlauf zu erinnern, zu gedacht.
reflektieren, sich mitzuteilen und sich über
Aktivitäten und Erfahrungen auszutauschen.
Kinder blicken mit Stolz auf die Arbeitser-
gebnisse, entwickeln im Austausch neue
Fragestellungen, die zu neuen Aktivitäten
herausfordern.
12Selbstgesteuertes Denken und verantwortungsvolles Handeln
M. Hellfritsch
Lernen in Projekten
Quellen:
t Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen,
Staatsinstitut für Frühpädagogik, München (Hrsg) (2010): Der Bayerische Bildungs-
und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung.
4. Aufl. Berlin: Cornelson Scriptor
t Hellfritsch, M. (2007): Fachkongress „Bildung und Erziehung in Deutschland“. IFP-
Infodienst (1/2), S. 51f)
t Siraj-Blatchford, I. (2007): Effektive Bildungsprozesse: Lehren in der frühen Kindheit.
In: F. Becker-Stoll & M. Textor (Hrsg.): Die Erzieherin-Kind-Beziehung. Berlin, Düssel-
dorf, Mannheim: Cornelson
t Textor, M. R. (2000): Lew Wygotski. In: Fthenakis, W. E., Textor, M. R. (Hrsg) Pädago-
gische Ansätze im Kindergarten S. 71ff). Weinheim, Basel: Beltz
t Vygotsky, Lew (1987): Ausgewählte Schriften. Band 2: Arbeiten zur psychischen
Entwicklung der Persönlichkeit. S. 252ff). Berlin: Volk & Wissen
131 Boden / Erde
1.1 Hintergrundinformationen
Besonderheit und Vielfalt des Der Boden ist eine belebte Materie. In ihm
Bodens leben unzählige Klein- und Kleinstlebewe-
sen wie Maulwürfe, Regenwürmer und
Direkt unter unseren Füßen liegt ein eigener Springschwänze, die durch ihre grabende
Kosmos, in dem es Spannendes und und wühlende Tätigkeit zur Bodenverbesse-
Interessantes zu entdecken gibt. Der Boden rung und zur Bodenfruchtbarkeit beitragen.
und die obersten Erdschichten sind für den Ohne grabbare Böden könnten viele Wild-
Menschen und das Leben auf der Erde als tiere, wie Hase, Fuchs und Dachs, ihre
Teil unseres Ökosystems von zentraler Erdhöhlen nicht bauen.
Bedeutung.
Natürliche und naturnahe Flächen besitzen
Die Böden bilden den Lebensraum für auch eine wichtige Funktion für die Erho-
Menschen, Tiere und Pflanzen gleicherma- lung und den Tourismus. Für den Menschen
ßen. Alle drei Lebensformen sind von dem dienen Böden zusammen mit ihren umge-
verschiedenartigen, durch Poren und Klüfte benden Gesteinsschichten als Lagerstätten
durchsetzten Aufbau der Böden und seiner für Rohstoffe und als Basis für den Straßen-
Fähigkeit, Wasser und Nährstoffe zu spei- und Siedlungsbau. Auch als Archive der
chern und zu transportieren (Nährstoff- Menschheitsgeschichte und der Erd- und
Wasser-Kreislauf), abhängig. Für unser Klimaentwicklung sind Böden wichtige
Grund- und Trinkwasser – dem wichtigsten Informationsquellen.
Lebensmittel – übernehmen die Böden mit
ihrer Fähigkeit, Schadstoffe zu binden, eine
außerordentlich bedeutsame Schutzfunktion. Gefährdung von Böden
Als Standort für Pflanzen sind Böden Er- Die natürlichen Funktionen von Böden
nährungsgrundlage für Mensch und Tier. können durch Einwirkungen von außen
Böden spielen somit eine wesentliche Rolle gefährdet sein. Vor allem Industrie und
für die land- und forstwirtschaftliche Nut- Landwirtschaft können durch Eintrag
zung und prägen das Erscheinungsbild schädlicher Stoffe, wie z. B. Schwermetalle
unserer Kulturlandschaft maßgeblich. oder organische Problemstoffe, den Boden
belasten. Problematisch ist aber auch die
flächendeckende Versiegelung natürlicher
Böden und der damit einhergehende
Flächenverbrauch (z. B. durch Straßen- und
Siedlungsbau). Außerdem gehen jährlich
Tonnen von fruchtbarem Ackerboden durch
Wind- und Starkregenabtrag verloren.
14Boden / Erde
Wie kann der Boden geschützt Ziele nachhaltiger Bildung
werden?
Um Boden nachhaltig zu schützen, ist nicht
Ziel des vorsorgenden Bodenschutzes nur ein sorgsamer Umgang mit der Res-
ist es, Schadstoffe im Boden, Abtragung source „Boden“ notwendig, wir müssen ihn
und Verdichtung zu vermeiden (z. B. durch auch als lebensnotwendige Grundlage
Einbau von Industriefiltern, umweltverträg- begreifen und uns über seine Bedeutung
liche Landwirtschaft), den Flächenverbrauch bewusst werden:
einzudämmen (z. B. durch Flächenrecycling, t als Lebensraum von Bodenlebewesen
d. h. Nutzung industrieller Brachflächen (Regenwurm, Maulwurf)
zur Schonung der „grünen Wiese“) und t als Wasser- und Nährstoffspeicher
verschmutzte oder verseuchte Böden zu t als Pflanzenstandort für Land- und Forst-
sanieren (durch Bodenaustausch, Altlasten- wirtschaft
sanierung). t als Schadstoffpuffer und beim Schadstoff-
abbau
151.2 Projektbeispiel „Wir erkunden den Boden”
In Zusammenarbeit mit dem Städtischen Kinderhaus Felicitas-Füss-Straße 14,
München (Oberbayern)
Entstehung des Projekts – und wie auf dem Feldweg anhört. „Beim
Themenfindung Asphalt klappert es mehr“, stellt ein Kind
fest. Später ergänzt ein anderes: „Und auf
Die Idee zu dem Projekt entwickelte sich in dem Waldboden sinkt der Stock ein!“ Wild
der „Freilandgruppe“ des Kinderhauses. probieren das alle Stockbesitzer aus.
Diese Gruppe besteht seit ca. 14 Jahren zu- „Halt!“, ruft ein Kind, „da können Tiere
sätzlich zu den „Hausgruppen“ und wurde drunter sein!“
mit dem Ziel eingerichtet, Kindern mehr
Freiraum für Bewegung, für Kreativität und Um nachschauen zu können, ritzen einige
soziales Lernen zu bieten. Durch die Öff- Kinder mit ihren Stöcken in den Boden,
nung der Kindergartenräume und des Kin- andere graben mit ihren Händen. Sie
dergartengeländes nach draußen erweitert kommen nicht sehr tief und stoßen nur
die Freilandpädagogik den Erlebnisraum auf eine Schicht mit Laub, Tannennadeln,
der Kinder und ermöglicht natürliche bzw. Holzteilen und Moos. „Das ist die Streu-
naturnahe Erfahrungen. Im Unterschied schicht!“, weiß der 6-jährige Arthur aus
zur Waldpädagogik ist der Aufenthalt nicht einem vorausgegangenen Regenwurm-
auf Waldgebiete eingegrenzt. Aufgesucht projekt. Er erklärt den anderen Kindern
werden ganz bewusst Orte im unmittelba- auch, dass
ren Lebensumfeld der Kinder. In der Aus- t herabgefallene Blätter von Bodenlebe-
einanderssetzung mit vielfältigen Alltagssi- wesen zersetzt werden,
tuationen und Begegnungen erwerben die t die Bodenlebewesen, und besonders
Kinder selbsttätig Kompetenzen, die sie in der Regenwurm, die Erde auflockern,
ihrer Selbständigkeit, geistigen Flexibilität, t der Regenwurmkot wichtig ist für die
Widerstandsfähigkeit und Verantwortungs- Fruchtbarkeit des Bodens,
übernahme stärken. t der Regenwurm Gänge gräbt und da-
durch das Regenwasser besser in die
Kinder graben gerne, möchten schaufeln, Erde dringen kann,
buddeln, matschen, Steine entdecken und t der Regenwurm „Regenwurm” heißt,
Kleintiere anfassen. Vor allem in Großstäd- weil er bei Regen unter der Erde keine
ten sind die Böden auf öffentlichen Plätzen Luft bekommt und auf die Erdoberfläche
und Wegen jedoch weitgehend versiegelt. kriecht.
Kinder finden dort kaum Gelegenheit zum
Graben und sich auf diese Weise die Welt Arthur bietet an, mit interessierten Kindern
unter ihren Füßen zugänglich zu machen. noch einmal den beim Vorgängerprojekt
Die Freilandgruppe hat die Möglichkeit gebauten Regenwurmkasten auszustatten
sowohl asphaltierte Straßen, fest getretene (Glaskasten, Erde, abgefallene Blätter, Wur-
Feldwege, Ackerböden, Wiesen- und Wald- zelreste, Regenwürmer), um das Verhalten
böden bewusst wahrzunehmen. von Regenwürmern genau beobachten zu
können (in den nächsten Tagen führt Arthur
Auf dem Weg in den Wald nehmen einige mit einer Kleingruppe dieses Kleinprojekt
Kinder Stöcke auf und benutzen sie als parallel selbstständig durch).
Wanderstäbe. Sie probieren aus, wie sich
das Stochern mit den Stöcken auf Asphalt
16Boden / Erde
Planung und Vorbereitung Durchführung des Projekts
Die Erzieherin schlägt vor, am nächsten Tag Am nächsten Tag wird ein Grabungsort
im Wald ein „Forschungsloch“ zu graben ausgesucht. Gemeinsam mit der Erziehe-
und dann weiter nach Bodenbewohnern rin stechen die Kinder ein ca. 60 cm tiefes
zu suchen. Spatenrelief aus (d. h., mit einem Spaten
wird 60 cm tief in die Erde gestochen und
Erfahren durch viele vorangegangene ein Stück Boden ausgehoben) und legen es
Forschungsvorhaben stellen die Kinder auf die mitgebrachte Plastikplane. Sie heben
im Kinderhaus selbständig eine Forscher- vorsichtig die obere Bodenschicht an und
kiste zusammen: Spaten für die Erzieherin, entdecken verschiedene Kleinlebewesen.
einen Handspaten aus Metall für jedes Kind, Einige (mutige) Kinder lassen die Tierchen
Eimer, Siebe, Becher, Dosen, Schachteln, über ihre Hände kriechen, andere sortieren
Becherlupen, andere Lupen, eine Plastik- sie schnell in die mitgebrachten Behälter.
plane und ein Bestimmungsbuch. Mit Lupen werden die Kriech- und Krab-
beltiere genau untersucht und unbekann-
Am Projekt können sich alle interessierten te Bodenbewohner mit Hilfe des Buches
Kinder beteiligen. Es werden dafür zwei bestimmt. Die Kinder bitten die Erzieherin in
Monate im Herbst angesetzt. das Forschungsnotizbuch einzutragen:
17„Die Kinder entdeckten im Spatenrelief Kä- „Ganz unten sind lauter kleine Steinchen“,
ferlarven, Ringelwürmer, Steinläufer, Asseln, bemerkt ein Kind.
Nacktschnecken und Regenwürmer.“
Die Kinder wollen eine Fotografie machen
Einem Kind fällt auf: „Der Boden unter dem vom Aufbau des Erdstücks. Da der Foto-
Laub ist ja fast schwarz!“ apparat vergessen wurde, wollen sie den
Erdaufbau in Zeichnungen festhalten (Stifte
„Das ist der Boden, der entstanden ist durch und Papier hat die Freilandgruppe immer
die verfaulten Pflanzen und die ‚Arbeit’ der dabei). An den Zeichnungen lässt sich er-
Bodentierchen“, weiß ein Kind. kennen, dass die Kinder den Aufbau in
Schichten schon erkannt haben. Auf die
„Gibt es weiter unten auch was zu sehen?“, oberste Schicht malen einige Kinder noch
fragt die Erzieherin. frisches Gras und Moos. So wird deutlich,
dass es sich um ein Waldbodenprofil handelt.
Die Kinder stellen fest:
t „Der Boden wird immer heller!“ Nele schlägt vor, je eine Probe der ver-
t „Schau mal, da sind ganz viele Wurzeln!“ schiedenen Schichten abzunehmen, sie
Die Kinder schauen sich die ineinander mit ins Kinderhaus zu nehmen und dort
verschlungenen Wurzeln genau an und nach weiteren Informationen zum Bau des
befühlen sie vorsichtig. Bodens zu suchen. Bevor alle gemeinsam
18Boden / Erde
zurückgehen, werden die Kleintiere in ihren
Lebensraum zurückgebracht und das Loch
wieder zugeschaufelt.
In der Kindertageseinrichtung kleben die
Kinder die Proben der verschiedenen Bo-
denschichten auf Karton und untersuchen
sie noch einmal genau. Sie finden vier
unterschiedliche Schichten:
t die „Streuschicht“ mit Laub, Moos und
Holzteilchen
t die dunkle, humusreiche Schicht
t eine hellere Schicht, in der auch Wurzeln
zu finden sind
t eine noch hellere Schicht mit kleinen
Steinchen
Mit Hilfe der Erzieherin tragen die Kinder
noch einmal Informationen aus den Fachbü-
chern und dem Internet zusammen.
Das, was Arthur und die anderen Experten
schon wussten, wird bestätigt:
t Die Kleinlebewesen im Boden stehen alle
in wechselseitiger Beziehung zueinander.
t Sie beteiligen sich alle an der Zersetzung
von Pflanzen, der Humusbildung, der
Durchmischung und Durchlüftung des
Bodens.
t Die Regenwürmer sind Erdfresser. Sie
scheiden Erde und faulende Pflanzenteil-
chen zur Verbesserung der Erde wieder aus.
t Mit ihrem Gangsystem verbessern sie die
Bodendurchlüftung und bieten den
Pflanzen dadurch gute Bedingungen zum
Durchwurzeln des Bodens.
t Die Bodenschichten bilden sich nach und
nach. Zusammen ergeben sie das Boden-
profil.
t Die Entstehung von neuem Boden dauert
mehrere tausend Jahre.
„Wer ist was?“
Einige Kinder nehmen in den nächsten Ta-
gen regelmäßig ihre Becherlupen mit hinaus
ins Freiland und achten darauf, dass der Fo-
toapparat mitgenommen wird. Sie schauen
bei allen Gelegenheiten nach Krabbel- und
Kriechtieren in der ersten Bodenschicht und
fotografieren sie, nachdem sie sie eingefan-
gen haben. Die Tiere, die sie vor Ort nicht
bestimmen können, nehmen sie mit zum
19Kinderhaus, um das mit Hilfe der dort vor- schiedene Bereiche aus. Genauer unter-
handenen Medien nachzuholen. sucht werden sollen: eine Fichtenmonokul-
Die entwickelten Fotos pinnt die Erzieherin tur, ein Stillwasserbiotop, ein Biotop am
auf die Dokumentationswand. Gemeinsam Kieswerksee, am Hohlweg und eines an der
mit der Erzieherin beschriften die Kinder Eti- Bahnanlage.
ketten mit den dazu gehörenden Bezeichnun-
gen. Diese kleben sie zum passenden Foto. Der Kieswerksee in Trudering wird zum
Forschungslabor. Die Kinder teilen sich in
Spatenreliefs und Biotope kleine Gruppen ein und legen fest, welche
Die Kinder schlagen vor, Spatenreliefs auch Gruppe die Beobachtungsbeschreibung für
von anderen Gebieten zu nehmen. Sie wol- welches Biotop übernimmt. Der Aushand-
len wissen, ob sie überall gleich aussehen. lungsprozess dauert eine Weile, führt aber
Sie laden den Biologen, der schon oft mit letztlich zum Ziel.
ihnen zusammengearbeitet hat, telefonisch
ein und bitten ihn sie auch dieses Mal fach- Jede Gruppe fertigt eine Momentaufnahme
kundig zu begleiten. (Zeichnung) von ihrem Biotop an und führt
ihre Beobachtungen durch. Der Experte
Am nahen Kieswerksee in Trudering setzt unterstützt bei offenen Fragen durch Fach-
sich das Projekt fort. Der Biologe vertieft informationen. Anschließend werden die
über mehrere Tage mit den Kindern das Namen der Pflanzenarten und Kleinlebe-
Bodenthema im Zusammenhang mit wesen zusammengetragen, die in den ver-
Biotopen. Er wählt mit den Kindern ver- schiedenen Biotopen gefunden wurden.
20Boden / Erde
Aus jedem Biotop stechen die Kinder Der Biologe betrachtet mit den Kindern die
gemeinsam mit einem Erwachsenen ein Teilchen im Boden genauer. Die Kinder
Stück Boden aus und stellen es auf eine erkennen einige Unterschiede (z. B. sandi-
Plastikkiste. Der jeweilige Oberflächen- ger, lehmiger, mehr Steinchen). Er erklärt
bewuchs wird auf dem ausgestochenen ihnen:
Spatenprofil belassen. Die Kinder können t Die Mischung im Boden bestimmt die
sehr schön sehen, Bodenart und damit die vorherrschenden
t wie der Bewuchs seine Wurzeln im Boden Bodenverhältnisse.
schlägt, t Der Pflanzenbewuchs gibt einen Hinweis
t dass Lebewesen im Boden leben und auf die vorherrschenden Bodenverhältnis-
t wie das jeweilige Biotop im Querschnitt se, d.h. auf die Bodenart und die Boden-
aufgebaut ist. qualität.
Es lassen sich
t Regenwurmgänge nachverfolgen. Der Experte bespricht mit den Kindern die
t Gerüche von Humus mit Braunerde Besonderheiten der jeweiligen Lebensräu-
vergleichen. me, z. B.:
t die Wurzeln der Pflanzen befühlen. t Glockenblumen und Margeriten wachsen
auf Magerböden.
Die Kinder erkennen gut den Schichtenauf- t In stickstoffreichen Böden machen sich
bau bei allen Bodenstücken und sind stolz, schnellwüchsige Pflanzen wie z. B. Löwen-
dass sie ihr Wissen, das sie mit dem ersten zahn breit.
Aushub im Wald aufgebaut haben (z. B. über t Hier finden Schmetterlinge und Insekten
die Arbeitsleistung des Regenwurms bei der wenig Nahrung, was die Vielfalt ein-
Entstehung des Humus), abrufen können. schränkt.
„Trotzdem sehen die innen drin anders aus“, „Da ist ja sogar Bauschutt drin!“, ruft ein
bemerkt ein Kind. Kind entsetzt.
21Die Kinder wissen, dass Abfall im Boden Ein neues, spannendes Projekt kann sich
weder für die Pflanzen noch für die Tiere gut hier anschließen:
sein kann. t Besuch bei einem Biobauer oder der
Zusammenhang von Bodenqualität, Bewirt-
„Zum Glück ist das kein Acker. Sonst würde schaftungsmethoden und Qualität von
der Dreck ins Korn kommen!“, stellt ein Nahrungsmitteln.
Junge beruhigt fest.
Damit die Kinder eine Vorstellung davon
bekommen, welche gravierenden Folgen Abschluss des Projekts
Umweltverschmutzung auf den Boden hat,
erklärt der Biologe: Zum Abschluss der mehrtägigen Exkur-
t Schwer abbaubarer Abfall z. B. schadet sion erstellen die Erzieherinnen mit dem
dem Boden nachhaltig. Es dauert Jahre, Experten noch am Kieswerksee eine große
bis er sich wieder erholt. Pinnwand. Alle Biotope und die wichtigen
t In unserem Klima dauert es 100 bis 300 Hintergrundinformationen sind hier festge-
Jahre, bis eine Humusschicht von 1 cm halten (Fotos, Zeichnungen, Beschriftungen,
Dicke entsteht. Texte etc.). Die Pinnwand und die Profile
t Die fruchtbare Schicht eines Ackerbodens werden in das Kinderhaus transportiert.
sollte 30 – 40 cm dick sein. Die den Aufzeichnungen beigestellten Pro-
file und Arbeitsgeräte machen das Thema
auch für Noch-nicht-Experten greifbar. Die
anschauliche Dokumentation zeigt die For-
schungsleistung der Kinder und den Weg zu
ihren Erkenntnissen. Die Kinder besprechen
ihre Ergebnisse mit Kindern aus anderen
Gruppen und präsentieren sie selbstbe-
wusst auch ihren Eltern.
Einordnung in einen größeren
Zusammenhang
Das Thema Boden / Erde steht in dem grö-
ßeren Zusammenhang von „Wachstum und
Vergänglichkeit“ sowie „Nährstoffkreislauf“.
Für die Kinder werden Zusammenhänge
des Lebens erfahrbar. Sie verstehen, dass
der Boden/die Erde neben Wasser und Luft
zu den Lebensgrundlagen von Menschen,
Tieren und Pflanzen gehören. Anhand der
Nahrungskette wird den Kindern einsichtig,
dass der Mensch eine seiner Lebensgrund-
lagen selbst zerstört, wenn er dem Boden
Schaden zufügt, ihn umweltschädlich be-
wirtschaftet oder gar verseucht. Die Projekt-
ergebnisse können Ausgang sein für weiter-
gehende Fragestellungen im Rahmen des
Bodenschutzes. Themen wie umweltverträg-
liche Landwirtschaft, biologischer Landbau,
bewusste Abfallwirtschaft und bewusstes
Konsumverhalten sind anschlussfähig.
22Boden / Erde
Talia, 5 Jahre Talia, 5 Jahre
Dokumentation und Reflexion Zentrale Bildungsbereiche
Die Dokumentation ist im Verlauf des Umwelt
Projekts gewachsen. Die Informationen, Die Kinder verstehen, dass das Leben auf
Werkstücke und Sammlungen werden im und in der Erde voneinander abhängt und
Kinderhaus auf für alle zugängliche Pinn- der Mensch dafür verantwortlich ist, dass
wände und in Themenecken präsentiert. das Ineinandergreifen der Prozesse nicht
Die Kinder können hier auf ihre Lernpro- gestört oder gar zerstört wird. Den Kin-
zesse zurückgreifen und den Projektverlauf dern wird bewusst, dass auch sie selbst
nachvollziehen. Für jedes Kind wird eine zum Schutz des Bodens beitragen kön-
Lernfortschrittsmappe geführt. Hier werden nen, indem sie z. B. Abfall vermeiden oder
Text-, Bild- und zum Teil auch Videoszenen entsorgen. Der Boden/die Erde wird als ein
mit aufgenommen. Sie ist für jedes Kind schützenswertes Ökosystem begreifbar.
frei zugänglich, so dass es jederzeit auf Auch der Problembereich „flächendeckende
seine Lernprozesse und Erfolge reflektieren Versiegelung natürlicher Böden“ steht dazu
kann. Eingesetzt wird die Mappe auch als anschaulich in Bezug.
Grundlage für Entwicklungsgespräche der
Erzieherinnen mit den Eltern.
Naturwissenschaften und Technik
In der Hausbibliothek werden die Bilder- Durch die Erkundung des Spatenreliefs
und Sachbücher regelmäßig themenspezi- lernen die Kinder den Schichtaufbau des
fisch angepasst. Sie sind dort weit über die Bodens kennen. Sie erkennen, dass Erde
Laufzeit der Projekte ausleihbar. Die Kinder und Boden Lebensraum für eine VielzahI
finden dort sowohl die Bücher, die in das von Lebewesen ist und dass diese wichtige
Projekt einbezogen waren, als auch weiter- Funktionen bei der Entstehung von (Mutter-)
führende Literatur. Je nach Interesse und Boden haben. Sie lernen unterschiedliche
Motivation können die Kinder die Themen- Bodenarten kennen (z. B. Sand, Lehm, Ton).
bereiche noch vertiefen. Über die Erkundungen im Zusammenhang
23mit Biotopen verstehen die Kinder, dass Erde“) als Basis unseres Lebens zu schät-
Pflanzen einen Hinweis geben können auf zen. Sie staunen über die Schöpfung mit
die vorherrschenden Bodenverhältnisse, ihren intelligent aufeinander abgestimmten
d.h. auf die Bodenart und -qualität. Prozessen. Sie fühlen sich als wichtiger Teil
dem Ganzen zugehörig und werden sich
Gemeinsam mit den Erzieherinnen und ihrer Verantwortung für die Gesunderhal-
Experten suchen sie Antworten auf ihre tung der Natur bewusst.
Fragen. Sie eignen sich aktiv forschend
Wissen an und überprüfen ihre Thesen mit Emotionalität, soziale Beziehungen und
„wissenschaftlichen“ Forschungsmethoden Konflikte
(z. B. Bodenproben entnehmen, untersu- Die Betonung der Selbsttätigkeit bei der
chen, Beobachtungen durchführen, sam- Projektentwicklung (und im Konzept der
meln, sortieren, analysieren, klassifizieren). Freilandpädagogik überhaupt) stärkt die
Selbstregulationsfähigkeit der Kinder.
Eigenverantwortung und lebenspraktische
Integrierte Bildungsbereiche Kompetenzen können täglich eingeübt
werden. Die Kinder werden sehr ernst ge-
Werteorientierung und Religiosität nommen mit ihren Fähigkeiten. In diesem
Die Kinder lernen den Boden (die „Mutter Projekt konnten z.B. dem schon sehr kom-
24Boden / Erde
petenten Arthur besondere Aufgaben bei
der Beratung einer Kleingruppe übertragen
werden.
Sprache und Literacy
Das Projekt ist auf sprachlichen Austausch
angelegt. Die Kinder besprechen Vermutun-
gen und tauschen sich über Erfahrungen
und Erkenntnisse aus. Auf diesem Weg
werden Kommunikations- und Interaktions-
kompetenzen gestärkt. Ihr Wortschatz wird
erweitert durch das Kennenlernen und
Verstehen neuer Begriffe (z. B. Bodenprofil);
auch die Recherche in Literatur und Bild
trägt dazu bei.
Gesundheit und Bewegung
Schon durch das Konzept der Freilandpäda-
gogik (siehe Entstehung des Projekts) sind
täglich vielfältige Bewegungsmöglichkeiten
garantiert. Das freie Gelände ist Trainings-
feld für die Wahrnehmung der Möglichkei-
ten und Fähigkeiten des eigenen Körpers.
Die Kinder sind bei jedem Wetter draußen.
Ausgestattet mit angepasster Kleidung sind
sie unterschiedlichen Witterungsverhält-
nissen ausgesetzt, was ihre Abwehrkräfte
stärkt.
Quellen
t Prokop, E.; Österreicher, H. (2006): Kinder wollen draußen sein. Natur entdecken,
erforschen und erleben. Seelze: Kallmeyer
t Österreicher, H. (2009): Expedition Leben: Biotope, Pflanzen, Tiere. Hintergrundwis-
sen, Lernziele, Experimente und Versuche zur naturwissenschaftlichen Bildung im
Kindergarten. Troisdorf: Bildungsverlag EINS.
t Reidelhuber, A. (2000): Umweltbildung. Staatsinstitut für Frühpädagogik (Hrsg.).
Freiburg im Breisgau: Lambertus
t Österreicher, H.: www.Kinderfreiland.de
t Staatsinstitut für Frühpädagogik: Programm Konsultationseinrichtungen
http://www.ifp.bayern.de/projekte/laufende/konsultation.html
252 Wasser
2.1 Hintergrundinformationen
Bedeutung des Wassers Wasser als Naturgefahr
Wasser ist als essentieller Bestandteil des Wasser kann aber auch in unterschiedlicher
Naturhaushalts die Grundlage allen Lebens. Form zur Bedrohung für den Menschen
Für den Menschen ist Wasser insbesondere werden. Hochwasserereignisse an Wild-
für Trink- und Gebrauchszwecke unentbehr- bächen und entlang von Flüssen sind in
lich. Gleichzeitig ist Wasser lebensnotwen- diesem Zusammenhang genauso zu
dig für Tier und Pflanze und bietet einigen nennen wie alpine Naturgefahren durch
davon den spezifischen Lebensraum. Lawinen, Rutschungen und Murenabgänge.
Bayern ist mit seinen rund 100.000 Kilo- Aufgabe der Wasserwirtschaft ist es daher
metern an Flüssen und Bächen und etwa auch, durch ein breites Netz aus Informa-
50 größeren und einer Vielzahl kleinerer tions- und Warndiensten (Hochwassernach-
natürlicher Seen eine der wasserreichsten richtendienst, Lawinenwarndienst, Grund-
Regionen der Erde. Durch günstige natürli- wasserstände, überschwemmungsgefährdete
che Voraussetzungen und wirksame Schutz- Gebiete), aber auch durch gezielte Baumaß-
maßnahmen zeichnen sich die bayerischen nahmen (z. B. Hochwasserschutzdeiche oder
Gewässer durch eine insgesamt hervorra- -mauern, Rückhaltebecken) sowie durch
gende Wasserqualität aus. Fast das gesamte Renaturierungsmaßnahmen (z. B. Wieder-
Trinkwasser – ungefähr 92 Prozent – kann herstellung natürlicher Überschwemmungs-
aus gut geschütztem Grundwasser oder bereiche durch Deichrückverlegungen) die
aus Quellen – meistens ohne Aufbereitung – Risiken von wasserbedingten Naturkatastro-
gewonnen werden. Diesen Naturreichtum phen auf ein Minimum zu beschränken.
gilt es zu erhalten und für kommende Ge-
nerationen zu bewahren.
Wie kann hohe Wasserqualität
Wasser ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, erhalten werden?
sowohl bei der Erzeugung von Industriegü-
tern als auch für die Binnenschifffahrt oder Damit die hohe Wasserqualität erhalten
bei der Nutzung der Wasserkraft zur Ener- bleibt und Schadstoffbelastungen des
giegewinnung. Daneben ist Wasser auch Grundwassers (z. B. Nitrat) bzw. Einträge
für die Erholung und den Tourismus von von Schadstoffen aller Art in das Oberflä-
Bedeutung. chenwasser vermieden werden, sind
umfangreiche Schutzmaßnahmen erfor-
derlich. Dazu gehört die Ausweisung von
Wasserschutzgebieten zum Schutz des
Trinkwassers ebenso wie der weitere
Ausbau der kommunalen und industriell-
gewerblichen Abwasserentsorgung durch
entsprechende Abwasseranlagen (Kanäle
und Kläranlagen). Auch viele kleine private
Hauskläranlagen müssen noch verbessert
sowie diffuse Einträge von Nährstoffen, z. B.
aus der Landwirtschaft, verringert werden.
26Sie können auch lesen