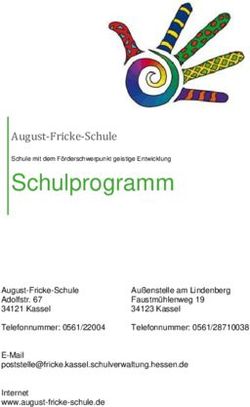Wie digitale Medien Bildung verändern Herausforderungen, Chancen und Projektideen - Zentrum ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
2 | Wie digitale Medien Bildung verändern Editorial
„Unsere Gesellschaft braucht mehr Medienkompetenz,
die wir uns gemeinsam erarbeiten müssen, medien-
pädagogische Schulung braucht deshalb mehr Raum ...“
Kirchenpräsident Dr. Volker Jung auf der Frühjahrstagung der Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und
Nassau im April 2015
Liebe Leserinnen und Leser,
digitale Medien bestimmen schon in weiten Teilen medien“ behandelt, die sicherlich zukünftig eine
unser tägliches Leben. Auch unser berufliches Han- größere Rolle im Bereich der Bildungsarbeit spielen
deln in den Arbeitsfeldern Bildung, Erziehung und werden.
sozialer Arbeit wird immer mehr von einer digitalen
Entwicklung geprägt. Für Menschen und Einrichtun- Wie ich meine Daten und digitalen Spuren im Netz
gen sind dadurch größere Veränderungsprozesse in schützen kann sind wichtige Aspekte des Daten-
Gang gesetzt worden, die längst noch nicht abge- schutzes und werden praxisnah beschrieben.
schlossen sind.
Der Artikel von Dr. Jochen Robes ist als eine Art Zu-
Durch dieses Themenheft sollen die Ambivalenzen sammenfassung der wichtigsten Entwicklungen
der digitalen Medienkultur aufgezeigt werden. anzusehen, die in den vorherigen Artikeln bereits
■ Welche Bedeutung haben Medien für den erwähnt wurden.
Menschen und für das Lernen?
■ Welche Kompetenzen/Haltung brauchen wir, Am Ende des Theorieteils wird noch ein Blick auf die
wenn wir die Möglichkeiten der digitalen Teilnehmenden-Perspektive geworfen, besonders
Medien für die Bildung nutzen wollen? auf die Hürden und motivationsfördernden Aspekte
des digitalen Lernens.
Entstanden ist das Heft aus einer Kooperation zwi-
schen dem Fachbereich Erwachsenenbildung und Im Praxisteil werden Projekte vorgestellt, die in den
Familienbildung im Zentrum Bildung und dem Zen- Bereichen Kindertagesstätten, Jugendarbeit, Er-
trum Gesellschaftliche Verantwortung der Evangeli- wachsenenbildung und Altenarbeit umgesetzt wur-
schen Kirche in Hessen und Nassau. den. Diese Beispiele sollen Anregungen für eigene
Ideen und eine Orientierung geben.
Wir haben das Heft in zwei Kapitel gegliedert. In
ENTWICKLUNGEN und AUS DER PRAXIS. Im voran- Wir hoffen, Sie können den einen oder anderen As-
stehenden Theorieteil geht es um medienkulturelle pekt aus einem der Beiträge dieses Heftes gewinn-
Entwicklungen in der Erwachsenenbildung und der bringend für Ihre Arbeit um- bzw. einsetzen.
sozialen Arbeit. Zudem werden Open Educational
Resources (OER) –Lizenzen, also die„freien Bildungs- Eine anregende Lesezeit wünschen Ihnen
Gunter Böhmer Lisa Zierock Michael Grunewald
Zentrum Bildung der EKHN, Zentrum Bildung der EKHN, Zentrum Gesellschaftliche
Fachbereich Erwachsenenbildung Fachbereich Erwachsenenbildung Verantwortung der EKHN
und Familienbildung und FamilienbildungInhalt Wie digitale Medien Bildung verändern | 3
Wie digitale Medien Bildung verändern
Herausforderungen, Chancen und Projektideen
Digitalisierung der Bildungslandschaft – Eine Skizzierung Seite 4
Christian Leineweber
Die Digitalisierung macht aus Kultur Software 8
Dirk von Gehlen
Lernkulturwandel in der Erwachsenenbildung – 10
Entwicklungen
Vom Wissensvermittler zum Lernraumgestalter und Online-Tutor
Lisa Zierock
Digitale Bildung – Anfragen an die Erwachsenenbildung 13
Anika Klein, Bernhardt Schmidt-Hertha
Einsatz digitaler Medien in der Erwachsenenbildung: 15
Anforderungen für Lehrende und Einrichtungen der Weiterbildung
Claudia Bremer
Potenziale und Herausforderungen digitaler Technologien 20
in den verschiedenen Bereichen der Sozialen Arbeit
Christian Helbig
Freie Bildungsmedien: Open Educational Resources (OER) 24
Jörg Lohrer
Jung sein, Daten schützen 26
Peter Knaak
Chancen und Potenziale neuer Medien in der Erwachsenenbildung 30
Dr. Jochen Robes
Einblicke in das Online-Lernen aus Teilnehmerperspektive 35
Horst Roos, Matthias Roth
a u s d e r P r a x is
Auf der Jagd nach den Stromfressern 37
Cordula Kahl
App-Musik – Gottesdienstbegleitung mit iPads 39
Tobias Albers-Heinemann
Play Your Story – ein Machinima-Seminar 41
Frank Daxer
Erstellung eines Online-Magazins mit dem Titel „Medienkult“ 44
Lisa Zierock
elische
Schreibprojekt – Offline und Online Hinweise für eine evang 46
e eth ische
Elke Heldmann-Kiesel Medienbildung – ein
„mit Tablet dabei“ – ein digitales Praxisprojekt Orientierung: 49
des
des Evangelischen Bildungswerks München e. V. (ebw) Aus: Kommunikation
ita-
Annette Hüsken-Brüggemann Evangeliums in der dig
uch zur
len Gesellschaft, Leseb
de 2014
Tagung der EKD-Syno
Dresden
, 51
Seite 9, 19, 36, 43, 48
ner
Prof. Dr. Manfred L. Pir4 |
Entwicklungen Digitalisierung der Bildungslandschaft – Eine Skizzierung
Digitalisierung der Bildungslandschaft –
Eine Skizzierung
Die Digitalisierung durchdringt unseren Alltag: So leben wir in einer digitalisierten Gesellschaft 1,
wodurch sich unsere Zugänge zu Daten und Informationen massiv verändert haben. Dies hat konse-
quenterweise auch erhebliche Auswirkungen darauf, wie wir lernen. Der vorliegende Beitrag gibt ei-
nen Kurzüberblick über diese Entwicklungen. Dabei wird zunächst geklärt, was eigentlich darunter
verstanden werden kann, wenn wir von einer „digitalisierten Gesellschaft“ sprechen. Im Anschluss
daran wird aufgezeigt, welchen Einfluss digitale Strukturen auf Möglichkeiten zum Lehren und Ler-
nen haben. Im letzten Teil erfolgt der pointierte Blick auf einige ausgewählte Trends.
1. Leben in einer digitalisierten Gesellschaft Entwicklungen immer weiter vorangetrieben: In
diesem Kontext hat sich beispielsweise das Inter-
Kurz zusammengefasst ist unter der Bezeichnung net im Laufe der Zeit zu einer medienkonvergenten
„digitalisierte Gesellschaft“ die Veränderung gesell- Plattform entwickelt, die sowohl traditionelle (TV,
schaftlicher Strukturen und sozialer Interaktions- Radio, Zeitung) als auch neuartige Inhalte (soziale
muster aufgrund innovativer Technologien zu ver- Netzwerke, Mediatheken, Online-Magazine) verfüg-
stehen (vgl. Xaidialoge/Europa-Universität Viadrina bar macht (vgl. ebd). Zudem bedarf es zur Erstellung
2012, S. 15). Das Fundament von Digitalisierung ist medialer Inhalte aufgrund vielfältiger Programme –
die Computertechnologie. Diese ermöglicht grund- wie z. B. spezieller Applikationen aus dem Web 2.0
Christian Leineweber sätzlich die Umwandlung analoger Daten in digitale und SocialMedia (Wikis, Blogs, Profile in sozialen
wissenschaftlicher Mitarbeiter Daten. Theoretisch lässt sich dadurch jegliches Netzwerken etc.) – längst keiner expliziten Exper-
und Doktorand am Lehrgebiet tenkenntnisse mehr. Und auch die Suche sowie die
menschliche Wissen in Bits und Bytes darstellen (vgl.
„Bildungstheorie und
Medienpädagogik“ an der Tapscott 1997, S. 69). Auf diese Weise können unter- Bereitstellung von Daten sind durch innovative, mo-
FernUniversität in Hagen schiedlichste Medienformate (z. B. Texte, Audioauf- bile Endgeräte,wie Smartphones oder Tablet PCs,
Kontakt: nahmen, fotografierte Bilder) für eine elektronische noch einmal deutlich flexibler geworden.
Christian.Leineweber@
FernUni-Hagen.de Datenverarbeitung bereitgestellt werden (vgl. Xaidi-
aloge/Europa-Universität Viadrina 2012, S. 15). All diese Entwicklungen haben einen unmittelbaren
Einfluss auf unseren Alltag und damit auch auf unsere
Die eigentliche Ingangsetzung zu einer digitalisier alltäglichen Handlungen: Die Digitalisierung bietet
ten Gesellschaft bzw. zu digitalisierten Gesellschafts schnelle und direkte Wege zur Kommunikation,
strukturen ist jedoch im Wesentlichen auf die zu- zum Teilen, zur Informationssuche oder zur Zusam-
nehmende Beliebtheit des Internets in den beiden menarbeit auf der Grundlage digitaler Daten. Sie
vergangenen Jahrzehnten zurückzuführen. Mit ei- ist aufgrund dieser vielseitigen Potenziale auch für
ner steigenden Verbreitung von Online-Zugängen die Entwicklung und Weiterentwicklung von Arbeit,
bis hin zu schnellen Breitband-Verbindungen offen Wirtschaft, Gesellschaft, Demokratie oder Bildung
bartesich für immer mehr Menschen die Möglich- interessant (vgl. Arnold et al. 2015, S. 15). 2 In Anbe-
keit, digitale Daten von einem Personal Computer tracht des thematischen Schwerpunktes dieses Bei-
mit Internetzugang abzurufen, zu bearbeiten und/ trags wird es im Folgenden um die Auswirkungen
oder an andere Menschen weiterzugeben. Die von Digitalisierung auf die Gestaltung von Bildungs-
Mengedigitaler Daten und die Anzahl der Men- prozessen gehen.
schen, die zu diesen einen potenziellen Zugang ha-
ben, wurde und wird immer größer.
Zugleich wird die Menge und Vielfalt entsprechen-
der Daten durch verschiedene technische (Weiter-)Digitalisierung der Bildungslandschaft – Eine Skizzierung | 5
2. Skizzierung der Auswirkungen der Digitali- konnten, um sein Wissen aktiv (auch mit anderen
sierung auf die Bildungslandschaft Lernenden) zu erarbeiten. Bei der Gestaltung etwa-
iger Lernumgebungen spielte das Internet bereits
Dass die genannten Punkte seit geraumer Zeit eine Rolle. Ab den 2000er Jahren kamen zuneh-
auch einen Einfluss auf den Bildungssektor haben, mend „Blended-Learning“-Szenarien in den Trend,
lässt sich augenscheinlich anhand des Wandels von „die verschiedene Lehr- und Lernformen sowie
schulischen Kompetenzen beobachten: Beispiels- Präsenz- und Onlinelernsituationen miteinander
weise betrachtete man früher noch das Erlernen verbinden“ (ebd., S. 23). Ebenso wurden spezifische
einer sauberen und gut leserlichen Handschrift als Lernplattformen immer beliebter, über die Anbieter
grundsätzlichen Bestandteil von Bildung. Für unse- von Bildungsangeboten ihre Inhalte für Interessierte
ren Alltag nimmt dies jedoch einen immer geringe- zur Verfügung stellen können.
ren Stellenwert ein, da generell immer weniger per
Hand geschrieben wird. Auch das Auswendiglernen Als zweites großes Phänomen im Rahmen beo
von spezifischen Fakten (z. B. Geschichtsdaten) er- bachtbarer Veränderungen bei der Gestaltung von
scheint immer obsoleter, denn wir können diese in- Lehr- und Lernprozessen ist der Begriff„Mobile Lear-
nerhalb kürzester Zeit immer wieder nachschlagen ning“ (Mobiles Lernen) zu nennen. Durch mobile,
bzw. aufsuchen (vgl. Beckedahl/Lüke 2012, S. 75). internetfähige Endgeräte hat der Lerner die Mög-
Übergeordnet zu diesen beispielhaften Punkten lichkeit, flexibel auf digitale Daten zuzugreifen.Dies
scheint selbst das Lernen per se nicht mehr explizit schafft die Grundlage für neue Formen der Kommu-
an Bildungsinstitutionen gekoppelt zu sein, denn nikation, Interaktion und des gemeinschaftlichen
durch die Vielfalt digitaler Daten und die Unmittel- Zusammenarbeitens. Mit dem mobilen Lernen
barkeit, diese zu rezipieren, wird eine individuelle gehen – in Ergänzung zum E-Learning – vor allem
und selbstgesteuerte Informationsaufnahme jedes drei weitere, wesentliche Potenziale einher (vgl. de
Einzelnen im privaten Alltag möglich. Witt 2013, S. 13ff ): Erstens ist nicht nur der Mensch
mobil – er kann nun auch mobil auf digitale Daten
Auch bei der spezifischen Aufbereitung und der zugreifen. Dies erhöht zweitens die Motivation zum
Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen sind viel- Lernen, weil man nun in der Lage ist, bei explizitem
fältige Veränderungen denk- und beobachtbar. Als Bedarf auf benötigte Daten zurückzugreifen, um
basales Phänomen ist hier der Begriff „E-Learning“ Hilfe zu erhalten. Lernprozesse bekommen dadurch
(elektronisches Lernen) zu nennen. Dieser Terminus drittens eine neue Qualität, denn der Lerner kann
hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten als in den (Lebens-) Kontexten unterstützt werden,
übergeordneter Begriff für das Lernen mit elektroni- in denen er sich gerade befindet. Mobiles Lernen
schen und digitalen Geräten etabliert (vgl. Arnold et ist damit nicht nur als flexiblere Erweiterung von
al. 2015, S. 22). Aus bildungswissenschaftlicher Per- E-Learning zu verstehen, vielmehr ermöglicht es
spektive gehen mit E-Learning sowohl didaktische neue Qualitäten des Lernens.
als auch methodische Veränderungen einher, wie
der folgende geschichtliche Abriss kurz andeutet Angesichts dieser neuen Potenziale offenbaren
(vgl. Süss 2010, S. 22f.): So waren klassische, elektro- sich große Auswirkungen von technischen Neuerun-
nische Lernprogramme in den 1960er Jahren noch gen und Entwicklungen auf Lehr- und Lernformen. So
recht starr gestaltet. Als Beispiel können an dieser brachte eine Umfrage (wbmonitor) des Bundesin
Stelle Vokabeltrainer-Programme genannt werden, stituts für Berufsbildung (BIBB) und des Deutschen
die zu einem beliebigen Wort in der Regel nur eine Instituts für Erwachsenenbildung zur Charakterisie-
Übersetzung als richtig anerkennen. In den 1980er rung (DIE) über die Angebote ausgewählter Lern
Jahren waren Lernprogramme dann bereits in der angebotsanbieter aus dem Jahr 2013 unter ande-
Lage, nicht nur über richtig oder falsch zu urteilen, rem folgendes Ergebnis hervor: „Hoch sind die Zu-
sie konnten vielmehr auch darüber informieren, wie- wächse in der Nutzung digitaler Medien im Kontext
so die Antwort richtig oder falsch ist. In den 1990er von Lehren und Lernen, die von den Weiterbildungs-
Jahren traten dann vermehrt Lernumgebungen anbietern berichtet werden. Dies gilt insbesondere
auf, die vom Lernenden selbst mitgestaltet werden bei der Anwendung von Mobile Learning (z. B. Apps)6 | Digitalisierung der Bildungslandschaft – Eine Skizzierung
und Web 2.0/Social Media [...]. Insgesamt nutzten (1) Vielfalt informeller Angebote
59 % der Anbieter Lernformen mit digitalen Medien; Die Möglichkeit, auf informelle Lernangebote
(Fach-)Hochschulen bzw. Akademien sind hier be- zurückzugreifen, ist aktuell immens. Ein gutes
sonders aktiv (80 %).“ (Koscheck, Weiland 2013, S. 7f.). Beispiel sind hier Lernvideos. Beeindruckend ist
dabei die Professionalität zahlreicher Formate.
Abschließend muss an dieser Stelle angemerkt Hervorzuheben sind an dieser Stelle sicherlich
werden, dass sich Digitalisierung aber nicht nur MOOCs (Massive Open Online Courses [engl.]
ausschließlich auf die Praxis des Lehrens und Ler- = Große, offene Online-Kurse): Unter diesem
nens auswirkt; vielmehr treten damit mindestens Begriff sind oftmals kostenlose, themenspezifi-
drei weitere Ausprägungen auf (vgl. Kerres, 2016, S. sche Online-Kurse zu fassen, die teilweise von
4ff ): Erstens verändern sich Ansprüche ans Lernen. renommierten Wissenschaftlern aufgezeichnet
Mit der Möglichkeit zum digitalen Lernen und da- wurden.
mit verknüpften Vorteilen tritt auch die Forderung
danach auf. Zweitens hat Digitalisierung zwangs- (2) Vermischung von virtuellen und realen
läufig auch einen Einfluss auf lernorganisatorische Lerninhalten
Strukturen. So ist es mit der bloßen Bereitstellung Durch den ersten Punkt ist es für Lehrende mög-
digitaler Lernformate noch nicht gänzlich getan – lich, ihr Wissen in einer Kombination zwischen
komplexe Lernarchitekturen müssen den Blick aus- Präsenz-Lehre und Online-Lehre zu vermitteln
weiten, z. B. in Richtung „Diagnostik-, Prüfungs- und (dies wurde oben bereits mit dem Stichwort
Portfoliosoftware“ oder „Personal- und Talentma- „Blended Learning“ aufgeworfen). Das beson
nagement.“ (ebd.) Drittens hat dies einen Einfluss deredieser Kombination ist, dass es möglich
auf alle bisher üblichen Lernformate, die mit den wird, die Vorteile der jeweiligen Methoden zu
neuen Gegebenheiten zwangsläufig konfrontiert nutzen und deren Nachteile zu vermeiden: Bei
sind (vgl. ebd.). Diese Ausprägungen können durch- der digitalen Vermittlung (Videos, Folien, Pod-
aus weitere, zukünftige Veränderungen für die Bil- casts etc.) bleiben die Lernenden flexibel; in den
dungslandschaft mit sich führen; welche Formen Präsenzveranstaltungen kann dann der Aus-
des Lehrens und Lernens aktuell durch digitale tausch mit anderen Lernenden und dem Leh-
Strukturen evoziert werden wird im Folgenden er- renden im Vordergrund stehen (vgl. e-teaching.
läutert. org, 2015).
3. Digitale Lern-Trends (3) Individuelle Lernumgebungen
Unter diesem Schlagwort können Plattformen
Es wurde bereits aufgezeigt, dass digitale Medien im Netz zusammengefasst werden, die dem
eine Vielzahl von Optionen bei der Gestaltung von Lerner erlauben, Lerninhalte individuell zu ver-
Lehr- und Lernprozessen und damit auch von Bil- walten und sich eine Art virtuellen Schreibtisch
dungsprozessen bieten. Im Folgenden wird dies an persönlich einzurichten. Als exzellentes Beispiel
sechs beobachtbaren Trends noch einmal konkret dient hier die Plattform„KhanAcademy“ (https://
verdeutlicht. Dabei gilt es zu beachten, dass die www.khanacademy.org/).
durch Digitalisierung neu geformte Bildungsland-
schaft recht vielseitig und großflächig ist. Demnach (4) Erweiterte Realitäten
kann die Auflistung nicht den Anspruch auf Vollstän- Digitale Medien ermöglichen es, reale Situatio-
digkeit erheben. Und auch die genannten Beispiele nen mit digitalen Daten anzureichern. Ein sim-
zeichnen sich nicht immer explizit nur durch ein ples Beispiel wäre, dass wir die Geschichte des
Prinzip aus; vielmehr wurden sie dann einem Prin- Eiffelturms just in dem Moment online nach
zip zugeordnet, wenn sie diesbezüglich besonders lesen könnten, wenn wir vor diesem stehen. Für
prägend sind. All dies verdeutlicht final eigentlich Smartphones und Tablet PCs gibt es bereits viele
nur umso mehr die besondere Komplexität, die mit Apps, die zusätzliche Informationen von be-
der Digitalisierung im hier aufgeworfenen Themen- kannten Bauwerken anzeigen, wenn man diese
spektrum einhergeht. entsprechend abfotografiert.Digitalisierung der Bildungslandschaft – Eine Skizzierung | 7
(5) Vernetztes Lernen und gemeinsames 1
An dieser Stelle bleibt anzumerken, dass diese Bezeichnung
nicht auf die gesamte Welt, sondern nur auf Gesellschaftsfor-
Zusammenarbeiten men der modernen, westlichen Welt zutreffen kann.
Mit vielen digitalen Anwendungen gehen auch Eine mögliche Einschätzung über etwaige Auswirkungen der
2
vernetzte Lernprozesse oder Formen des ge- Digitalisierung auf unterschiedliche Arbeitsbereiche lässt sich
beispielsweise unter folgendem Link (http://www.ecommerce-
meinschaftlichen Zusammenarbeitens einher. leitfaden.de/download/studien/Digitalisierung2014.pdf,
Als prägendes Beispiel dafür ist hier die Platt- S. 12)vorfinden. Es handelt sich dabei um die Ergebnisse einer
Online-Befragung von Online-Experten, durchgeführt von der
form „Wikipedia“ zu nennen. Das Grundprinzip Universität Regensburg für das Jahr 2014. Die Ergebnisse las-
geht auf die Anwendung „Wiki“ zurück, einer sen durchaus einige Trends erkennen, auch wenn sie stark auf
die Arbeitswelt bezogen sind.
textorientieren Anwendung, die es Individuen
erlaubt, gemeinsame Dokumente im Netz an-
Literatur:
zulegen, zu editieren und miteinander zu ver-
knüpfen (vgl. Ebersbach et al., 2008, S. 35ff ). Arnold, Patricia/Kilian, Lars/Thilosen, Anne/Zimmer, Gerhard
(2015): Handbuch E-Learning. Lehren und Lernen mit digitalen
Medien. 4. Aufl. Bielefeld: wbv.
(6) Spielerisches Lernen Beckedahl, Markus/Lüke, Falk (2012): Die digitale Gesellschaft:
Auch ist es mittlerweile nicht mehr ungewöhn- Netzpolitik, Bürgerrecht und die Machtfrage. München: DTV.
lich, mit Hilfe programmierter Spiele zu lernen. Ebersbach, Anja/Glaser, Markus/Heigl, Richard (2008): Social Web.
Konstanz: UKV.
Derartige Formate werden bereits häufig in der
e-teaching.org (2015): Blended Learning. [Online, zuletzt abgeru-
beruflichen Bildung eingesetzt. In Simulationen fen am 22.01.2016]
können die Spieler Situationen aus dem Arbeits Kerres, Michael (2016): E-Learning vs. Digitalisierung der Bildung:
Neues Label oder neues Paradigma. [Online, zuletzt abgerufen am
alltag – virtuell inszeniert – erproben.
22.01.2016]
Süss, Daniel/Lampert, Claudia/Wijnen, Christine W. (2010): Me-
Wenn man abschließend versucht, die genannten dienpädagogik – Ein Studienbuch zur Einführung. Wiesbaden:
Springer.
Punkte noch einmal übergreifend zusammenzu-
Koscheck, Stefan/Weiland, Markus (2013): Ergebnisse der wbmoni-
fassen, dann könnte man sagen, dass Lehren und tor Umfrage 2013 „Lerndienstleistungen und neue Angebotsfor-
Lernen mit digitalen Medien eine Loslösung von (1) men“. [Online, zuletzt abgerufen am 22.01.2016]
inhaltlichen, (2) räumlichen, (3) zeitlichen, (4) me- Tapscott, Don (1996): Die digitale Revolution. Verheißungen einer
vernetzten Welt – Die Folgen für Wirtschaft, Management und
thodischen und (5) institutionellen Strukturen nach Gesellschaft. Wiesbaden: Gabler.
sich zieht (vgl. de Witt/Czerwionka 2013, S. 17ff ). Mo- Universität Regensburg GmbH/Internet World (2014): Digitalisie-
derne Menschen in einer digitalisierten Gesellschaft rung der Gesellschaft 2014. Aktuelle Einschätzungen und Trends.
[Online, zuletzt abgerufen am 22.01.2016]
verfügen über die Möglichkeit, (1) das zu lernen, was
de Witt, Claudia (2013): Vom E-Learning zum Mobile Learning
sie interessiert. Sie können lernen, (2) wo immer und – wie Smartphones und Tablet PCs Lernen und Arbeit verbin-
(3) wann immer sie dies möchten. Dabei ermög den. In: de Witt, Claudia/Sieber, Almut (Hrsg.): Mobile Learning
– Potenziale,Einsatzszenarien und Perspektiven des Lernens mit
lichen (4) unterschiedliche, technisch aufbereitete mobilen Endgeräten. Wiesbaden: Springer.
Lernformate unterschiedliche Möglichkeiten zum de Witt, Claudia/Czerwionka, Thomas (2013): Mediendidaktik.
Lernen. Und zu guter Letzt ist (5) der Lerner nicht 2. Aufl. Bielefeld: Bertelsmann.
mehr zwangsläufig auf Institutionen angewiesen. Xaidialoge/Europa-Universität Viadrina (2012): Internet-Tsunamis
– Politische Massen im digitalen Zeitalter. [Online, zuletzt abgeru-
An dieser Stelle bleibt zum Abschluss kritisch anzu- fen am 22.01.2016]
merken, dass die genannten Punkte zwar durchaus
optimistisch stimmen. Dennoch bedeuten die vie-
len Potenziale nicht automatisch ein besseres oder
effektiveres Lernen (vgl. Kerres 2016, S. 2). Mit ihnen
gehen neue Möglichkeiten zur Gestaltung von Bil-
dungsprozessen einher, für die es nach wie vor klare
Konzeptionen braucht, was in Zukunft freilich eine
besondere Herausforderung für Bildungsanbieter
sein wird. ■8 |
Entwicklungen Die Digitalisierung macht aus Kultur Software
Die Digitalisierung macht aus Kultur Software
Seine Augen leuchten fast so hell wie die rote Lockenpracht auf seinem Kopf. Denn was der kleine
Kobold sieht, ist neu und faszinierend: „Pumuckl und der erste Schnee“ heißt die Folge der Kinder-
serie, in der sich diese Szene zuträgt, die man beispielhaft lesen kann für unseren Umgang mit der
Digitalisierung: Der Kobold ist so begeistert von dem Schnee, dass er ihn anfassen und besitzen will.
Er hievt eine kleine Karre aus der Werkstatt des Meisters Eder ins Freie und belädt sie mit Schnee.
Stolz transportiert er die weiße Fracht ins Warme. Dort lädt er den Schnee ab und eilt zurück in den
kalten Innenhof, um noch mehr Schnee zu holen. Als er wenige Augenblicke später zurückkommt,
ist er empört: Sein Schnee ist verschwunden. Statt der weißen Ladung, die er gerade vom Karren
geladen hatte, findet er auf dem Werkstattboden nur eine kleine Pfütze. Pumuckl schimpft und tobt
und beschuldigt schließlich einen unsichtbaren Dieb, ihm den Schnee gestohlen zu haben.
Ich glaube, dass es der Medien- und Bildungsbran- Doch damit nicht genug: Auf Wikipedia trägt jeder
che derzeit ein wenig ergeht wie dem Kobold aus Artikel seine Vorversion weiterhin bei sich. Unter
der Kinderserie. Unser erster Schnee ist das Internet der Oberfläche des Eintrags kann der Leser wie
und nach einem ersten begeisterten Blick auf dieses in einer Tiefenbohrung der Entstehung und dem
neue Medium, erleben wir gerade eine Pumucklsche Wandel des Artikels nachspüren, er kann verfol-
Enttäuschung. Wir bemerken, dass die Inhalte, die gen, welche Unklarheiten in dem Text stehen, wo er
wir als „fest“ und „unveränderlich“ kennengelernt Schwächen oder Fehler hat. All das war in der festen
haben, plötzlich verschwinden. Aber genau wie der Form des gedruckten Lexikon-Artikels undenkbar.
Schnee in der Werkstatt gilt auch hier: Sie wurden In den Klimabedingungen des Digitalen fügen sich
Dirk von Gehlen nicht gestohlen. Sie verändern vielmehr ihren Ag- diese Schwachpunkte des Gedruckten zu einem
Autor und Journalist, gregatzustand. Sie werden flüssig. Man nennt die- Qualitätsausweis des Digitalen. Der Leser kann aus
Leiter „Social Media/Innovation“ sen Prozess Digitalisierung und er fordert unser Ver- diesen Einblicken in den Entstehungsprozess sel-
bei der Süddeutsche Zeitung.
ständnis für Kunst und Kultur, für Inhalte und auch ber ein Bild formen. Von ihm wird verlangt, was der
Blog: für Bildung auf neue Weise heraus. Brockhaus ihm abnahm: Er muss aktiv einordnen,
digitale-notizen.de
überprüfen und selber entscheiden, welche Version
Wenn man dieses Bild auf den Ort übertragen will, glaubwürdig ist und welche nicht.
in dem die Menschheit für Jahrzehnte ihr Wissen
speicherte, kann man sagen: Die Digitalisierung hat Die Veränderung basiert auf einem Prozess, der
den Brockhaus geschmolzen, aus der festen Form ei- Kultur und Wissen zu Software macht. In den Klima
nes Lexikons ist Wikipedia geworden, eine flüssige bedingungen des Digitalen verändern sie ihren
Version dessen, was man früher gebildet im Regal Aggregatzustand, verhalten sich wie Programme,
stehen hatte. Im Brockhaus fand sich dort – oft über die wir aus der Computernutzung kennen: Texte,
Jahre – je eine einzige unveränderliche Version zu Bilder, Töne werden zu Software, d. h. sie liegen in
einem Begriff. In Wikipedia kann sich diese innerhalb Versionen vor. Ihr Entstehungsprozess wird plötz-
von Sekunden ändern. Bei wichtigen, zum Beispiel lich sicht- und dokumentierbar. Er wird Bestandteil
Personalentscheidungen, gleicht das digitale Le- des Produkts, Ausweis ihrer Qualität. So wie ein Bio-
xikon einem Live-Ticker: eine andere Person ist in Ei sich von einem konventionellen Ei auch nicht
ein Amt gewählt und in den nächsten Sekunden durch die Farbe der Schale unterscheidet, sondern
ist der entsprechende Artikel aktualisiert. Wer dann in den Bedingungen seiner Entstehung, verschiebt
mit dem Erfahrungshorizont des Brockhaus digital die Digitalisierung auch hier den Blick vom Produkt
nachblättert, wird ratlos vor dem versionierten Arti- hin zum Prozess. Man muss zum Beispiel ein Buch
kel stehen, wie der Pumuckl vor der Schneepfütze. nicht mehr erst kaufen, wenn die Autorin es fertig
geschrieben hat. Ein Buch kann zu einem digitalenDie Digitalisierung macht aus Kultur Software | 9
Raum werden, in dem die Autorin als Gastgeberin, In seinem Buch „Eine neue Version ist verfügbar“ hat
die Leser teilhaben lässt an der Entstehung. Wie in Dirk von Gehlen nicht nur beschrieben, wie Kultur zu
einem Chat können die Leser Buchstabe für Buch- Software wird, er hat es auch in der Entstehung des Bu-
stabe beobachten wie das fertige Werk entsteht. ches gezeigt. Das Werk wurde über die Crowdfunding-
Plattform „Startnext“ vorab finanziert. 350 Leserinnen
Möglich wird dies durch einen technischen Wandel und Leser kauften das Buch 2012 bevor auch nur eine
einerseits. Aber vor allem auch durch ein veränder- Zeile geschrieben war und beobachteten den Autor
tes Rollenbild derjenigen, die mit Kunst und Kultur dann beim Schreiben. Mehr dazu unter enviv.de ■
(oder eben Wissen) die Öffentlichkeit suchen. Sie
sind nicht mehr einzig Produzenten, sondern viel-
mehr auch Moderatoren, die wie Gastgeber ein
Netzwerk und nicht nur ein Werk erstellen. Ihre Au-
torität entsteht nicht mehr einzig aus der Option,
publizieren zu können. Ihre Autorität gründet sich
auf Authentizität. Sie sind greif- und ansprechbar
und schaffen damit Glaubwürdigkeit für sich und
ihre (Netz-)Werke. Dabei ist das Prinzip nicht neu,
die Dimension aber sehr wohl. Atelierbesuche gibt Um die digitale Medienkultur aus evangelischer
es seit Künstler Werke schaffen. Dass aber die ganze Sicht fundiert beurteilen und angemessene
(vernetzte) Welt ins Atelier schauen kann, gab es Konsequenzen für Erziehung und Bildung
vorher nicht. Der Streamingdienst Twitch, der bisher ziehen zu können, braucht es ein grundlegendes
Computerspielern die Möglichkeit gab, gemeinsam Verständnis dafür, was Medien für den
an Spielen teilzunehmen, hat diese Option seit kur- Menschen bedeuten sowie für die Zusammen-
zem auch für Künstler eröffnet. Menschen können hänge zwischen Religion und Medien, gesicherte
sich nun in einem Live-Stream hinzuschalten, wenn Erkenntnisse darüber, wie digitale Medien auf
z. B. eine Künstlerin ein Bild malt. Menschen wirken, und ethische Maßstäbe, an
denen sich Urteile orientieren können.
Warum man das tun sollte? Aus dem gleichen Grund,
aus dem Menschen Sportereignissen beiwohnen. In
Wahrheit ist das Ergebnis – das z. B. bei einem Fuß-
ballspiel produziert wird – nur ein Teil des Wertes.
Das Erlebnis, dabei zu sein, ist mindestens ebenso
wichtig wie das Ergebnis. Das Internet hat vernetzte
Räume geöffnet, in denen Werte eben darüber ge-
schaffen werden: über das Dabeisein, die Teilhabe,
das Erlebnis.
All dies wird möglich, wenn wir mit neuem Blick auf
den Schnee im Warmen schauen: Er verändert bei
hohen Temperaturen seinen Aggregatzustand, ist
weniger greifbar. Der Pumuckl lernt dies im Laufe
der kurzen Folge. Und auch wir werden diese Er-
kenntnis in die Tat umsetzen. Denn natürlich kann
man Schnee auch im Warmen greifbar machen oder
transportieren: man braucht zum Beispiele eine Fla-
sche für das Wasser.10 |
Entwicklungen Lernkulturwandel in der Erwachsenenbildung
Lernkulturwandel in der Erwachsenenbildung –
Vom Wissensvermittler zum Lernraumgestalter und
Online-Tutor
Über Medien können wir am Wissen einer Kultur und an gesellschaftlicher Kommunikation teil-
nehmen. Die digitalen Medien als Charakteristikum der heutigen Wissensgesellschaft ermöglichen
zudem ein neues Lehren und Lernen in allen Bildungs- und Weiterbildungsbereichen. Die Wissens
gesellschaft zeichnet sich durch das lebenslange Lernen als eigenverantwortliches und koopera
tives Lernen aus und steht für einen Wandel der gesamten Lernkultur.
Für das Bestehen in dieser neuen Lernkultur sind mehr allein durch das Verfügen über Wissen, son-
für den Lernenden Medienkompetenz und Selbst- dern auch durch das erworbene Fähigkeitswissen
lernkompetenz entscheidend. Die Lehrenden (nun aus. Dieses Fähigkeitswissen (know how to know)
eher Lernbegleiter/-innen) benötigen mediendi- kann jedoch nicht durch synchrones fremdgesteu-
daktische und methodische Kenntnisse über das ertes Lernen erreicht werden. Aus diesem Grund ist
Lehren und Lernen mit digitalen Medien, um die es aus didaktischer Sicht notwendig, sich auf das
Qualität und den Lernerfolg von entsprechenden Konzept des selbstgesteuerten Lernens zu berufen,
Lernangeboten zu sichern. Es gibt unterschiedliche das sich in offeneren und asynchronen Lernarrange
Szenarien, in denen mit digitalen Medien gelernt ments am ehesten entfalten kann. Denn so können
Lisa Zierock wird. Meistens handelt es sich um ein selbstgesteu- Lernende ihre eigenen Wege und ihre Lernge-
Medienpädagogin, ertes Lernen, das auf unterschiedliche Weise alleine, schwindigkeit und -rhythmen selbst wählen und
Fachbereich Erwachsenen- mit anderen Lernenden oder mit der Unterstützung entwickeln somit neben inhaltlichen auch methodi-
und Familienbildung
im Zentrum Bildung der EKHN einer betreuenden Instanz stattfindet (vgl. Kerres sche Kompetenzen. Erwachsenenlernen entspricht
Kontakt: 2012, S. 5). folglich der Entwicklung von Selbsterschließungs-
lisa.zierock.zb@ekhn-net.de und Selbstlernkompetenz. Die Entwicklung dieser
Der Begriff der Lernkultur meint die „… typischen Kompetenzen bedarf weniger der methodischen
Arbeitsteilungen sowie die unausgesprochenen Inszenierung durch den Lehrenden, sondern einer
Reglements- und Organisationsmuster von Lernen Lernumgebung mit Methoden, die die Aneignung
in einer Gesellschaft bzw. Kulturgemeinschaft.“ von Methoden durch die Lernenden selbst fördert
(Arnold/Pätzold 2008, S. 179) (Ermöglichung von selbstgesteuertem Lernen). In
dieser Lernkultur können sich motivationale, soziale
Kompetenzen der Selbsterschließung und und emotionale Kompetenzaspekte entwickeln und
des Selbstlernens so zu aktivem (anwendbarem) Wissen verhelfen. Das
Lernen in einer nun lebendigen Lernkultur kann je-
Die bisher bekannte Lernkultur erfährt heute einen doch bei geringem Selbstwirksamkeitsgefühl und
Paradigmenwechsel, der zu einer alternativen Lern- fehlender Autonomie auch zur Überforderung füh-
kultur führt. Vorherrschend sind die beiden Trends ren. Bei der erwachsenendidaktischen Konzeptuali-
„von der Wissenspräsentation zur Wissenserschlie- sierung von Lernsituationen müssen daher, neben
ßung“ und „von der Wissensaneignung zur Wis- anthropogenen und soziokulturellen Voraussetzun-
senserzeugung“. Es kommt somit nicht mehr auf gen, vor allem die lernbiografischen und die lern-
Wissensvermittlung an, sondern darauf, Methoden projektbezogenen Faktoren beachtet werden (vgl.
kompetenz der Lernenden in einem umfassenden ebd., S. 179–182).
Sinne zu entwickeln. Vorhandenes Wissen soll selbst-
ständig erschlossen und neues Wissen erzeugt wer-
den können. Kompetenz zeichnet sich folglich nichtLernkulturwandel in der Erwachsenenbildung | 11
Lernkultur X Lernkultur Y
Wissensaneignung Wissenserschließung
• Behalten • Methodenkompetenz
• Lehr-Lern-Illusion • Selbstgesteuertes Lernen
• Nachhaltigkeitsparadoxie • Entgrenztes, asynchrones Lernen
Wissenspräsentation Wissenserzeugung
• Begriffswissen • Kompetenz
• Strukturwissen • Selbstschärfende Qualifikationen
• Paradoxie des synchronen Lernens • Aktives Wissen – Wissen in Aktion
➜ Prozessorientiert
➜ Strukturorientiert
➜ Formaler Wissensbegriff
➜ Materialer Wissensbegriff
➜ Verfügen über Fähigkeitswissen
➜ Verfügen über Wissen (Know-how)
(Know-how-to-know)
Abb. 1: Lernkulturwandel (Arnold/Pätzold 2008, S. 181)
Die neuen Medien bieten eigene Lernräume für ein Rolle und Kompetenzen der Lehrenden
virtuelles, selbstgesteuertes Lernen. Sie machen
komfortable und variantenreiche Aufbereitungen Ein Tele-Tutor oder Online-Tutor unterstützt und be-
zugänglich, die durch die Lernenden selbst ausge- treut Lernende im virtuellen Raum auf verschiedene
wählt werden können. Beim Wandel der Lernkultu- Weise. Dazu muss er versuchen, regelmäßigen Kon-
ren sollte in jedem Fall das Kriterium der Nachhal- takt zu den Lernenden aufrechtzuerhalten. Als On-
tigkeit übergeordnet sein, d. h. in diesem Fall muss line-Tutor ist man kein Wissensvermittler, sondern
gefragt werden „im Kontext welcher Lehr-Lern- Gestaltender von Lernumgebungen, Lernberater,
Organisationen Kompetenzen wirklich dauerhaft, Lernprozessbegleiter und Lerninitiator. Grundqua-
tragfähig und weiterentwicklungsfähig angebahnt lifikationen für einen Online-Tutor sind Kenntnisse
bzw. gefördert werden können“ (ebd., S. 185). Die über selbstgesteuertes Lernen, Medienkompetenz,
Antwort beinhaltet, dass auch überblick- und -struk- Kommunikationskompetenz (Online), Kenntnisse
turgebende Lehre für die Kompetenzentwicklung über die didaktische Gestaltung von virtuellen
des Lernenden relevant ist. Denn nur wenn dieser Lehr- und Lernsituationen und Kenntnisse über
bereits eine strukturierte Basis an organisiertem kooperatives Online-Lernen in Gruppen und de-
Wissen besitzt, kann er seine selbsttätige Wissens ren Moderation. Hauptaufgaben des Online-Tutors
aneignung und Kompetenzentwicklung gestalten. sind, die Lernenden online willkommen zu heißen,
Es sollte somit auf keinen Fall die methodenorien- die Lernenden zu motivieren, den Fortschritt zu
tierte Einseitigkeit durch eine neue Einseitigkeit er- überwachen, Fragen zu beantworten, Probleme zu
setzt werden. Wichtig in der Erwachsenendidaktik lösen, Feedback zu geben, den Erfolg von Diskussi-
heute sind die Aspekte Lebendigkeit, Aneignungs- onen sicherzustellen, eine Lerngemeinschaft aufzu-
freundlichkeit und „Hilfsbereitschaft“ der lehrenden bauen, technische Tipps zu geben und den Kurs zu
Wissenspräsentation. Diese muss zusätzlich dabei schließen (vgl. Böhm 2006, S. 22/23).
helfen entsprechende professionelle Fähigkeiten
zu entwickeln (vgl. ebd., S. 183–186). Notwendig sind somit entsprechende Fachkom-
petenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz,
Personale Kompetenz, Organisations- und Adminis-
trationskompetenz (vgl. Rösler/Würffel 2010, S. 37).
Der Begriff der Kompetenz schließt die Dimensio-
nen Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Einstellungen12 | Lernkulturwandel in der Erwachsenenbildung
und Motivation, soziale Aspekte, Erfahrungen und und sozialemotionale Bedürfnisse der Lernenden
konkretes Handeln ein. Entscheidend ist dabei nicht kennen, die Praxisrelevanz der Inhalte verdeutlichen,
das Vorhandensein einer dieser Komponenten einer an das Vorwissen der Lernenden anknüpfen, Lerner-
spezifischen Kompetenz, sondern dass diese auch folge erkennen und loben, Lernschwierigkeiten the-
in der Praxis genutzt werden und sie für das erfolg- matisieren und aufarbeiten, den Lernstoff klar glie-
reiche Bewältigen von Aufgaben und Problemen dern und strukturieren und eine Übersicht geben,
eingebracht und angewandt werden. Die zentrale was im Kurs erreicht und geleistet werden kann. Je
Kompetenz für Lehrende allgemein ist die professio- selbstbestimmter die Teilnehmenden dabei lernen
nelle Handlungskompetenz. Diese schließt dabei die und arbeiten können, umso besser funktioniert die
Teilkompetenzen Fachkompetenz (mit der Teilkom- Motivierung (vgl. e
bd., S. 94/95). ■
petenz Methodenkompetenz), Soziale Kompetenz
(mit der Teilkompetenz Kommunikative Kompe- Hinweise zur Konzeption und Umsetzung von Online-
tenz) und Personale Kompetenz ein. Angeboten (siehe Claudia Bremer in diesem Heft)
Formen der Motivation
Literatur
Im Online-Tutoring haben vor allem die Bereiche
Arnold, Rolf/Pätzold, Henning (2008): Bausteine zur Erwachse-
Motivation und Motivierung einen besonderen nenbildung. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren
Stellenwert. Es kann zwischen intrinsischer und ex- (Grundlagen der Berufs- und Erwachsenenbildung, Band 53)
Böhm, Frank (2006): Der Tele-Tutor. Betreuung Lehrender und
trinsischer Motivation unterschieden werden. Die
Lernender im virtuellen Raum. Wiesbaden: VS Verlag für Sozial-
verschiedenen Formen der Motivation entstehen wissenschaften
durch unterschiedliche Grade der Selbstbestim- Kerres, Michael (2012): Mediendidaktik. Konzeption und Entwick-
lung mediengestützter Lernangebote. 3. Aufl. München: Olden-
mung. Somit hat die intrinsische Motivation den
bourg
höchsten Grad der Selbstbestimmung. „Handlun- Rösler, Dietmar/Würffel, Nicola (2010): Online-Tutoren. Kompe-
gen die aus einer intrinsischen Motivation heraus tenzen und Ausbildung. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag
durchgeführt werden, werden freiwillig und ohne
äußeren Zwang ausgeführt, entsprechen den per-
sönlichen Zielen, Wünschen und Werten der Person
und dienen dem Ziel, eine positive Emotion auszu-
lösen.“ (ebd., S. 91) Die extrinsische Motivation ist
in Teilen immer fremdbestimmt, kann jedoch auch
einen unterschiedlich hohen bzw. niedrigen Grad an
Selbstbestimmung aufweisen.
Motivation sollte immer im Zusammenhang mit
anderen Faktoren betrachtet werden. Diese sind
interne Faktoren, wie Angst, Selbstbewusstsein,
Selbstwirksamkeit, Lernerfahrungen, Erfolg usw.
und externe Faktoren, wie andere Personen und
die Interaktionen mit diesen, das Lernumfeld und
der weitere soziale Kontext. Teilnehmende können
unterschiedlich auf die entsprechenden Kombinati-
onen verschiedener Faktoren im Kursverlauf reagie-
ren (vgl. ebd., S. 93). Zunächst muss festgestellt wer-
den, um welche Lerntypen es sich bei den Teilneh-
menden handelt, welche (bewussten) Motive und
Anfangsmotivation diese für die Teilnahme haben.
Um die Teilnehmenden konsequent motivieren zu
können, sollte der Tutor oder die Tutorin kognitiveDigitale Bildung – Anfragen an die Erwachsenenbildung |
Entwicklungen 13
Digitale Bildung – Anfragen an die
Erwachsenenbildung
„Was zeichnet eine „digitale Bildung“ aus? Haben wir es hier einfach ‚nur’ mit einer digitalisier-
ten Form von Bildung zu tun? Handelt es sich hier um Bildung, die mit Hilfe von digitalen Medien
stattfindet? Oder geht es um eine Bildung, die sich konkret und umfassend mit der von digitalen
Medien durchdrungenen Welt auseinandersetzt?“ Sowohl-als-auch könnte die Antwort auf diese
Fragen sein, mit unterschiedlichen Gewichtungen, je nach Veranstaltungsformat, Zielgruppe und
Lernziel. Anika Klein und Bernhard Schmidt-Hertha haben diese Fragen in ihrem Blogbeitrag auf
der E-Plattform für Erwachsenenbildung (EPALE) (28.7.15) aufgeworfen. Wir haben ein paar Impulse
ausgewählt und zitieren einzelne Passagen, mit freundlicher Genehmigung der Autoren.
Nach Winfried Marotzki (2006) handelt es sich bei Blick genommen werden. Mit diesem erweiterten
Bildung „nicht allein um eine Erweiterung von Verständnis von digitaler Bildung kann „Bildung
Kenntnissen und Fertigkeiten, sondern um eine da- nicht mehr ohne das jeweilige Verhältnis zu diesen
rüber hinausgehende Veränderung von bestehen- Technologien gedacht werden; sei es aufgrund des
den Deutungs- und Wissensstrukturen aufgrund selbstverständlichen Einsatzes verschiedener An-
tiefergehender Reflexionsprozesse. Bildung steht wendungen und Geräte im Lebensalltag oder auch
somit nicht allein für ein Mehr an Wissen und Kön- den bewussten Verzicht auf diese. Wer man ist und
nen, sondern für die Weiterentwicklung der Person wie man sich selbst in der und zur Welt verortet, wird
in einer gegebenen Umwelt.“ Lernen bedeutet zunehmend auch von digitalen Medien bestimmt“
mehr als Kompetenzerwerb. Insofern ist der Begriff (Zorn 2014). Anika Klein
der digitalen Bildung nicht unhinterfragt zu über- wissenschaftliche Mitarbeiterin
in der Abteilung Erwachsenen-
nehmen. Zweifelsohne sind Medienkompetenzen Fragen nach dem Verständnis von
bildung/Weiterbildung der
notwendig. Vorhandene messbare Kompetenzen Medienbildung Eberhard Karls Universität
im Umgang mit digitalen Medien sagen allerdings Tübingen
nicht alles über Medienbildung aus. „Was können und sollten Ziele und Inhalte von An-
geboten der Erwachsenenbildung sein? Wie wird
Verortung der eigenen Person in einer Medienbildung verstanden? Als Eröffnung neuer
digitalisierten Welt Bildungsräume durch den Einbezug digitaler Me-
dien? Als Angebote zur Weiterentwicklung des
Was unter digitaler Bildung verstanden wird, ist ab- Technologieverhältnisses in Verbindung mit der
hängig vom Stellenwert, der den digitalen Medien Persönlichkeitsentwicklung? Inwiefern ist hier über-
beigemessen wird. Entsprechend unterschiedlich haupt eine Trennung möglich? Können Medien als
fallen die Antworten aus: Bildungsräume genutzt werden, ohne das jeweilige
Verhältnis zu diesen Technologien zu berücksich-
Einerseits kann der Fokus sich auf neue Räume und tigen? Ohne an den (nicht-)digitalisierten Lebens- Dr. Bernhardt Schmidt-Hertha
Möglichkeiten für Bildungsprozesse richten, die alltag anzuschließen?“ Inhaber einer Professur für
Erziehungswissenschaft mit
durch digitale Medien eröffnet werden. „Aus dieser
Schwerpunkt berufliche und
Perspektive stellt sich für die Praxis der Erwachse- Diese Fragen stellen sich für Bildungsanbieter, zu- betriebliche Weiterbildung
nenbildung die Frage, wie digitale Medien genutzt gleich ist die Bedeutung von Alters- und Generatio an der Eberhard Karls Universität
Tübingen.
werden können, um allgemeine Bildungsprozesse nenbildern zu reflektieren: „Mit welchen verbrei-
zu unterstützen“ (Marotzki & Jörissen 2010). teten Alters- und Generationenbildern sehen sich Blog:
Personen (und Institutionen) konfrontiert? Welchen https://ec.europa.eu/epale/de/
blog/digitale-grundbildung-als-
Andererseits kann die zunehmende Durchdringung persönlichen Nutzen verspricht man sich als Ange- herausforderung-fur-die-
von Lebenswelten durch digitale Medien in den höriger einer Altersgruppe bzw. einer Generation? erwachsenenbildung14 | Digitale Bildung – Anfragen an die Erwachsenenbildung
Welche Anstrengungen und Barrieren werden be-
fürchtet?“
„Intergenerationell angelegte Bildungsangebote
könnten eine Möglichkeit darstellen, bestehen-
de Generationen- und Altersbilder zum Umgang
mit digitalen Medien ins Bewusstsein zu bringen.
Doch gerade hier wird auch ein Fingerspitzenge-
fühl gefragt sein, wenn es darum geht, die verschie-
denen Generationen mit ihren unterschiedlichen
Zugängen zu digitalen Medien zu erreichen und
zusammenzubringen.“ Insbesondere für weniger
medienaffine Zielgruppen stellt sich die Frage nach
erfolgreichen Projekten und Konzepten zur Förde-
rung von Medienbildung.
Festzuhalten ist, dass es den Einzug digitaler Me-
dien in unsere Lebenswelten mit Konzepten und
Angeboten von Erwachsenenbildung gut zu be-
gleiten gilt. Die Stärkung der Medienkompetenz
bleibt für Bildungsträger eine Herausforderung
und beinhaltet nicht nur einen selbstbestimmten,
verantwortungsvollen und kompetenten Umgang
mit digitalen Medien, sondern auch eine kritische
Betrachtung der technologisch geprägten Welt und
des eigenen Verhältnisses zu den Medienentwick-
lungen. ■
Redaktionelle Bearbeitung durch Elke Heldmann-Kiesel.
Quellenangaben:
Marotzki, W. (2006), Bildungstheorie und allgemeine Biographie-
forschung. In H.-H.Krüger & W. Marotzki (Hrsg.), Handbuch erzie-
hungswissenschaftliche Biographieforschung, S. 59–70.
Marotzki, W. & Jörissen, B. (2010), Dimensionen strukturaler
Medienbildung. In B. Herzig, D. M. Meister, H. Moser & H. Niesyto
(Hrsg.), Jahrbuch Medienpädagogik 8. Medienkompetenz und
Web 2.0. Wiesbaden: VS Verlag, S. 19–39.
Zorn, I. (2014), Selbst-, Welt- und Technologieverhältnisse im
Umgang mit Digitalen Medien. In W. Marotzki & N. Meder (Hrsg.),
Perspektiven der Medienbildung. Wiesbaden: VS Verlag, S. 91–120.Einsatz digitaler Medien in der Erwachsenenbildung |
Entwicklungen 15
Einsatz digitaler Medien in der Erwachsenenbildung:
Anforderungen für Lehrende und Einrichtungen der
Weiterbildung
In vielen Arbeits- und Lebensbereichen gewinnen digitale Medien zunehmend an Bedeutung: So
auch in der Bildung. Von den Erklärvideos auf YouTube bis hin zu kompletten Online Kursen reicht
das Bildungsangebot im Netz. Dieser Beitrag gibt einen Überblick, welche Formate und Szenarien
im Kontext des Einsatzes digitaler Medien in Bildungsprozessen existieren, welche Mehrwerte da-
bei realisierbar sind und was Bildungseinrichtungen beachten sollten, wenn sie sich der Aufgabe
stellen, digitale Medien in ihre Bildungsangebote zu integrieren.
Szenarien und Formate werden oder können dessen Vor- und Nachbe-
reitung dienen. In den aktuell diskutierten flipped
Wie oben schon angedeutet, kann der Einsatz di- classroom-Konzepten findet in den online gestützten
gitaler Medien in Bildungsprozessen höchst unter- Selbstlernphasen der Wissenserwerb statt, während
schiedliche Formen annehmen. Diese reichen von die Präsenzblöcke der Wissensanwendung, -vertie-
kleinen Formaten wie z. B. kurzen Erklärvideos fung und der Klärung von offenen Fragen dienen.
von ca. 2–3 Minuten Länge, wie sie beispielsweise Ziel dabei ist, die wertvollen Kontaktzeiten der Prä-
auf YouTube zu finden sind, bis hin zu umfangrei- senzphase so optional zu nutzen.
cheren und komplexeren Formaten. Diese kürzeren
Formatesind oftmals im Kontext des prozeduralen Reine online Formate finden sich in den aktuell Claudia Bremer
Wissens anzusiedeln und unterstützen Handlungs- sehr häufig diskutierten Massive Open Online Cour- E-Learning Expertin an der
ses (MOOCs): Kurse, die kostenfrei zugänglich sind Goethe-Universität Frankfurt am Main,
abläufe wie z. B. die Nutzung einer Software, aber
Beratung, Konzeption und
auch körperliche Routinen. Hier ist der Vorteil der und an denen zum Teil mehrere tausend Lernende Umsetzung von eLearning-
visuellen Wissensvermittlung offensichtlich: Gerade teilnehmen. In den sogenannten xMOOCs, die sich Strategien
Handlungsabläufe lassen sich über einen Videofilm mit einem online gestützten Frontalunterricht ver- Kontakt:
www.bremer.cx
gut verdeutlichen. gleichen lassen, schauen die Teilnehmenden Videos
und überprüfen dann in online bereitgestellten
Komplexere Szenarien finden sich in sogenannten Quizzes ihren Lernzuwachs. In anderen Kursen ver-
Blended Learning Formaten, in welchen online ge- fassen sie kleinere Essays und geben sich gegensei-
stützte Selbstlernphasen mit Präsenzblöcken kom- tig Feedback (peer reviewing). In den sogenannten
biniert werden (Kerres 2001, Sautter & Sautter 2002). cMOOCs kommen dagegen häufig eher diskursiv
Hierbei bietet die digitale Unterstützung der Selbst- angelegte Live-Sessions zum Einsatz, in denen Ex-
lernphase einen zusätzlichen Gestaltungsraum für perten z. B. Meinungen austauschen oder auch mit
Lernprozesse: Aktivitäten, die in der Präsenzphase den Teilnehmenden diskutieren. cMOOCs stellen
keine Zeit finden oder schwer umsetzbar sind, kön- also mehr die Aktivitäten der Lernenden in den
nen in die Selbstlernphasen verlegt werden und Mittelpunkt und bauen auf deren Beiträgen auf, die
durch digital bereitgestellte und unterstützte Auf- z. B. in Form von Blog- und Forenbeiträgen und in
gabenstellungen und interaktive Übungen unter- anderen Medien stattfinden (als Beispiel s. den CL20
stützt werden. Auch können Kommunikations- und MOOC zum ThemaCorporate Learning 2.0 www.
Kooperationsprozesse mit Hilfe digitaler Medien cl20-mooc.de). Inzwischen entstehen zahlreiche
in diesen Phasen umgesetzt werden. Die Heraus- sogenannte MOOC-Portale, auf denen eine Vielzahl
forderung dieses Formats liegt in der geeigneten von MOOCs zu den unterschiedlichsten Themen an-
Kombination und Verzahnung der beiden Phasen: geboten werden.
So sollten beispielsweise die Aktivitäten der Selbst-
lernphase im folgenden Präsenzblock aufgegriffen16 | Einsatz digitaler Medien in der Erwachsenenbildung
gramme). Ein anderer Begriff für solche, oft auch
auf dem eigenen Rechner offline ausführbare Kurse,
sind Computer Based oder Web Based Trainings (CBTs
und WBTs). CBTs können auch auf CDs, DVDs oder
per USB-Stick distribuiert werden. Solche – meist
interaktiv gestalteten – Lernmaterialien finden sich
auch auf größeren Portalen, auf denen man sich re-
gistrieren kann. Beispiele hierfür finden sich häufig
im Bereich des Sprachenlernens, für EDV Kurse und
weitere gut strukturierbare Lerninhalte.
Abb. 1: Ausschnitt zweier Seiten aus einem Lernprogramm (WBT) mit Aufgrund des hohen Aufwandes für die Erstellung
Videosequenz und einem Quiz 1
solcher interaktiver Bildungsinhalte sind vor allem
1
s. Beispiel Rechtsfragen-WBTs: http://online-education-skills. im Kontext des schulischen Lernens zahlreiche
de/rechtsfragen-rund-ums-elearning-wbts/ Austauschportale für kleinere digitale Lernmodule
entstanden, auf denen beispielsweise einzelne Ani-
MOOCs ist nicht das einzige reine online Format, mationen, Arbeitsmaterialien, Filme u. a. von und
das im Bildungsbereich existiert. Schon lange wer- für Lehrende bereitgestellt werden. Ein Begriff für
den neben diesem eher jüngeren offenen Format solche Bildungsressourcen, die kostenfrei im Netz
bezahlbare Online Kurse von mehreren Wochen getauscht werden, ist open educational ressources
Dauer angeboten. Zum einen existieren hierbei be- (OER). Hierzu existieren zahlreiche Portale und auch
treute Kurse, die zu bestimmten Zeitpunkten star- Lizenzregelungen wie sie z. B. die Creative Commons
ten und in denen eine ganze Gruppe von Lernen- Regelungen (CC-Lizenzen) ermöglichen, die die Ver-
den gleichzeitig teilnimmt. Die Lernenden tauschen gabe und das Ausweisen der Rechte zur Weiterver-
sich im Kursgeschehen untereinander aus, vernet- wendung digitale Ressourcen vorsenden.
zen sich oder bearbeiten gemeinsam Aufgaben in
kleineren Gruppen. Daneben existieren Lernange- Neben den genannten Konzepten, können digitale
bote, welche die Lernende jederzeit aufrufen kön- Medien auch zur Vor- und Nachbereitung von Prä-
nen und in denen es keinen expliziten Start- oder senzveranstaltungen genutzt werden, indem bei-
Endtermin gibt. Auf solche Kursangebote erhält spielsweise Materialien ergänzend und begleitend
man Zugriff nach Zahlung einer Gebühr. Teilweise digital bereitgestellt werden (s. Anreicherungskon-
sind diese Lernangebote tutoriell betreut, teilweise zept in Abbildung 2). Dies ist die einfachste Form
jedoch auch ohne Betreuung buchbar und dienen der digitalen Unterstützung und dient oftmals als
dem unbetreuten Selbstlernen (Beispiel Lernpro- Einstieg für Bildungseinrichtungen.
Anreicherungskonzept Integrationskonzept Virtualisierungskonzept
(Blended Learning)
Begleitung von Präsenzveran- Kombination von Präsenz- Online Lernangebote, wie z. B.
staltungen durch den Einsatz und Selbstlernphasen, in Online Tutorials, Webinare,
digitaler Medien zu deren denen digitale Medien zum betreute Online Kurse,
Vor-und Nachbereitung, z. B. Einsatz kommen, z. B. für Online MOOCs, Lernprogramme
durch die Bereitstellung von Übungen, Kooperations-/ (WBTs) u. a.
Materialien u. ä. Kommunikationsprozesse
Abb. 2: Szenarien des Einsatzes digitaler Medien in Bildungsprozessen (Bremer 2004, Bachmann et al 2001)Sie können auch lesen