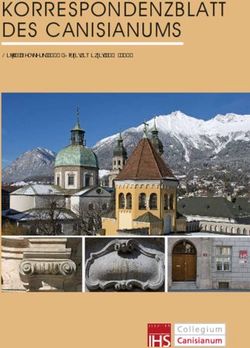Amt und Gemeinde - Evangelische Kirche in Österreich
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Amt und Gemeinde
67. Jahrgang, Heft 1, 2017 € 6, –
Luther im O-Ton
Luthers Auslegung des Magnificats
Hannelore Reiner 8
Luther und die Freiheit
Ulrich Körtner 14
Von Luthers „ordo missae“ zur
liturgischen Beliebigkeit
Ernst Hofhansl 29
Und weitere Beiträge
Evangelischer Presseverband Herausgeber: Bischof Michael BünkerINHALT
Luther im O-Ton
Editorial ...................................................................................... 5
Robert Schelander
Luthers Auslegung des Magnificats ........................................... 8
Hannelore Reiner
Luther und die Freiheit................................................................ 14
Ulrich Körtner
Von Luthers „ordo missae“ zur liturgischen Beliebigkeit ............ 29
Ernst Hofhansl
***
Ausstellungen
Einleitung zur Ausstellung
„Brennen für den Glauben“ – Wien nach Luther......................... 51
Rudolf Leeb
Freiheit und Verantwortung –
500 Jahre Protestantismus in Kärnten ....................................... 54
Manfred Sauer***
Rezensionen
Rudolf Leeb / Walter Öhlinger / Karl Vocelka (Hg.):
Brennen für den Glauben. Wien nach Luther. ............................ 60
Max J. Suda
Ulrike Pistotnik und Renate Bauinger (Hg.):
Gesichter, Geschichten, Konturen, Bd. 2:
Symposium „Der Weg der Landler“ .......................................... 62
Karl W. Schwarz
Gustav Reingrabner / Gert Polster:
Ein Christenherz auf Rosen geht (…)
500 Jahre Reformation im Burgenland ..................................... 65
Karl W. Schwarz
Gottfried Adam (Hg.):
Martin Luther, Passional ............................................................. 68
Reinhard Mühlen
***
Anhang
AutorInnen .................................................................................. 72
Impressum .................................................................................. 73 LUTHER IM O-TON
Editorial
Wie im letzten Heft angekündigt, widmet gibt. Die vielen Zitate – Original-Töne –
sich auch dieses Heft der Dokumentation belegen eindrucksvoll Luthers spezifische
der vielfältigen Veranstaltungen, welche Haltung in dieser Frage.
aus Anlass des 500-jährigen Reformati-
onsjubiläum im ganzen Lande durchge- Auch Ulrich Körtners Beitrag zum Frei-
führt werden. heitsverständnis lässt immer wieder Lu-
ther direkt „reden“. Wie fundamental und
In einem ersten Abschnitt haben wir Bei- zentral die Freiheit eines Christenmen-
träge versammelt, die auf dem Sympo- schen für Luther ist zeigt sich u. a. an per-
sium „Freiheit und Verantwortung. Luther sönlich biographischen Details, wenn sich
im O-Ton“ in der evangelischen Kirche Luther mit dem Beinamen Eleutheros –
am Wege (Wien-Hetzendorf) vorgetragen Befreiter bezeichnet und Christen „Freie“
wurden. Die Vortragenden waren gebe- nennt. Körtner weist auf die spezifische
ten worden Martin Luther im Original zu Verbindung dieser Befreiungsvorstellung
Wort kommen zu lassen. So hat beispiels- mit dem Rechtfertigungsgeschehen hin.
weise Landeskantor Mathias Krampe in Die berühmte Doppelthese mit welcher
Diktion und Sprache des 16. Jahrhunderts Luther den befreiten Menschen bestimmt:
Martin Luther zur aktuellen Gesangbuch- Herr und Knecht, ist – so Körnter – ad-
reform („Mit Luther auf dem Weg zu ei- äquater Ausdruck der christlichen Frei-
nem neuen Gesangbuch“) Stellung bezie- heit. In einem letzten Abschnitt wird diese
hen lassen. Eine Performance, welche sich dialektische Bestimmung auf das Handeln
in Amt und Gemeinde nicht wiedergeben des Menschen, eine evangelische Ethik
lässt. Wir können aber drei Beiträge aus bezogen, da ein „Christenmensch nicht
dem vielfältigen Programm abdrucken. sich selbst lebt“ (Luther).
Hannelore Reiner zeigt in ihrer Erin- Ernst Hofhansl Beitrag zur Gottesdienst-
nerung an die Auslegung des Magnifiat ordnung und ihrer Entwicklung ist zwei-
durch Martin Luther, dass „Maria“ auch geteilt. In einem ersten Teil geht er der
eine Person der evangelischen Glauben- Reform der Messe durch Martin Luther
stradition ist und es vielfältige protestan- nach, in einem zweiten den Ordnungen
tische Zugänge zur Mutter Jesu gab und und der Praxis des Gottesdienstes in Ös-
Amt und Gemeinde 5terreich. Er konstatiert eine Vielfalt an und Christen. Können wir heute als Theo-
Gottesdienstabläufen und -gebräuchen, loginnen und Theologen einfach so von
die – so die These – Ausdruck liturgi- ‚Gesetz und Evangelium‘ reden; das Ge-
scher Beliebigkeit sei. Diese Kritik wird setz führt zum Tod und das Evangelium
untermauert mit einer Zusammenstellung schenkt Leben?“
liturgischer Reformen des letzten Jahr- Eine berechtigte Frage, die mit dem
hunderts, welche in eine Liste von be- Hinweis auf diverse Stellungnahmen, in
denkenswerten Anliegen und Anregungen denen eine theologische korrekte Haltung
für die Gestaltung von Gottesdiensten argumentiert wird, noch nicht beantwor-
mündet. tet ist. Ich zitiere zwei jüngere Stellung-
nahmen:
Mit zwei Beiträgen, mit denen der Re- • „Die Aufteilung von Gesetz und Evan-
formation in Wien und in Kärnten ge- gelium auf das Alte und Neue Testa-
dacht wird, führen wir den Reigen der ment bzw. auf Judentum und Christen-
Dokumentationen von Veranstaltungen tum ist nicht zutreffend. Es gibt auch
dieses Jubiläumsjahres weiter. Rudolf im Neuen Testament ‚Gesetz‘ und im
Leeb, welcher die Ausstellung Brennen Alten Testament auch ‚Evangelium‘.“1
für den Glauben. Wien nach Luther, mit • „Wir stellen uns in Theologie und
anderen kuratiert hat, erläutert Konzept Kirche der Herausforderung, zentrale
und besondere Prunkstücke dieser Aus- theologische Lehren der Reformation
stellung. Manfred Sauer erinnert in sei- neu zu bedenken und dabei nicht in
nem Vortrag, welchen er im Rahmen des abwertende Stereotype zu Lasten des
Fördervereins Rudolfinum des Landes- Judentums zu verfallen. Das betrifft
museums Kärnten gehalten hat, an die insbesondere die Unterscheidungen
Anfänge des Protestantismus in Kärnten ‚Gesetz und Evangelium‘, ‚Verheißung
vor 500 Jahren und wie sehr evangelische und Erfüllung‘, ‚Glaube und Werke‘
Christen dieses Land geprägt haben. und ‚alter und neuer Bund‘.“2
Zum Artikel über die Fresken in Ran-
ten von Gottfried Adam (in Amt und Ge-
meinde Nr. 3-4, 2016) schreibt Pfarrerin
Ulrike Frank-Schlamberger (Graz Hei- 1 (Christen und Juden I–III. Die Studien der Evangeli-
landskirche) uns einen Leserbrief: „In schen Kirche in Deutschland 1975–2000, Gütersloh
2002), [www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/christen_und_
diesem tollen Fresko ist auch der pro- juden_I-III.pdf]
testantische Antijudaismus im wahrsten 2 Martin Luther und die Juden – Notwendige Erin-
Sinne des Wortes sichtbar. Mit den Au- nerung zum Reformationsjubiläum. Erklärung der
Bischofskonferenz der Vereinigten Evangelisch-
gen zu erkennen. Auf der Gesetzesseite Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) und
der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
sind erkennbar Juden dargestellt und auf (EKD) Bremen 2015. [www.velkd.de/downloads/
der Seite des Evangeliums Christinnen kundgebung-luther-juden-velkd-2015.pdf]
6 Amt und GemeindeDiese Stellungnahmen sind wichtige Fest- gleich antijüdischen Bildmotiv zu beden- legungen und doch erst ein Anfang. Sie ken. Vielleicht möchte aus dem Kreis der stellen uns m. E. vor die Herausforderung Lesenden jemand mit uns ihre bzw. seine – bezogen auf die Rantener Fresken – auch Erfahrungen oder Gedanken teilen. ■ den praktischen und didaktischen Umgang mit diesem ur-protestantischen und zu- Robert Schelander Amt und Gemeinde 7
LUTHER IM O-TON
Luthers Auslegung des
Magnificats
Von Hannelore Reiner
„Nun weiß ich in der ganzen Schrift nichts,
das also wohl dazu diente, wie dieses heilige Lied
der hochgebenedeiten Mutter Gottes, welches
wahrlich von allen, die regieren und heilsam Herren
sein wollen, wohl zu lernen und zu behalten ist.“
(Luther)
A nders als etliche Vorlesungen
Luthers zu biblischen Büchern und
Texten war die Auslegung des Loblieds
sein wollen, wohl zu lernen und zu be-
halten ist. Es ist auch nicht ein unbilliger
Brauch, dass in allen Kirchen dies Lied
der Maria aus Lk 1, 46–55 zunächst nicht täglich in der Vesper, dazu in angemesse-
für die Studenten Wittenbergs bestimmt, ner anderer Weise als anderer Gesang ge-
sondern für den 18-jährigen Neffen des sungen wird. Dieselbe zarte Mutter Gottes
Kurfürsten von Sachsen, den Herzog Jo- wolle mir erwerben den Geist, der solchen
hann Friedrich und ist damit fast so etwas ihren Gesang könne nützlich und gründ-
wie ein „Fürstenspiegel“. Weshalb Luther lich auslegen, dass E. F. G. und wir alle
ausgerechnet das Magnificat dem jungen heilsamen Verstand und löbliches Leben
Fürsten zueignet, erklärt er selbst in der daraus nehmen, und danach im ewigen
Einleitung: „Nun weiß ich in der ganzen Leben loben und singen mögen dies ewige
Schrift nichts, das also wohl dazu diente, Magnificat; das helf’ uns Gott. Amen.“1
wie dieses heilige Lied der hochgebene-
deiten Mutter Gottes, welches wahrlich
von allen, die regieren und heilsam Herren 1 Martin Luther, Das Magnificat, S. 225 f.
8 Amt und GemeindeHistorische Einordnung Luthers Sicht auf Maria
Es handelt sich bei der Magnificat-Aus- Die Auslegung dieses Liedes, das der Evan-
legung um eine der frühen Schriften Lu- gelist Lukas der schwangeren Maria in den
thers, begonnen im November 1520, also Mund legt, gibt auch einen guten Einblick in
in jenem Jahr, in dem auch die drei be- Luthers Verhältnis zur biblischen Maria, die
kannten Reformschriften entstanden sind er ohne Einschränkung „theotokos“ Gottes-
( An den christlichen Adel, De captivitate mutter und Jungfrau nennt, und dies auch in
ecclesiae und die Freiheitsschrift). Inzwi- seinem weiteren Leben nicht verändert. Für
schen war Luther bekanntermaßen mit den Reformator war Maria der Inbegriff des
dem päpstlichen Bann bedroht und belegt in freier Gnade von Gott erwählten Men-
worden. Ende März 1521 war er in einem schen, der nicht nach Verdienst, sondern
Triumphzug nach Worms zum Reichstag als geringe Magd ausgewählt wurde. Maria
aufgebrochen. Dort wurde die Reichsacht war ihm gleichsam die biblische Urgestalt
über ihn verhängt. Ab Mai 1521 lebt der protestantischer Gnadenerwählung.
Geächtete als „Junker Jörg“ auf der Wart- Luther stellt seiner Auslegung den bibli-
burg und schreibt an Georg Spalatin, sei- schen Text in deutscher Übersetzung voran:
nem Verbindungsmann zum Kurfürsten, Meine Seele erhebt Gott den Herrn.
dass er möglichst rasch wieder arbeiten Und mein Geist freut sich in Gott, meinem
wolle, auch das angefangene Magnificat Heiland.
vollenden.2 Denn er hat mich, seine geringe Magd, an-
Damit sind wir nun bei Luthers Aus- gesehen; darum werden mich selig preisen
legung des Magnificats selbst angelangt. Kindeskinder ewiglich.
Der Reformator geht in der Form einer Denn er hat große Dinge an mir getan, der
Homelie, Vers für Vers, anfangs sogar da mächtig ist und des Name heilig ist.
Wort für Wort, vor, wobei er neben der Und seine Barmherzigkeit währt von einem
lateinischen Übersetzung auch immer Geschlecht zum andern, bei allen, die ihn
wieder auf griechische Originalzitate fürchten.
zurückgreift. Die Auslegung ist gespickt Er wirket gewaltig mit seinem Arm, und zer-
mit Bibelzitaten, sowohl aus dem AT als streuet, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.
auch aus den Evangelien und den neutes- Er stößt die Gewaltigen vom Thron, und
tamentlichen Briefen. Übrigens ist Lu- erhebt die Niedrigen.
ther die Parallele zum Lied der Hanna in Die Hungrigen füllt er mit Gütern und die
1. Sam.2 durchaus bewusst und er weist Reichen lässt er leer.
auch ausdrücklich darauf hin.3 Er denkt der Barmherzigkeit und hilft sei-
nem Diener Israel auf.
Wie er geredet hat zu unsern Vätern, Abra-
2 Vgl. Heinz Schilling, Martin Luther, S. 255 ham und seinen Kindern in Ewigkeit.
3 Martin Luther, a. a. O., S. 259 u.ö. Lk.1, 46–55
Amt und Gemeinde 9Gott schaut auf das Niedrige willige Wirtin des hohen Gastes“7. So
(Nichtige) legt er Maria in den Mund: „Ich bin nur
die Werkstatt, darinnen Gott wirkt, aber
Schon in der Einleitung bzw. Vorrede geht ich habe nichts zum Werke getan; darum
es Luther darum, die zarte Mutter Gottes, soll mich auch niemand loben oder mir
wie er sie nennt, als jene auf zu zeigen, die Ehre geben, dass ich Gottes Mut-
die Gott in ihrer Niedrigkeit erwählt hat, ter bin worden; sondern Gott und sein
wie Gott überhaupt auf das Kleine, das Werk soll man in mir ehren und loben“8.
Niedrige schaut. Wir Menschen dagegen Hier zeigt sich nun bereits ein deutlicher
schauen nicht gern auf die in der Tiefe, Unterschied zwischen Luthers Marien-
„wo Armut, Schmach, Not, Jammer und verehrung und jene der meisten seiner
Angst ist, da wendet jedermann die Au- Zeitgenossen, von jener in der Gegen-
gen ab“4. Die biblische Maria aus Naza- reformation ganz zu schweigen. „Denn
reth ist keine reiche Tochter, sondern „ein wiewohl sie (Maria) ohne Sünden gewe-
schlichtes Mägdlein … das des Viehes sen, ist doch diese Gnade so vorzüglich“
und des Hauses gewartet“5. Hier setzt der (gemeint ist, die Mutter des Gottessohnes
Reformator Maria gleich mit den jungen zu werden). Und Luther setzt fort, dies
Dienstmägden seiner Zeit. Aber dass Gott noch verstärkend: „Es bedarf wohl auch
gerade sie erwählt hat, ist Gottes Wohltat ein Maß, daß man nicht zu weit treibe
für uns „zu stärken unseren Glauben, zu den Namen, dass man sie eine Königin
trösten alle Geringen, und zu schrecken der Himmel nennt, wiewohl es wahr ist,
alle hohen Menschen auf Erden“.6 aber doch sie dadurch keine Abgöttin ist,
daß sie geben und helfen möge, wie etli-
che meinen, die mehr zu ihr, denn zu Gott
Meine Seele erhebt Gott, rufen und Zuflucht haben. Sie gibt nichts,
den Herrn – macht Gott groß sondern allein Gott“.9
So beginnt das Magnificat und von die-
ser ersten Zeile in der lateinischen Über- Denn er hat die Niedrigkeit /
setzung hat das Lied Marias auch seinen Nichtigkeit seiner Magd
Namen erhalten. Maria bezieht das Groß- angesehen
machen nicht auf sich, das unterstreicht
Martin Luther immer wieder. Sie ist nicht Das lat. Wort humilitas übersetzt der Re-
mehr „denn eine fröhliche Herberg und formator bewusst nicht mit Demut, da-
mit nicht die Meinung entstehe, Maria sei
4 Ebd., S. 228 7 a. a. O., S. 260
5 Martin Luther, a. a. O., S. 228 8 Ebd.
6 a. a. O., S.234 9 a. a. O., S. 258 f.
10 Amt und Gemeindebesonders demütig gewesen und sei da- zu einem weiteren aktuellen Thema sei-
rum auserwählt worden. „Die unnützen ner Zeit: die guten Werke. Er kann nicht
Schwätzer höret sie (Maria) ungern, die umhin, sich auch dazu zu äußern: „Wie-
viel predigen und schreiben von ihrem Ver- wohl jetzt ein greulicher Mißbrauch in der
dienst, damit sie ihre große, eigene Kunst Welt regiert mit Austeilen und Verkaufen
beweisen wollen, und sehen nicht, wie sie guter Werke, da etlich vermessene Geister
das Magnificat dämpfen, die Mutter Got- wollen andern Leuten helfen, sonderlich
tes Lügen strafen und die Gnade Gottes denen, die ohne eigene Gottes Werke le-
verkleinern. Denn so viel würdiges Ver- ben oder sterben, gerade als hätten sie
dienst man ihr zulegt, so viel bricht man guter Werke zu viel. Es wäre zu leiden,
der göttlichen Gnade ab und mindert des wenn sie für andere Leute bäten oder ihre
Magnificats Wahrheit. Der Engel grüßet sie Werke als eine Fürbitte Gott vortrügen..“11
auch nur ‚von Gottes Gnaden‘, und daß der Aber es geht ihnen um ihre Werke. Luther
Herr mit ihr wäre, davon sie gebenedeiet dagegen: „Gott siehet nicht die Werke,
wäre unter allen Weibern. Darum alle die, sondern das Herz an und den Glauben,
so viel Lob und Ehre auf sie treiben und dadurch er auch mit uns wirkt“12.
alles das auf ihr lassen bleiben, sind nicht
weit davon, daß sie einen Abgott aus ihr
machen, gerade als wäre es ihr darum zu Das Magnificat –
tun, daß man sie ehret und zu ihr sich Gu- ein Revolutionslied?
tes versähe, so sie es doch von sich weist
und will Gott in ihr gelobt haben und durch In Relation zu der ausführlichen Bear-
sich jedermann zu guter Zuversicht auf beitung des Lobpreises am Beginn des
Gottes Gnade bringen“10. Maria hat sich Magnificats, vielleicht bereits 1520 ge-
also – so die Magnificat-Auslegung Lu- schrieben, kommt Luther eher kurz und
thers – weder ihrer Jungfrauschaft noch gebündelt zu jenen berühmten Versen,
ihrer Demut gerühmt sondern allein des die in unseren Tagen sowohl in der Be-
gnädigen göttlichen Ansehens. freiungstheologie als auch in der femi-
nistischen als der Hauptinhalt des Liedes
gesehen werden und damit das Magni-
Gottes Werke an Maria ficat als ein Revolutionslied verstehen.
und ihrem Volk Luther erkennt in den vier Versen 6 gött-
liche Werke, die sich Menschen mitunter
Nach dem Gotteslob werden auch seine anmaßen: Weisheit, Gewalt, Reichtum,
Taten (Werke) im Lied gelobt, angefangen Barmherzigkeit, Gericht und Gerechtig-
bei Maria aber dann auch ausgedehnt auf keit. Dabei ist ihm stets bewusst, wem er
viele andere. Das führt den Reformator
11 a. a. O., S. 248 f.
10 Martin Luther, a. a. O., S. 252 f. 12 Ebd.
Amt und Gemeinde 11die Erklärung schreibt. Da sie ja für einen den Namen Israel aus dem Hebräischen
Fürsten bestimmt ist, dem Reichtum ge- und interpretiert Gen.32 – Jakob am Jab-
geben und Gewalt zugeordnet ist, sind es bok – so, dass der neue Name Jakobs das
zunächst Glaubensfragen, die Martin Lu- geistliche Israel bedeutet und also sich
ther aus den Versen herausliest, weniger auch Christen in dem Namen Israel wie-
der äußerliche Reichtum: „Das muß aber derfinden können mit der Conclusio: „Es
auch alles im Glauben erkannt und ausge- ist Israel ein seltsam hoh’ Mysterium“15.
wartet sein. Denn er zerstört die Gewalti- Dann aber folgt der missionarische, ju-
gen so bald nicht, als sie es verdienen; läßt denfreundliche Luther: „Darum soll-
eine Weile sie gehen, bis daß ihre Gewalt ten wir die Juden nicht so unfreundlich
aufs höchste und letzte kommt. So hält behandeln, denn es sind noch Christen
sie dann Gott nicht, so kann sie auch sich unter ihnen zukünftig und werden’s täg-
selbst nicht halten, so vergeht sie in sich lich. Dazu haben sie allein, und nicht wir
selbst ohn’ alles Rumoren und Brechen, Heiden, solche Zusagung, daß allezeit in
und kommen dann empor die Gedrück- Abrahams Samen sollen Christen sein,
ten, auch ohn’ alles Rumoren; denn Gottes die den gebenedeiten Samen erkennen.
Kraft ist in ihnen, die bleibt dann allein, U n s e r e Sache steht auf lauter (bloße)
wenn jene unten sind“13. Freilich kann sich Gnade ohne Zusagen Gottes, wer weiß
Bruder Martinus dabei auch nicht so man- wie und wann. Wenn wir christlich lebten
chen Seitenhieb verkneifen: „Darum sind und sie mit Güte zu Christus brächten, das
die Gelehrten, die heiligen Gleißner, die wäre wohl die rechte Weise. Wer wollte
großen Herren, die Reichen des Teufels Christ werden, wenn er siehet Christen
Leckerbißlein. Daher kommt’s, daß man so unchristlich mit Menschen umgehen?
mit rechter Wahrheit sagt: die Gelehrten- Nicht also, liebe Christen, man sage ih-
die Verkehrten. Ein Fürst: Wildpret im nen gütlich die Wahrheit; wollen sie nicht,
Himmel. Hier reich, dort arm.“14 laß sie fahren. Wie viele sind Christen,
die Christum nicht achten, hören seine
Worte auch nicht, ärger als Heiden und
Maria, eine Frau aus Juden, und (wir) lassen sie doch mit Frie-
dem jüdischen Volk den gehen, ja fallen ihnen zu Füßen, beten
sie schier als einen Abgott an?“16 Damit
Der Schluss des Magnificats zeigt Maria scheint Luther bereits anklingen zu las-
als Mirjam von Nazareth, als Tochter ih- sen, dass das Magnificat auch eine Brücke
res Volkes Israel, als Jüdin. Luther scheut zum jüdischen Urgrund des christlichen
sich nicht, zu diesen Versen über Israel Glaubens sein kann.
und die Juden zu schreiben. So deutet er
13 Martin Luther, a. a. O., S.277 15 a. a. O., S.286
14 a. a. O., S.278 16 Martin Luther, a. a. O.,S.290
12 Amt und GemeindeZusammenfassung Durch die Jahrhunderte nach Luther
hat das Magnificat Dichter und Kompo-
Luthers Marienfrömmigkeit war nicht das nisten angeregt, es umzuschreiben, aus-
Produkt von Polemik oder einer auf Un- zugestalten und musikalisch umzusetzen.
terscheidung ausgerichteten Kontrovers- Ich möchte schließen mit einem eher un-
theologie. Zu einer Figur konfessioneller bekannten Zitat Dietrich Bonhoeffers aus
Trennung, ja Feindseligkeit wurde die Got- dem 20. Jahrhundert: „Das Lied der Ma-
tesmutter erst nach Luthers Tod, als sie die ria ist das leidenschaftlichste, wildeste, ja
katholische Marienverehrung an die Spitze man könnte fast sagen: das revolutionärste
des barocken Heiligenhimmels erhob, wie Adventlied, das je gesungen wurde. Es ist
sich das zu Luthers Zeiten ja schon andeu- nicht die sanfte, zärtliche, verträumte Ma-
tete, und im Gegenzug die protestantische ria, wie wir sie auf Bildern sehen, sondern
Orthodoxie in dieser heiligen Maria eines es ist die leidenschaftliche, hingerissene,
ihrer liebsten Feindbilder entdeckte. Die stolze, begeisterte Maria, die da spricht
Spur Marias, die prägend durch die Jahr- … ein hartes, starkes Lied von stürzen-
hunderte verläuft, ist nach wie vor, so die den Thronen und gedemütigten Herren
evangelische Überzeugung, am besten in dieser Welt, von Gottes Gewalt und von
der Bibel zu finden. Manche Ausformun- der Menschen Ohnmacht“18. Das wagte
gen der Marienfrömmigkeit, wie Mariener- in dieser Klarheit Bruder Martinus sei-
scheinungen und marianische Prophezei- nem jungen Fürsten nicht zu schreiben
ungen, gehen über das biblische Zeugnis – man bedenke die völlig anderen Zeit-
weit hinaus und müssen von dort her auch umstände –, aber vielleicht war es auch
in Frage gestellt werden. Noch bedrängen- seine stille Hoffnung. ■
der aber wirkt die triumphalistische Form
der Marienverehrung, die meist an eine
antiprotestantische Haltung gekoppelt war Literatur
und politische Auswirkungen implizierte, Heinz Schilling, Martin Luther, Rebell in einer Zeit
wie etwa das Aufstellen von Mariensäulen des Umbruchs, 3.Aufl., München 2014.
im 18. Jhdt. im Habsburgerreich, das den Ingeborg Schödl, Mythos Mariazell, Graz 2007.
Sieg über Türken, Pest und Protestanten
demonstrieren sollte. Diese historischen Alle Lutherzitate nach:
Verdunkelungen, die mitunter auch eine Martin Luther, Ausgewählte Werke, Bd.6, Das Mag-
unheilige Allianz mit frauenfeindlichen nificat, hrsg. H. H. Borchedt u. G. Merz, 2. Aufl.,
Diskriminierungen eingegangen sind, ma- München 1938.
chen es evangelischen Menschen mitunter
schwer, in Maria eine Kirchen verbindende
Schwester im Glauben zu erkennen.17
17 Vgl. Ingeborg Schödl, Mythos Mariazell, S 128 f. 18 Wikipedia, Magnifikat
Amt und Gemeinde 13 LUTHER IM O-TON
Luther und die Freiheit1
Von Ulrich H. J. Körtner
„Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle
Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist
ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann
untertan.“
1. Martin Luther – rios. Und tatsächlich hat sich Luther zeit-
ein Befreiter weilig Martinus Eleutherius genannt, be-
vor der diesen Namen eindeutschte.2 Er
Martin1 Luther kam am 10. November wusste sich durch Christus und den Glau-
1483 im Eisleben als Martin Luder zur ben an ihn befreit von Sünde, Tod und
Welt, Sohn des Bergwerkpächters Hans Teufel, vom richtenden und strafenden
Luder und seiner Gattin Margarete. Nach-
dem er zu seinem reformatorischen Glau-
ben gefunden hatte, änderte er seinen Na- 2 Vgl. Bernd Moeller/Karl Stackmann, Luder –
men zu „Luther“. Dieser leitet sich vom Luther – Eleutherius. Erwägungen zu Luthers
Namen, Göttingen 1981. Der Germanistik Jürgen
griechischen eleútheros ab, das man mit Udolph mutmaßt hingegen, daß Luther lediglich den
„frei“ übersetzt. Luder – der freie, besser anrüchig klingenden Namen „Luder“ durch seine
hochdeutsche Form ersetzt habe, um den möglichen
gesagt, der Befreite – griechisch eleuthé- Namen seines Familiennamens zu tilgen. Vgl. Jürgen
Udolph, Martinus Luder – Eleutherius – Martin Lu-
ther. Warum änderte Martin Luther seinen Namen?,
1 Gewidmet Ingrid Vogel zum 65. Geburtstag. Heildeberg 2016. Daß sich Gelehrte ihren Namen
Vortrag auf dem Symposium „Luther im O-Ton“ am gräzisierten oder latinisierten, war in der Zeit des
21.1.2017 in der Evangelischen Pfarrgemeinde A. B. Humanismus eine verbreitete Praxis. Philipp Melan-
Wien-Hetzendorf. chthon etwa hießt eigentlich Philipp Schwartzerdt.
14 Amt und GemeindeGott, von aller Schuld und Angst, die Lu- ihm also die reformatorische Erleuchtung
ther mehr als ein Jahrzehnt gequält hatten. auf dem Klo,6 und die Befreiung vollzog
Gegen den Willen seines Vaters, der ihn sich dort im übertragenen wie im buch-
zu einer Juristenlaufbahn bestimmt hatte, stäblichen Sinne.
war Luther im Juli 1505 in Erfurt in das Wann das Ereignis, das als Turmerleb-
Kloster der Augustiner-Eremiten eingetre- nis in die Geschichtsschreibung einge-
ten. 1511 übersiedelte Luther nach Witten- gangen ist, tatsächlich stattgefunden hat,
berg, wo er ein Jahr später die Nachfolge ist bis heute umstritten. Die Datierungs-
seines geistlichen Vaters und Seelsorgers vorschläge reichen von 1515 bis 1518.
Johannes von Staupitz (ca. 1468–1524) Nimmt man die späte Datierung an, hätte
als Professor für Bibelauslegung antrat.3 Luther seine Ablassthesen vom 31. Okto-
Staupitz hatte großen Einfluss auf die re- ber 1517, die zum Fanal der Reformation
formatorische Wende im Leben Luthers. wurden, also noch vor seiner eigentli-
Entscheidende Gedanken Luthers finden chen reformatorischen Entdeckung veröf-
sich bereits in den Schriften seines Leh- fentlicht. Dafür, dass die reformatorische
rers und väterlichen Freundes. Doch die Wende in Luthers Leben doch schon vor
entscheidende Wende im Leben Luthers er- Abfassung der Ablassthesen stattgefunden
eignete sich, so hat er es selbst etliche Jahre hat, spricht allerdings, dass Luther einen
später berichtet, als er einmal mehr den Rö- unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung
merbrief las und ihm plötzlich der Sinn des verfassten Brief, der vom 11. November
Pauluswortes in Römer 1,17 neu aufging: 1517 datiert, mit „Martinus Eleutherius“
„Denn darin wird offenbart die Gerech- unterzeichnet hat. Noch 27 weitere Briefe
tigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt unterschrieb Luther mit diesem Namen.
aus Glauben in Glauben,4 wie geschrieben Er brachte so sein neues Selbstver-
steht: ‚Der Gerechte wird aus Glauben le- ständnis zum Ausdruck. Ganz im Sinne
ben.‘“ – „Da riß ich hindurch“,5 erinnert von 1. Korinther 7,22 verstand sich Luther
sich Luther rückblickend. Nach eigenem fortan dadurch befreit, dass er zum Skla-
Bekunden hatte Luther diese Erleuchtung ven Christi geworden war. Nur wer zum
im Turm des Schwarzen Klosters, das spä- Knecht Christi wird, findet die wahre Frei-
ter zu seinem Wohnhaus wurde, in dem ein heit, wie schon Paulus an der genannten
Raum als Toilette diente. Wie Luther nicht Stelle schreibt: „Wer als Knecht berufen
ohne ironischen Unterton anmerkt, kam ist in dem Herrn, der ist ein Freigelasse-
ner des Herrn; desgleichen wer als Freier
3 Staupitz zog sich 1520 von seinem Amt als General- berufen ist, der ist ein Knecht Christi.“
vikar der Augustinereremiten zurück und trat in das
Benediktinerkloster St. Peter in Salzburg ein, wo er
Freiheit wurde so zum Leitmotiv des
1524 starb. Lebens und Wirkens Luthers, ganz so, wie
4 Wörtlich heißt es im griechischen Text: „aus Glauben er es 1520 in seiner Programmschrift „Von
zum Glauben“.
5 Martin Luther, Ausgewählte Werke, hg. v. Heinrich
Borcherdt, Bd. 8, München 1925, S. 27. 6 Vgl. WA Tr 3, 228,23.
Amt und Gemeinde 15der Freiheit eines Christenmenschen“ aus- Petrus sagt 1.Petr. 2,9: ‚Ihr seid ein prie-
geführt hat. Die Freiheit, von der Luther sterliches Königreich und ein königliches
spricht, hat im Glauben an Jesus Chri- Priestertum.‘ Und das geht so zu, daß ein
stus ihren Grund. Sein Turmerlebnis war, Christenmensch durch den Glauben so
wie sein Biograph Joachim Köhler tref- hoch über alle Dinge erhoben wird, daß
fend formuliert, „nicht in erster Linie der er geistlich ein Herr aller Dinge wird“9.
Durchbruch zu einem neuen Glauben,
sondern die Erfahrung des Glaubens als Treffend hat Johann Gottlieb Fichte das
Durchbruch“7. Es ist Erfahrung, durch Christentum als „Evangelium der Frei-
Christus zur Freiheit befreit zu sein, wie heit und Gleichheit“ charakterisiert.10 Auf
Paulus in Galater 5,1 schreibt. 1519 und diese Formel lässt sich der Ertrag der Re-
1531 hat Luther den Galaterbrief aus- formation bringen, und Fichte wollte sie
führlich kommentiert. Darum kann Lu- nicht nur im metaphysischen, sondern
ther auch sagen: „Christen heißen Freie“8. auch im bürgerlichen Sinne verstanden
wissen. Tatsächlich hat die Reformation
nicht nur religiöse, sondern auch poli-
2. Das Evangelium tische und gesellschaftliche Umbrüche
der Freiheit hervorgerufen, die bis heute nachwirken.
Sie war eine Befreiungsbewegung, in der
Luthers reformatorische Entdeckung be- es um die Freiheit von klerikaler Bevor-
stand darin, dass biblische Evangelium mundung ebenso ging wie um politische
von Jesus Christus neu und konsequent und soziale Freiheiten.
als Botschaft der Freiheit zu hören und zu Die Aufklärung wertete die Reforma-
verstehen. Das Evangelium der Freiheit tion trotz aller Kritik als eine Entwick-
ist zugleich ein Evangelium der Gleich- lungsstufe auf dem Weg zur Freiheit des
heit. Die christliche Freiheit verbindet Geistes und aus der selbstverschuldeten
sich nämlich nach Luther mit dem Pries- Unmündigkeit des Menschen. In ihr sah
tertum aller Gläubigen. Wir lesen dazu in Hegel den Vorschein der „absoluten Reli-
seiner Freiheitsschrift: gion“, welche zugleich eine Religion der
„Wie nun Christus die Erstgeburt hatte
mit ihrer Ehre und Würde, so teilt er sie
mit allen seinen Christen, so daß sie 9 Martin Luther, Von der Freiheit eines Christenmen-
durch den Glauben auch alle Könige und schen, zitiert nach: Martin Luther, Ausgewählte
Schriften, hg. v. Karin Bornkamm u. Gerhard Ebe-
Priester mit Christus sein müssen, wie St. ling, Bd. 1, Frankfurt a. M. 1982, S. 238–263, hier
S. 248.
10 Johann Gottlieb Fichte, Zur Rechts- und Sittenlehre
7 Joachim Köhler, Luther! Biographie eins Befreiten, II (Fichtes Werke IV, hg. v. Immanuel Hermann
Leipzig 2016, S. 188 f. Fichte), Nachdruck Berlin 1971, S. 523. Es handelt
8 Vgl. Thorsten Jacobi, „Christen heißen Freie“. sich um ein Zitat aus Fichtes Vorlesungen über „Die
Luthers Freiheitsaussagen in den Jahren 1515–1519 Staatslehre, oder über das Verhältniss des Urstaates
(BHTh 101), Tübingen 1997. zum Vernunftreiche“ (1813).
16 Amt und GemeindeWahrheit und der Freiheit sei.11 Allerdings und Wünschen dienstbar zu machen. Das
deutete Hegel die Reformation lediglich Gleiche geschieht in der Religion, wenn
als Etappe eines geistesgeschichtlichen der Mensch versucht, auch Gott seinen
Prozesses, an dessen Ende die Aufhebung eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen
der Religion in die Philosophie stehen zu unterwerfen. Auf uns selbst zurückge-
würde, so dass die Reformation nach sei- worfen und fixiert, sind wir im Grunde
nem Verständnis über sich hinaus wies. einsame Wesen, die einander die Liebe
Der linke Flügel der Hegelschule deutete schuldig bleiben und Gott als den Grund
die Reformation als Vorstufe der bürger- unseres Daseins verleugnen. Aus dieser
lichen und dann der kommunistischen Einsamkeit und Selbstfixiertheit werden
Revolution, deren Ziel ein utopisches wir nach Luther durch Jesus Christus be-
Reich der Freiheit war. Auch die Befrei- freit. Wo das einsame und um sich selbst
ungstheologie des 20. und 21. Jahrhun- besorgte Ich ist, soll Christus werden, der
derts begreift die Reformation und ihre uns für Gott und den Mitmenschen öff-
Theologie als eine Form der politischen net. Durch Christus, so Luther, werden
Theologie. Leonardo Boff würdigt den die Menschen zu einem Glauben befreit,
historischen Protestantismus als Förde- der Gott bedingungslos im Leben und im
rer der bürgerlichen Freiheit, Luther als Sterben vertraut, weil er sich von Gott
Befreier in der Kirche und Reformator bedingungslos angenommen weiß. Gott,
in der Gesellschaft und sieht im Erbe der so Luther, liebt uns Menschen ohne Vor-
Reformation einen Faktor zur Befreiung leistungen und senkt die Liebe zu ihm
der Unterdrückten in der Gegenwart.12 und unseren Mitmenschen in unser Herz.
Die Pointe von Luthers Freiheitsver- Im Vergleich mit heutigen Freiheits-
ständnis liegt freilich darin, dass der diskursen fällt auf, dass für Luther die
Mensch nicht etwa zu sich selbst, sondern Frage, ob der Mensch frei oder unfrei
von sich selbst befreit werden muss. Nicht ist, zu kurz greift, sofern sie Freiheit ein-
in kirchlichen oder politischen Freiheits- fach mit Willensfreiheit gleichsetzt. Im
forderungen, sondern in der Rechtferti- Gegenteil hat die Freiheitserfahrung ei-
gungslehre liegt das Zentrum der Frei- nes Christenmenschen die Unfreiheit des
heitslehre Luthers. Von Hause aus ist der menschlichen Willens zur Voraussetzung.
Mensch stets um sich selbst besorgt. Er Diese aber ist nicht im Sinne eines onto-
kreist um sich und neigt dazu, auch die üb- logischen oder metaphysischen Determi-
rigen Menschen seinen eigenen Zwecken nismus zu verstehen, sondern als Ergebnis
eines Freiheitsverlustes, der als Folge der
Sünde gedeutet wird. Es sind konkrete
11 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über
die Philosophie der Religion. Nebst einer Schrift Erfahrungen des Verlustes und der Ge-
über die Beweise vom Daseyn Gottes, hg. v. Philipp fährdung menschlicher Freiheit, die das
Marheineke (Werke XII), Berlin 1832, S. 167.
12 Leonardo Boff, Und die Kirche ist Volk geworden.
theologische Nachdenken über das Wesen
Ekklesiogenesis, Düsseldorf 1987, S. 201 ff. menschlicher Freiheit motivieren. Freiheit
Amt und Gemeinde 17kann nicht nur missbraucht, sie kann auch der Selbstsorge um das eigene Dasein. Wer
verspielt werden. Sie wird nicht aus neu- nur um sich selbst besorgt ist, ist unfrei und
traler Beobachterperspektive behauptet auf sich selbst fixiert. Er ist, wie Luther
oder bestritten, sondern aus der Sicht des sagt, in sich selbst gekrümmt (lateinisch:
Glaubens bezeugt und zugesprochen. Es homo incurvatus in seipsum). Der Vorgang
geht Luther nicht um eine formale Frei- der Befreiung aus dieser Selbstverkrüm-
heitsbehauptung, sondern um existentiel- mung wird im Anschluss an Paulus als
len Freiheitsgewinn. Rechtfertigungsgeschehen gedeutet. Der
Wird das Heilsgeschehen als Befrei- Mensch kann sich aus der selbstverschul-
ungsgeschehen gedeutet, setzt dies vor- deten Unfreiheit der Sünde nicht selbst
aus, dass der Mensch von Hause aus un- befreien, sondern einzig durch Gott befreit
frei ist. Im christlichen Kontext wird die werden. Die Freiheit des Glaubens ist zu-
menschliche Freiheit zunächst unter den gesprochene Freiheit, die immer wieder
Bedingungen ihres faktischen Verlustes neu im Hören der befreienden Botschaft
thematisch, für den der Begriff der Sünde des Evangeliums anzueignen ist. Endgültig
steht. Selbst dort, wo sich der Mensch besteht diese Freiheit erst im Reich Gottes.
frei in seinen Entscheidungen und seiner Die fragmentarischen Freiheitserfahrun-
Lebensführung wähnt, ist er nach refor- gen, die die Glaubenden in ihrem Leben
matorischer Auffassung unfrei, weil – be- machen, sind der Grund für die eschato-
wusst oder unbewusst – in der Negation logische Hoffnung auf vollendete Freiheit.
Gottes gefangen. Die reformatorische
Rechtfertigungs- und Freiheitslehre hat
als Kehrseite eine radikale Lehre von der 3. Von der Freiheit eines
Unfreiheit des Menschen. Christenmenschen
Wahre Freiheit besteht in der Befrei-
ung des Menschen von seiner Sünde durch Sein Verständnis christlicher Freiheit fasst
Gott, und das heißt im Sinne Luthers und Luther in seiner Freiheitsschrift von 1520,
der übrigen Reformatoren: in der Befrei- die an Papst Leo X. adressiert ist, in einer
ung vom Unglauben. Glaube bedeutet nach paradox anmutenden Doppelthese zusam-
Luther, Gott über alle Dinge fürchten, lie- men. Sie lautet:
ben und vertrauen.13 Der Unglaube ist das „Ein Christenmensch ist ein freier Herr
Gegenteil. Die Befreiung vom Unglauben über alle Dinge und niemand untertan.
bedeutet also die Befreiung zu einem un- Ein Christenmensch ist ein dienstba-
bedingten Vertrauen auf Gott als tragen- rer Knecht aller Dinge und jedermann
dem Grund unseres Daseins. Und die so untertan.“14
gewonnene Freiheit meint die Freiheit von
14 WA 7,21 (modernisierte Fassung). Luther beruft sich
13 Vgl. Luthers Auslegung des 1. Gebotes im Kleinen für diese zweifache These auf 1Kor 9,19; Röm 13,8
Katechismus. und Gal 4,4.
18 Amt und GemeindeLuther beruft sich für diesen Doppel- Freiheitsschrift von 1520 wiederum der-
satz auf Paulus, der in 1. Korinther 9,19 jenigen zwischen Glaube und Werken.
schreibt: „Obwohl ich frei bin von jeder- Dort lesen wir:
mann, habe ich mich selbst doch jeder- „So nehmen wir uns den inwendigen,
mann zum Knecht gemacht, damit ich geistlichen Menschen vor, um zu sehen,
möglichst viele gewinne“. Außerdem zi- was dazu gehört, damit er ein frommer,
tiert Luther Römer 13,8: „Seid niemand freier Christenmensch ist und heißt. Es
etwas schuldig, außer, dass ihr euch un- ist ja offenbar, daß kein äußerliches
tereinander liebt“. „Liebe aber“, so kom- Ding ihn frei oder fromm machen kann,
mentiert Luther, „die ist dienstbar und wie es auch immer genannt werden mag;
untertan dem, das sie lieb hat“15. denn seine Frommheit und Freiheit, wie-
Der Widerspruch zwischen Freiheit derum seine Bosheit und sein Gefängnis
und Dienstbarkeit des Glaubens lässt sich sind weder leiblich noch äußerlich. Was
nach Luther nur verstehen, wenn man be- hilft es der Seele, daß der Leib ungefan-
achtet, dass jeder Christenmensch „von gen, frisch und gesund ist, ißt, trinkt,
zweierlei Natur“, nämlich „geistlicher lebt, wie er will? Wiederum, was scha-
und leiblicher“ ist.16 Die anthropologi- det es der Seele, daß der Leib gefangen,
sche Unterscheidung zwischen geistli- krank und matt ist, hungert, dürstet und
cher und leiblicher Natur ist bei Luther leidet alles, wie er nicht gern will? Von
allerdings nicht allgemein ontologisch ge- diesen Dingen reicht keines bis an die
meint – etwa im Sinne eines platonischen Seele, um die zu befreien oder zu fan-
Leib-Seele-Dualismus – gemeint, sondern gen, sie fromm oder böse zu machen.“18
streng soteriologisch, also auf das Heil
des Menschen bezogen. Sie entspricht „So hilft es der Seele nichts, wenn der Leib
der eschatologischen Unterscheidung heilige Kleider anlegt, wie es die Priester
zwischen altem und neuem Menschen. und Geistlichen tun; auch nicht, wenn er
Ganz so ist bei Luther auch die Unter- in den Kirchen und an den heiligen Stät-
scheidung zwischen innerem und äuße- ten ist; auch nicht, wenn er leiblich betet,
rem Menschen zu verstehen. Der Begriff fastet, wallfahrtet und alle guten Werke
„Seele“ steht für den geistlichen, neuen, tut, die nur immer durch den Leib und
innerlichen Menschen, der Begriff „Leib“ in dem Leibe geschehen können. Es muß
für den alten und äußerlichen Menschen noch alles etwas ganz anderes sein, was
aus Fleisch und Blut.17 Die Unterschei- der Seele Frommheit und Freiheit bringt
dung zwischen geistlichem und äußer- und gibt. Denn all diese oben genannten
lichem Menschen entspricht in Luthers Stücke, Werke und Weisen kann auch ein
böser Mensch, ein Gleisner und Heuch-
15 M. Luther, a. a. O. (Anm. 9), S. 239. ler an sich haben und ausüben. Durch
16 WA 7,21.
17 WA 7,21. 18 A. a. O. (Anm. 9), S. 239 f.
Amt und Gemeinde 19solch ein Treiben wird auch kein anderes sie auch keines anderen Dinges mehr,
Volk als eitel Gleisner werden. Wiederum sondern sie hat in dem Wort Genüge,
schadet es der Seele nichts, wenn der Leib Speise, Freude, Frieden, Licht, Kunst,
unheilige Kleider trägt, an unheiligen Or- Gerechtigkeit, Wahrheit, Weisheit, Frei-
ten ist, ißt, trinkt, wallfahrtet, nicht betet heit und alles Gut überschwenglich. […]
und alle die Werke anstehen läßt, die die Und Christus ist um keines anderen Am-
oben genannten Gleisner tun.“19 tes willen gekommen, als das Wort Got-
tes zu predigen. […] Fragst du aber: Was
Die Doppelthese Luthers und die mit ihr ist denn das Wort, das so große Gnade
verbundenen begrifflichen Unterscheidun- gibt, wie soll ich es gebrauchen? , dann
gen setzen voraus, dass der Mensch so- lautet die Antwort: Es ist nichts anderes
wohl leiblich als auch seelisch bzw. geist- als die von Christus geschehene Predigt,
lich existiert. Den Leib bezeichnet Luther wie sie das Evangelium enthält.“21
ausdrücklich als den Leib der Seele. Er
ist „ihr eigen Leib“.20 Leib und Seele sind Wie Christus das Ende des Gesetzes ist,
nach Luther zwar nicht zu trennen, wohl so auch das Ende jeder Werkgerechtigkeit.
aber unbedingt zu unterscheiden. Dem-
entsprechend muss auch die Freiheit oder „Darum soll das billig aller Christen
Unfreiheit des inwendigen Menschen bzw. einziges Werk und einzige Übung sein,
der Seele von der Freiheit oder Unfreiheit daß sie das Wort und Christus wohl in
des äußeren Menschen unterschieden wer- sich bilden, um solchen Glauben stetig
den. Nach Luther bedeutet dies aber, dass zu üben und zu stärken.“22
der äußere Mensch bzw. die Sphäre des
Leiblichen den seelischen oder geistlichen „So sehen wir, daß ein Christenmensch
Zustand des inneren Menschen weder po- an dem Glauben genug hat; er bedarf
sitiv noch negativ beeinflussen kann. In keines Werkes, damit er fromm sei. Be-
soteriologischer Hinsicht kann dies allein darf er denn keines Werkes mehr, so ist
der von Gott geschenkte Glaube, zu dem er gewiß entbunden von allen Geboten
der sündige Mensch von sich aus nicht und Gesetzen. Ist er entbunden, so ist er
fähig ist. Fromm, frei und ein Christ wird gewiß frei. Das ist die christliche Frei-
der Mensch allein durch das Evangelium. heit, der einzige Glaube, der da macht,
„So müssen wir nun gewiß sein, daß die daß wir nicht müßig gehen oder übel
Seele alle Dinge entbehren kann, ausge- tun, sondern daß wir keines Werkes zur
nommen das Wort Gottes, und ohne das Frommheit und um Seligkeit zu erlangen
Wort Gottes ist ihr kein Ding geholfen. bedürfen.“23
Wenn sie aber das Wort hat, dann bedarf
21 A. a. O. (Anm. 9), S. 240 f.
19 A. a. O. (Anm. 9), S. 240. 22 A. a. O. (Anm. 9), S. 242
20 WA 7,31. 23 A. a. O. (Anm. 9), S. 244.
20 Amt und GemeindeDie Freiheit des Glaubens besteht also Christus es mir geworden ist, und nichts weder im Müßiggang noch in der Untätig- mehr tun als das, wovon ich sehe, daß keit. Der Glaube befreit im Gegenteil zu es ihm not, nützlich und selig ist, weil einem tätigen Leben, das nun aber nicht ich doch durch meinen Glauben in al- länger als Zwang, sondern als Verwirkli- len Dingen in Christus genug habe.“24 chung der neu gewonnenen Freiheit ver- standen wird. Die Werke beziehen sich Wir können auch sagen: Die durch Chris- nicht auf den inwendigen, sondern auf den tus geschenkte Freiheit äußert sich als äußeren Menschen. Im Medium seines Selbstvergessenheit. Gemeint ist nicht Leibes existiert der Mensch nicht nur für eine problematische Selbstlosigkeit im sich allein, sondern unter seinen Mitmen- Sinne der völligen Selbstverleugnung. schen. Die Werke des äußeren Menschen Schließlich besagt das Doppelgebot der in Raum und Zeit sollen einerseits der Liebe, dass wir Gott und den Nächsten Unterwerfung des Leibes unter den Geist lieben sollen wie uns selbst. Wer sich von dienen und andererseits auf das Wohl des Gott bedingungslos angenommen weiß, Nächsten gerichtet sein. der darf und kann sich selbst lieben – frei- Dies wird wiederum christologisch be- lich nicht auf egoistische Weise, sondern gründet. Wie Gott durch Christus umsonst eben in der Form der Selbstvergessen- geholfen hat, soll der Christenmensch heit, die von sich absehen kann, weil der mit seinem Leib und seinen Werken dem Mensch um seine Annahme und Anerken- Nächsten dienen. Einzig in dieser Hinsicht nung nicht länger besorgt sein muss. In – hier aber sehr wohl – gilt nach Luther, der Selbstvergessenheit liegt das Moment dass der Christenmensch ein dienstba- der Umkehr aus der Selbstverkrümmung, rer Knecht aller Dinge und jedermann die Luther schon in seinen 95 Thesen von untertan sein soll. Der Glaubende soll 1517 als lebenslange Buße bezeichnet hat. so denken: Weil die von Gott neu geschenkte Frei- „Wohlan, mein Gott hat mir unwürdi- heit nach Luther stets externe Gabe bleibt gem, verdammtem Menschen ohne alle und niemals ein innerer Besitz oder Ha- Verdienste, rein umsonst und aus eitel bitus wird, hält er die zum Beispiel bei Barmherzigkeit, durch und in Christus Thomas von Aquin intensiv diskutierte den vollen Reichtum aller Frommheit Frage nach dem Ort eines solchen Gna- und Seligkeit gegeben, so daß ich hinfort denhabitus in der menschlichen Psyche nichts mehr bedarf als zu glauben, daß für verfehlt. Es ist der Mensch als ganzer, es so sei. Ei, so will ich solchem Vater, der durch das Gnadengeschehen umge- der mich mit seinen überschwenglichen wandelt wird, weshalb Luther den Person- Gütern so überschüttet hat, wiederum begriff anstelle des Seelenbegriffs bevor- frei, fröhlich und umsonst tun, was ihm wohlgefällt, und meinem Nächsten ge- genüber auch ein Christ werden, so wie 24 A. a. O. (Anm. 9), S. 260. Amt und Gemeinde 21
zugt, wobei zwischen Person und Werk ternativen zum Besseren entdecken und
streng unterschieden wird.25 nutzen zu können.“26
Als lebendige, „beseelte“ Person wird Die Phänomenologie der Freiheit des
ein und derselbe Mensch als ganzer einer Philosophen Peter Bieri ist auch für das
doppelten Betrachtung unterzogen. Das theologische Nachdenken erhellend.27 Das
Menschsein des einen Menschen lässt sich gilt nicht nur für seine Analyse von Er-
theologisch nur betrachten, indem zwei fahrungen der Unfreiheit.28 Auch sonst
nicht aufeinander abbildbare Perspekti- bestehen zwischen seinem und Luthers
ven komplementär aufeinander bezogen Freiheitsverständnis gewisse Paralle-
werden. Es ist die Komplementarität der len. Denn wie für Bieris Verständnis von
gegensätzlichen Perspektiven, in denen Willensfreiheit gilt auch für die Freiheit
jeweils der Mensch als ganzer betrach- des Glaubens bei Luther, dass sie keine
tet wird, die in der Paradoxie jener Dop- unbedingte, sondern eine bedingte Frei-
pelthese von der Freiheit und Unfreiheit heit ist.29 Insofern ist allerdings Walthers
des Christenmenschen ihren sprachlich Rede von deterministischen Zwängen,
adäquaten Ausdruck findet. denen der Glaube sich nicht unterwerfen
müsse, missverständlich oder zumindest
erklärungsbedürftig. Freiheit von subjek-
4. Bedingte Freiheit tiv erfahrbaren Zwängen bedeutet weder
bei Bieri noch bei Luther, dass eine inde-
Der evangelische Theologe Christian terministische Freiheitstheorie vertreten
Walther schlägt vor, die christliche Frei- wird. Beide Autoren stimmen nämlich
heit im Sinne Immanuel Kants als eine darin überein, dass die Idee einer unbe-
transzendentale Freiheit zu verstehen, „die dingten Freiheit nicht nur illusorisch, son-
dem der glaubt, gleichsam im Rücken dern widersprüchlich und logisch inkon-
steht. Kausal wird sie nicht verrechnet sistent ist.30
werden können. Aber als Bestandteil ei-
ner Rückbindung, die der Glaube ja ist
[…], wird die Freiheit des Glaubens zum
26 Christian Walther, Strukturwandel der Freiheit. Ge-
Grund, sich nicht einfach deterministi- danken zu einer aktuellen Kontroverse, in: Zeitschrift
schen Zwängen unterwerfen zu müssen. für Evangelische Ethik 48, 2004, S. 267–277, hier
S. 275. Vgl. Peter Bieri, Das Handwerk der Freiheit.
Vielmehr wird sie zum Impuls, das Hand- Über die Entdeckung des eigenen Willens, Frank-
werk der Freiheit im Sinne [Peter] Bieris furt a. M. 22004.
zu entwickeln und zu fördern, um so Al- 27 Bieri bezieht sich stark auf die Arbeiten Harry
G. Frankfurts, dessen Ideen er aber erheblich
modifiziert. Vgl. Harry G. Frankfurt, Freiheit und
Selbstbestimmung, hg. v. Monika Betzler u. Barbara
Guckes (Polis, Bd. 1), Berlin 2001.
28 Vgl. P. Bieri, a. a. O. (Anm. 25), S. 84 ff.
25 Siehe dazu Gerhard Ebeling, Luther. Einführung in 29 Vgl. P. Bieri, a. a. O. (Anm. 25), S. 29 ff.
sein Denken, Tübingen 41981, S. 175 f. 30 Vgl. P. Bieri, a. a. O. (Anm. 25), S. 165 ff.
22 Amt und GemeindeSystematisch-theologisch hat das Freiheit. Wie die Freiheit, so ist Bieri zu-
auch Friedrich Schleiermacher überzeu- folge auch das Selbst, von dem diese Frei-
gend nachgewiesen. Wer behauptet, ein heit ausgesagt wird, „ein vorübergehen-
schlechthinniges Freiheitsgefühl zu ha- des Gebilde auf schwankendem Grund,
ben, „der täuscht entweder sich selbst, und es gehört zu den Voraussetzungen
oder er trennt, was notwendig zusammen- für Willensfreiheit, diese einfache und ei-
gehört. Denn sagt das Freiheitsgefühl eine gentlich offensichtliche Tatsache anzuer-
aus uns herausgehende Selbsttätigkeit aus: kennen, genauso wie die Tatsache, dass es
so muss diese einen Gegenstand haben, Zeiten gibt, in denen wir weder autonom
der uns irgendwie gegeben worden ist, sind noch das Gegenteil.“32 Christlich ge-
welches aber nicht hat geschehen kön- sprochen gründet das Selbst nicht in sich
nen ohne eine Einwirkung desselben auf selbst, sondern extern in Christus und der
unsere Empfänglichkeit, in jedem sol- durch ihn vermittelten Beziehung Gottes
chen Falle ist daher ein zu dem Freiheits- zum Menschen. Als extern zugespielte
gefühl gehöriges Abhängigkeitsgefühl kann auch die Freiheit des Christenmen-
mitgesetzt, und also jenes durch dieses schen nur angeeignet werden, ohne je zu
begrenzt.“31 Unbedingte oder schlecht- einem festen Besitz zu werden. Dement-
hinnige Freiheit lässt sich nicht vernünf- sprechend lässt sich der Glaube, der aus
tig denken. Soll Freiheit wirklich meine dem Hören des Evangeliums kommt,33
Freiheit, soll der Wille tatsächlich mein als Aneignung der Freiheit interpretieren.
eigener Wille sein, gibt es Freiheit immer Als göttliche Gabe ist der Glaube un-
nur als bestimmte, d. h. aber als bedingte verfügbar, das heißt kontingent. Mit Bieris
Freiheit. Menschliche Freiheit, d. h. die Idee der bedingten und angeeigneten Frei-
von einem Menschen behauptete, von ihm heit berührt sich der Gedanke insofern,
beanspruchte oder ihm zugeschriebene als Bieri mit einer gewissen Überspit-
Freiheit ist verwoben mit seiner konkreten zung sagt: „Willensfreiheit ist ein Stück
Lebensgeschichte und seinen Lebensum- weit Glückssache.“34 Worin sich Bieris
ständen. Phänomenologie der Freiheit und Luthers
Nach Luthers Auffassung ist mensch- Freiheitsverständnis jedoch gravierend
liche Freiheit nicht nur bedingt, sondern unterscheiden, ist die Behauptung Bieris,
stets angeeignete Freiheit. Darin stimmt „daß die Freiheit des Willens etwas ist,
Bieris philosophische Freiheitstheorie mit das man sich erarbeiten muß“.35 So ver-
ihm überein. Angeeignete Freiheit aber standen wäre der Glaube als Aneignung
ist verstandene und willentlich gebilligte der Freiheit ein Werk und nach Luthers
31 Friedrich Schleiermacher, Der christliche Glaube 32 P. Bieri, a. a. O. (Anm. 25), S. 423.
nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im 33 Vgl. Röm 10,17.
Zusammenhange dargestellt (21830), hg. v. Martin
Redeker, 7. Aufl., 2 Bde. Berlin 1960, Bd. I, S. 27 f. 34 P. Bieri, a. a. O. (Anm. 25), S. 415.
(§ 4). 35 P. Bieri, a. a. O. (Anm. 25), S. 383.
Amt und Gemeinde 23Auffassung kein wahrer Glaube mehr. „Wenn dieses dem Menschen beigelegt
Die Aneignung des Glaubens ist nämlich wird, wird es in nichts rechtmäßiger bei-
kein Tun, sondern ein Empfangen. Was gelegt, als würde man ihnen auch die
der Glaube als „Handwerk der Freiheit“ Gottheit selbst beilegen, eine Gotteslä-
(Bieri) zu leisten vermag, betrifft – mit sterung, wie sie größer nicht sein kann.“36
Luther gesprochen – den äußerlichen, Wenn aber die Theologen dem Menschen
nicht aber den inneren Menschen, d. h. überhaupt irgendeine Kraft der eigenen
sein Weltverhältnis, nicht sein Gottes- Spontaneität beilegen wollen, sollten sie
verhältnis. dafür nach Luthers Meinung einen ande-
Die christliche Freiheit geht für Lu- ren Ausdruck als „freier Wille“ wählen.
ther auf paradoxe Weise nicht nur mit Vom freien Willen lasse sich theologisch
der Dienstbarkeit und Knechtschaft des allenfalls in einem uneigentlichen Sinne
Menschen, sondern auch mit der Unfrei- sprechen, sofern dem Menschen ein sol-
heit seines Willens zusammen. Die Lehre cher nur im Hinblick auf das, was ‚nied-
vom unfreien Willen geht folgerichtig aus riger‘ ist als er selbst, zugestanden wird,
Luthers radikalem Verständnis der Recht- d. h. für den Bereich seiner alltäglichen
fertigung des Sünders durch den Glauben Lebensführung, nicht aber im Hinblick
allein hervor. Er hat sie mit Vehemenz auf Heil oder Verdammnis.37
gegen Erasmus von Rotterdam (1466/69– Dass auch der Wille des Glaubenden
1536) und dessen Diatribe über den freien unfrei ist, wie Luther in „De servo arbi-
Willen verteidigt. trio“ behauptet, bedeutet keineswegs, der
Dass die Bezeichnung „freier Wille“ Glaube sei ein äußerlich auferlegter oder
ein Titel ohne echten Wert sei, ist bis ein innerer Zwang. Ganz im Gegenteil
zu einem gewissen Grade auch philo- ist der Glaube die Erfahrung von Freiheit
sophisch plausibel. Allerdings darf der schlechthin, nämlich die Erfahrung ei-
Zusammenhang von Luthers These mit ner Gewissheit, die die gesamte Existenz
seinem Sündenverständnis nicht außer trägt, und Standhaftigkeit bewirkt, wie sie
acht gelassen werden. Sie trifft eine Aus- Luther selbst an den Tag gelegt hat.
sage über den sündigen Menschen. In sei- „[W]enn Gott in uns wirkt, so will und
ner Schrift „Vom unfreien Willen“ (De tut der Wille, durch den Geist Gottes
servo arbitrio, 1525) radikalisiert Luther zärtlich angefacht, gewandelt wiederum
seine These allerdings zu einer schöp- aus reiner Bereitwilligkeit und aus eig-
fungstheologischen Aussage. Demnach nem Antrieb, nicht gezwungen, so daß
gilt grundsätzlich, dass der Mensch kei- er durch nichts Gegenteiliges in etwas
nen freien Willen hat. Luther vergleicht
ihn mit einem Lasttier, das entweder von 36 WA 18,636 (Übersetzung: Bruno Jordahn: Martin
Gott oder vom Teufel geritten wird, und Luther, Daß der freie Wille nichts sei. Antwort D.
Martin Luthers an Erasmus von Rotterdam, Mün-
gelangt zu dem Schluss, dass Freiheit des chen 31983, S. 48).
Willens ein exklusives Gottesprädikat ist. 37 WA 18,638.
24 Amt und GemeindeSie können auch lesen