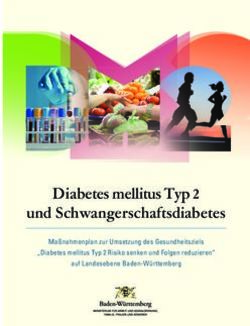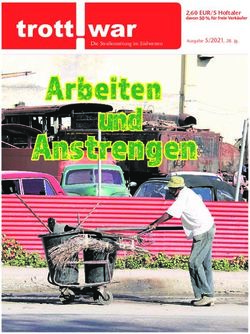Eltern und Betreuer Zwei Welten stoßen aufeinander
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Eltern und Betreuer
Zwei Welten stoßen aufeinander
Reflexionen zur Kommunikation und Kooperation zwischen Eltern
und professionellen Mitarbeitern in Wohnstätten für Menschen mit
geistiger Behinderung
Diplomarbeit
für die
Staatliche Abschlussprüfung
im Fachbereich Sozialwesen,
Studienrichtung Sozialarbeit
an der
KATHOLISCHEN FACHHOCHSCHULE NRW,
ABTEILUNG KÖLN,
vorgelegt von
Gabriele Kost
Matrikel Nr. 210064
am 14.05.2003
Erstkorrektorin: Diplom-Sozialpädagogin, Diplom-
Heilpädagogin Irmgard Wintgen
Zweitkorrektor: Professor Dr. paed. Maximilian Buchka2
Inhaltsverzeichnis Seite
– Vorwort 3
– Einleitung 5
1. Die Familie mit geistig behindertem Kind
1.1. Aspekte heutiger Elternschaft 7
1.2. Definition der geistigen Behinderung 8
1.3. Empirische Daten 8
1.4. Anthropologische Aspekte 10
1.5. Psychologische Aspekte 15
1.6. Soziologische Aspekte 18
1.7. Erfahrungen mit Fachleuten 21
2. Das Heim als „Zweites Zuhause“
2.1. Der Entschluss 25
2.2. Die Umsetzung 31
3. Wohnstätten für Menschen mit geistiger
Behinderung
3.1. Zu den Institutionen 36
3.2. Zu den Mitarbeitern in den Wohngruppen 38
4. Eltern und Betreuer - eine sensible Beziehung auf
einem spannungsreichen Feld
4.1. Das Spannungsfeld 41
4.2. Zu den Rollen 43
4.3. Zu den Machtverhältnissen 49
4.4. Zu den Konfliktbereichen 52
4.5. Resümee 56
5. Zur Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen
Eltern und Betreuern für den Menschen mit
geistiger Behinderung 58
6. Möglichkeiten der Verbesserung von
Kommunikation und Kooperation
6.1. Ethische Aspekte in der Begegnung 62
6.2. Allgemeine Aspekte in der Elternarbeit 68
6.3. Zur Geschichte der Elternarbeit 72
6.4. Partnerschaft 73
6.5. Empowerment 78
6.6. Verbesserungsperspektiven auf verschiedenen
Ebenen
6.6.1. Die Ebene der Mitarbeiter 82
6.6.2. Die Ebene der Institution 86
7. Konzeptionelle Überlegungen
7.1. Vorüberlegungen 89
7.2. Konzeptentwurf 90
8. Schlussbetrachtung 93
– Literaturverzeichnis 96
– Anhang3 Vorwort Die Thematik der Zusammenarbeit zwischen Eltern behinderter Menschen in Wohnheimen der Behindertenhilfe und den dort tätigen professionellen Mitarbeitern ist in den letzten Jahren (nicht zuletzt aufgrund der Qualitätsdebatte) zunehmend mehr beachtet und diskutiert worden, wobei sich in allen Veröffentlichungen zu diesem Thema der konflikthafte Zusammenhang beider Lebenswelten widerspiegelt. Die Fachliteratur zu diesem Thema ist nicht umfangreich, was mir auch Prof. Dr. Klauß, der 1993 (zusammen mit Peter Wertz-Schönhagen) das einzige sehr umfassende Buch hierzu geschrieben hat, zu Beginn meiner Recherchen bestätigte. Der Stellenwert der Eltern, der sowohl in der Frühförderung als auch im Kindergarten und in der Schule relativ hoch ist, was sich in verschiedenen wissenschaftlichen Arbeiten und Konzepten zur Arbeit mit ihnen ausdrückt, scheint im Heimbereich viel niedriger zu sein, was m. E. der Realität gerade dieser Eltern nicht gerecht wird und ihre persönliche Situation negiert. Aus eigener Betroffenheit weiß ich um die Brisanz dieses Themas: Die Kommunikation und Kooperation mit professionellen Mitarbeitern einer Wohnstätte für Menschen mit geistiger Behinderung ist Teil meines persönlichen Alltags, seitdem mein mittlerweile erwachsener Sohn in einem solchen Heim vor ca. fünf Jahren sein „Zweites Zuhause“ gefunden hat. Es hat mich sehr gereizt, mich mit diesem Thema im Rahmen dieser Arbeit zu befassen, wobei ich auch meine Erfahrungen aus meinem Praktikum in einem Heim für erwachsene geistig und psychisch behinderte Menschen einbringen konnte. Im Rahmen meines Feldprojektes auf dem Gebiet der Elternarbeit konnte ich viele Gespräche mit den Wohngruppenmitarbeitern zum Thema Elternarbeit führen. Trotz dieser Erfahrungen bin ich sehr dankbar, dass ich über eine große süddeutsche Wohneinrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung einen erfahrenen Hausleiter, der für mehrere Wohngruppen im Kinder -und Jugendbereich zuständig ist, zur Mithilfe bei der Bearbeitung meines Themas gewinnen konnte. Aufkommende Fragen und Probleme durfte ich jederzeit mit ihm diskutieren und konnte somit meine Vorstellungen immer wieder an der Realität messen. Ebenfalls vermittelt wurde mir durch diese Einrichtung die Möglichkeit intensiven Gedankenaustausches mit der sehr engagierten Vorsitzenden des dortigen Gesamt- angehörigenbeirates. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei beiden für ihre umfassende Unterstützung bedanken; auch wenn ich beide explizit nur selten erwähne, geht doch ihr Erfahrungsschatz in die gesamte Arbeit mit ein.
4 Einleitung Wir haben eine kleine Schwester, wir haben einen kleinen Bruder. Die sind ein wenig anders als andere Erdenkinder. Sie kamen in diese Welt, an diesen Ort, mit etwas weniger Handgepäck, als wir es mitbekamen. Wir Erwachsene sind so groß in unseren Taten und Worten. Aber unsere kleinen Geschwister werden niemals groß. Es ist für uns so leicht, Kleine und Schwache wegzuschieben und sie mit hilflosen Gesichtern hinter uns zu lassen. Wir vergessen so leicht, dass einmal das letzte Schiff abgeht und dass dann alle Passagiere ihr Gepäck zurücklassen müssen. Dann wird es für diese Kleinen vielleicht am leichtesten, denn sie besitzen nur ein Herz voll Kummer und Freude. Und diese Freude ist so schön und der Kummer so schwer. Aber das haben unsere Geschwister ja schon immer gewusst. Deshalb lass uns ihnen Freude schenken, bis sie an Bord müssen, unsere kleinen Geschwister mit ihren Kinderherzen. (Verfasser unbekannt) Eigentlich könnte es doch so einfach sein: Da das Wohl geistig behinderter Menschen sowohl ihren Betreuern als auch ihren Eltern am Herzen liegt, sollte beide Personengruppen diese Tatsache vereinen und problemlos miteinander kooperieren lassen. Und an ganz vielen Stellen gelingt das sicher auch sehr gut. Aber nach meiner Erfahrung ist die Beziehung beider Seiten zueinander sensibel und fragil, zudem häufig mit unnötig erscheinenden und auch noch eskalierenden Konflikten belastet, unter denen dann alle Beteiligten leiden. Nur vor dem Hintergrund der jeweiligen Lebens- oder Arbeitssituation der Beteiligten sind diese Probleme aber auch Chancen und Verbesserungsperspektiven zu begreifen, so dass ich den Titel meiner Arbeit bewusst polarisierend als den „Zusammenstoß zweier Welten“ formuliert habe, was auch mein weiteres methodisches Vorgehen in dieser Arbeit strukturiert. Ich beschreibe zunächst Aspekte aus der Welt der Familie mit geistig behindertem Kind (Kapitel 1), dann den Grund des Zusammentreffens der Eltern und der Mitarbeiter im Heim: den Heimentschluss (Kapitel 2), skizziere im Anschluss daran kurz die andere Welt der Institution mit ihren Mitarbeitern (Kapitel 3) und komme daraufhin zu einem
5 Schwerpunkt meiner Arbeit: der Darstellung der Beziehung zwischen Eltern und Mitarbeitern in verschiedenen Facetten (Kapitel 4). Nach Gedanken zur Bedeutung der Zusammenarbeit für den behinderten Menschen (Kapitel 5) folgen Möglichkeiten der Verbesserung von Kommunikation und Kooperation, wobei ich in diesem Zusammenhang auf die Elternarbeit und Verbesserungsperspektiven auf verschiedenen Ebenen eingehe (Kapitel 6). Im 7. Kapitel stelle ich konzeptionelle Überlegungen zur Elternarbeit in einer Wohnstätte an und beende meine Arbeit mit einer Schlussbetrachtung (Kapitel 8). Anmerkungen: Persönliche Eindrücke, Gedanken und Erfahrungen werden zur Unterscheidung in der Schriftart Times New Roman kursiv vom anderen Text abgehoben, Zitate anderer Autoren in der Schriftart Courier New. Wenn ich in meiner Arbeit den Begriff „Kind“ verwende, ist dies nicht altersspezifisch, sondern auf die familiäre Situation bezogen zu verstehen. Ich verwende sowohl den Begriff des Betreuers als auch des Erziehers synonym für den professionellen Mitarbeiter im Wohngruppendienst, da sich beide Begriffe in diesen Zusammenhängen so eingebürgert haben. Im Interesse einer besseren Lesbarkeit werde ich in dieser Arbeit bei der Bezeichnung von Personen und Personenkreisen stets die maskuline Form verwenden, wobei natürlich immer Vertreter beiderlei Geschlechts gemeint sind.
6 1. Die Familie mit geistig behindertem Kind 1.1. Aspekte heutiger Elternschaft Die Soziologin Elisabeth Beck-Gernsheim hat in ihrem Buch „Die Kinderfrage - Frauen zwischen Kinderwunsch und Unabhängigkeit„ (1989) festgestellt, dass die Kinder heutzutage „Kopfgeburten“ sind. Der Kinderwunsch ist mittlerweile eine Art unternehmerischer Entscheidung geworden. Sie muss gut durchdacht werden, weil sie der Legitimation gegenüber dem Lebensumfeld bedarf. Kinder müssen heutzutage zur Optimierung der individuellen Lebensqualität beitragen und sie dürfen - ganz wichtig - die vorgefassten Lebenspläne nicht zerstören. Hinzu kommt noch, dass in den letzten Jahren ein starker Geburtenrückgang zu verzeichnen ist, mit gleichzeitigem starkem Anstieg der subjektiven Bedeutung des (meist einzigen) Kindes für die Eltern. Ein Kind muss nunmehr die Hoffnungen und Erwartungen vieler ungeborener Kinder erfüllen. Das ist schon für das gesunde, leistungsfähige Kind eine schwere Hypothek, die oft nur unter Verhaltensstörungen oder anderen Problemen „abgezahlt“ werden kann. Unter gesellschaftlichem Druck entscheiden sich viele Frauen auch für die Nutzung der praenatalen Diagnostik, wobei schon die Entscheidung für oder gegen diese Möglichkeit zu schweren persönlichen Krisen führen kann. Vielen Frauen ist gar nicht bewusst, dass nicht alle Behinderungen diagnostisch praenatal erfasst werden können, die Diagnostik selbst mit Risiken für Frau und Kind verbunden ist und überhaupt nur wenige Behinderungen chromosomal bedingt sind. Aber gerade die verantwortlichen Frauenärzte raten zunehmend zur Ausschöpfung aller medizinischen Möglichkeiten, um nicht im Falle von Behinderung in Regress genommen werden zu können. „Bei positivem Befund erfolgt in der Regel ein Schwangerschaftsabbruch“ (Cloerkes, 2001: 238). Vor diesem Hintergrund ist nun die meist nicht erwartete und nicht gewünschte Situation der Familie mit einem geistig behinderten Kind zu sehen. 1.2. Definition der geistigen Behinderung Da es keine allgemein gültige und für alle Gebiete verbindliche Definition der geistigen Behinderung gibt (je nach Perspektive oder Profession werden andere Aspekte fokussiert und keine Definition alleine wird der Komplexität der geistigen Behinderung gerecht), möchte ich an dieser Stelle nur die Definition von Heinz Bach anführen, da sie m. E. sehr umfassend ist und man sich gerade auch die praktischen Auswirkungen
7 der geistigen Behinderung auf die Eltern und das Zusammenleben in der Familie vorstellen kann: „Als geistig behindert gelten Personen, deren Lernverhalten wesentlich hinter der auf das Lebensalter bezogenen Erwartung zurückbleibt und durch ein dauerndes Vorherrschen des anschauend-vollziehenden Aufnehmens, Verarbeitens und Speicherns von Lerninhalten und eine Konzentration des Lernfeldes auf direkte Bedürfnisbefriedigung gekennzeichnet ist, was sich in der Regel bei einem Intelligenzquotienten von unter 55/60 findet. Geistigbehinderte sind zugleich im sprachlichen, emotionalen und motorischen Bereich beeinträchtigt und bedürfen dauernd umfänglicher pädagogischer Maßnahmen. Auch extrem Behinderte gehören - ohne untere Grenze - zum Personenkreis“ (Bach 1976: 92). Wenn ich im Folgenden von Familien mit geistig behinderten Kindern spreche, meine ich gemäß dieser Definition also auch immer Familien mit mehrfachbehinderten Kindern in allen Ausprägungen. 1.3. Empirische Daten Über die Gesamtzahl der Menschen mit geistiger Behinderung in Deutschland liegen keine zuverlässigen Angaben vor. Neuhäuser/Steinhausen gehen aber davon aus, dass mit jedem neuen Geburtsjahrgang ca. 0,5 % - 0,6 % geistig behinderte Kinder geboren werden: „Die institutionelle Prävalenzrate dürfte etwa bei 0,5 % liegen, d.h. 0,5 % aller Schulpflichtigen in der Bundesrepublik besuchen Schulen für geistig Behinderte“ (Neuhäuser / Steinhausen 1990: 13). In ihrem „Berliner Memorandum“ zur Fachtagung mit dem Titel „Familien mit behinderten Angehörigen - Lebenswelten - Bedarfe – Anforderungen“ vom Oktober 2001 in Berlin schätzt die Lebenshilfe als größte Elternvereinigung, dass in Deutschland 420.000 Menschen mit geistiger Behinderung leben. Davon sind 185.000 Kinder und Jugendliche, die zu 85 % (das sind 160.000) in ihren Familien leben. Von den erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung, so die Schätzung weiter, leben immerhin noch 60 % (140.000) bei den Eltern oder sonstigen Angehörigen. In Einrichtungen leben bundesweit ca. 12o.ooo Menschen mit geistiger Behinderung. (Bundesvereinigung Lebenshilfe: Berliner Memorandum, 2002: 241)
8 Mit der letzten Zahl korrespondiert auch die Schätzung von Wacker, Wetzler u. a., 1998: „Eigenen Berechnungen zufolge, die auf der Basis der von Infratest vorgelegten Zahlen vorgenommen wurden, ist davon auszugehen, dass von den Menschen mit geistigen Behinderungen und Mehrfachbehinderungen durchschnittlich jeder Vierte in Heimen lebt“ (Wacker, Wetzler u. a., 1998: 298). Nicht jede geistige Behinderung steht gleich bei der Geburt fest, im Gegenteil, viele werden erst später entdeckt. Hierzu nennt Speck unter Bezug auf Eggert folgende Zahlen: Bei 20,9 % aller Menschen mit geistiger Behinderung wird dies bei der Geburt festgestellt, im Durchschnitt aber wird es erst mit ca. zwei Jahren diagnostiziert und bei 25 % entdeckt man es erst nach dem 6. Lebensjahr (vgl. Speck, 1999: 306). Epidemiologisch gesehen finden sich unter den geistig behinderten Kindern mehr Jungen als Mädchen, außerdem sind sie in sozioökonomisch schwachen Familien unverhältnismäßig häufiger anzutreffen als in mittleren und höheren Schichten. „Bei 60 % der Menschen mit geistiger Behinderung, also bei der Mehrzahl, kennen wir die Ursache letztlich nicht“ (Neuhäuser / Steinhausen, 1990: 25). 1.4. Anthropologische Aspekte Unter Bezug auf Bollnow stellen Hensle / Vernooij fest: „Die Begegnung, die Konfrontation mit einem mehr oder weniger beeinträchtigten Leben in unmittelbarem Bezug zu einem selbst und vor dem Hintergrund der optimistischen Erwartungen, erschüttert die geistig- psychischen Grundfesten eines Menschen“ (Hensle / Vernooij, 2ooo: 270). Diese Erschütterung, das Ausmaß elterlicher Betroffenheit und damit die zutiefst menschliche Dimension werden deutlich, wenn die Eltern sich selbst zu Wort melden und über ihr gemeinsames Leben mit ihrem behinderten Kind berichten. In mittlerweile zahllosen Büchern und Zeitschriftenartikeln beschreiben sie meist sehr offen und prä- zise, welche Veränderungen ihres Lebens sie verarbeiten müssen, was die Behinderung für die ganze Familie bedeutet und wie alle damit umgehen lernen. Da Eltern in der Regel Außenstehenden ihre tiefsten Empfindungen und intimen Gefühle nicht mitteilen, ist gerade diese „Betroffenheitsliteratur“ eine Brücke über den „Abgrund“ (wie es Otto Speck formuliert hat) und kann Professionellen einen Blick in
9 die Innenwelt Betroffener ermöglichen. Gefühlsmäßige Mitbetroffenheit kann dann tragfähige Grundlage solidarischen Handelns bewirken. Der japanische Nobelpreisträger für Literatur 1994, Kenzaburo Oe, hat „...die große Katastrophe seines Lebens, die Geburt seines ersten Sohnes im Jahre 1963, der mit einer Gehirnhernie zur Welt kam“ ( Hijiya- Kirschnereit, 1994: 232), immer wieder zum Stoff seiner Literatur gemacht. Seine Gefühle angesichts der Geburt des Kindes kleidet er in folgende Worte: „Fünf Wochen lang habe ich nach der Geburt meines missgestalteten Sohnes gehofft, dass er sterben würde....Und keine noch so starke Läuterungskraft wird diese Befleckung je von meinem Leben waschen können, ja, ich glaube, bis zu meinem Tod wird mir dies anhaften“ (Oe 1994: 232). Auf literarischer Ebene hat sich Oe wohl am deutlichsten mit Tötungsphantasien und aber auch konkreten Tötungsabsichten ausei- nandergesetzt. Aber auch im Buch von Pearl. S. Buck findet man diese Gedanken: „Ich hätte den Tod für mein Kind willkommen geheißen, dann wäre es für immer gesichert“ (Buck, 1975: 42). In diesem Buch „Geliebtes unglückliches Kind“ schildert sie sehr sensibel, offen und dabei sehr reflexiv ihre Gefühle als Mutter einer geistig behinderten Tochter. Aus ihren Worten spricht viel Erkennen und Weisheit, wobei es ihr gelingt, auch die Erfahrungen anderer Eltern mit einzubeziehen und ihre Aussagen somit eine gewisse Allgemeingültigkeit widerspiegeln. So kann man z. B. als Außenstehender gut nachvollziehen, dass Eltern nicht dauernd vertröstet oder auf vage Hoffnungen verwiesen werden wollen, sondern froh sind, wenn jemand sich traut, endlich die Wahrheit über die Behinderung zu sagen. Buck beschreibt den Moment als unerträglich. „Vielleicht lässt es sich am besten so schildern, dass ich innerlich verblutete – hoffnungslos“ (1975: 36). Aber sie ist dem Wahrheitsüberbringer dennoch dankbar. Zum Schluss ihres zwar alten, aber, wie ich finde, immer noch sehr aktuellen Buches appelliert sie an andere Eltern mit behinderten Kindern, aber implizit auch an die Unterstützung der Eltern durch Professionelle: „Wenn euch ein kleines Kind geboren wird, das nicht wohl und gesund ist, wie ihr hofftet, sondern verkrüppelt und mangelhaft an Körper und Geist oder vielleicht an beidem, bedenkt, dass es doch immer euer Kind ist. Bedenkt, dass das Kind ein Recht auf sein Leben hat, was für ein Leben das auch sein mag, und dass es ein Recht auf ein Glück
10 hat, das ihr ihm finden müsst. Sei stolz auf dein Kind, nimm es hin, wie es ist und achte nicht der Worte und des Staunens derer, die es nicht besser verstehen. Dieses Kind hat einen Sinn für Dich und für alle Kinder. Du wirst ungeahnte Freude finden, wenn du sein Leben für es und mit ihm vollendest. Erhebe dein Haupt und gehe deinen vorgezeichneten Weg! Ich spreche als eine, die es weiß“ (Buck, 1975: 92). Zu diesen Gedanken und Gefühlen können alle Eltern nur sehr langsam, mühevoll und manchmal auch qualvoll gelangen. Aber alle ahnen um die Notwendigkeit dieser Einstellung für das Kind aber auch für sich selbst und sind unendlich dankbar für „Bausteine“ auf ihrem Weg. Und damit meine ich z. B. gute Beratung durch Professionelle, menschliches Verstehen von Außenstehenden, gute Gespräche, in denen die Eltern mit ihren höchstpersönlichen Bedürfnissen und nicht nur der behinderte Mensch im Mittelpunkt stehen. In diesem Zusammenhang möchte ich fragmentarisch die krisenhafte Aus- einandersetzung mit der Behinderung ihres Sohnes von Petra Dreyer in ihrem Buch „Ungeliebtes Wunschkind“ wiedergeben. Ihr dramatisches Buch lässt den Prozess der Annahme sowohl ihrer selbst als auch des schwerbehinderten Kindes sehr transparent und reflexiv erscheinen. Das Buch macht Eltern Mut und zeigt gleichzeitig Außenstehenden auf, was dem Menschen möglich sein kann als Schicksalsannahme und positiver Auseinandersetzung mit extremen Lebensaufgaben. Während ihrer Schwangerschaft hatte Petra Dreyer die normalen Phanta- sien aller werdenden Mütter: „Mein Wunschkind entstand - ein Superkind, und ich natürlich die tollste Mutter der Welt“ (Dreyer, 1988: 11). Das Kind wird unter Komplikationen geboren und ist geistig schwer behin- dert. „Nur sein Tod wäre Trost für mich, lieber ein Ende mit Schrecken als einen Schrecken ohne Ende. So ein ge- schädigtes Kind wollte ich nicht, nein, nein, und noch- mals nein“ (13). „Nichts ist mit tollster Mutter der Welt, stündlich versage ich, tue ich irgendetwas, das ihn zum Weinen bringt“ (21).
11 Auf Fragen ihrer Bekannten antwortet sie: „Mein Kind ist schwer körperlich und geistig behindert, wird nie laufen und sprechen können, immer auf fremde Hilfe angewiesen sein. Jens ist ein schwachsinniges Kind, wobei ich schwachsinnig besonders betone, Ausschussware, nur am Leben, um Arbeit zu machen und Schrecken zu verbreiten“ (23). Und sie hasst ihn dafür, dass er nicht „behindert“ aussieht, sondern sehr hübsch ist. Eindrucksvoll und plastisch schildert sie ihren mühsamen Alltag mit Jens, die zahllosen Arztbesuche, die schmerzenden Reaktionen der Umwelt, ihre Hoffnungslosigkeit, ihre aufgewühlten Emotionen. Immer wieder stellt sie sich dieselben Fragen: Welchen Wert hat das Leben meines Sohnes? Wa- rum muss er so leiden? Welchen Sinn kann das alles haben? Aber langsam ahnt sie, dass der Hass auf ihr Kind auch ein Zeichen leben- diger Verbundenheit mit diesem ist. Die Einladung in eine Klinik in Bethel bringt eine langsame Veränderung. „Hier sind wir nicht die Au- ßenseiter, ist die Behinderung Normalität“ (43). Aber sie empfindet Jens weiterhin als „Alptraum“ für sich. In einer Art Selbstanalyse beschäftigt sie sich mit ihrem bisherigen Leben, ihrer Lage mit ihrem behinderten Bruder und aber auch ihrer Zukunft. Die Rückkehr in den Beruf wird durch Jens verändert: „...nichts ist mehr wie vor- her, aber es ist deshalb nicht schlechter“ (59). Als Jens sich gegen die intensive Krankengymnastik immer verzweifelter wehrt, bekommt auch sie Zweifel an deren Sinn und lässt sich auch einmal selbst „beturnen“. Und da beginnt sie Jens das erste Mal zu verstehen: „Jens, zum ersten Mal verstehe ich Dein Schreien, schrei weiter, schrei für mich mit, denn ich bin ge- nauso wütend und hilflos wie Du. Nur, ich bin schon die, die ich einmal werden sollte, ich habe schon auf- gehört zu schreien“ (67). Geplagt von Schuldgefühlen, aber das erste Mal wieder handlungsfähig und eigenverantwortlich, bricht sie die Krankengymnastik entschlossen ab. In einer lebensbedrohlichen Krampfsituation ihres Sohnes erlebt sie zum ersten Mal, dass sie ihren Sohn wirklich akzeptiert und anerkennt. Sie sieht
12 ihn als ein von ihr völlig getrenntes Wesen, „...dessen Wirklichkeit ich nie ganz werde nachvollziehen können“ (75). Bedauernd stellt sie fest, dass die Trauer wohl Teil ihres Lebens bleiben wird, aber ihr Blickwinkel auf Jens verändert sich allmählich. Empathisch versucht sie sich in ihn hinein zu versetzen und kann dann auch sich selbst und ihr Verhalten besser annehmen. „Erst im Erkennen des eige- nen Andersseins, Abweichen von Normen und Regeln, dem Erkennen der eigenen Fehler und Schwächen, habe ich Zu- gang gefunden zu dem Anderssein meines Kindes, zu sei- ner Wut, Trauer und Hilflosigkeit“ (117). Am Ende scheint „Zukunft“ möglich: „...ich darf etwas mehr die sein, die ich nun mal bin, und so darfst du etwas mehr sein, der du nun mal bist, die Mauer zwischen uns be- ginnt zu schrumpfen“ (117). Zahlreiche andere Schriftsteller beschreiben ähnliche Gefühle und Entwicklungsprozesse (z. B. Geppert, Beuys), alle haben mehr oder weniger ähnliche Erfahrungen und Probleme, und auch ich, als Betroffene, finde mich in dieser Literatur sehr oft wieder. Aber jeder Mensch geht anders mit seinen Erfahrungen um, benötigt andere Hilfe oder lässt andere Unterstützung zu. Professionelle Begleitung muss also immer am Einzelfall sensibel orientiert sein, wenn es auch allgemein gültige Strukturen zu geben scheint. Zum Schluss meiner anthropologischen Aspekte möchte ich noch resümierend Dieter Schulz zitieren, dessen anthroposophisch geprägte Gedanken sowohl für die Eltern als auch für die Professionellen ein tragfähiges, sinnstiftendes Handlungsfundament bilden können: „Das Leid, ein Kind zu haben, das anders ist als die anderen Kinder, steht für die meisten Eltern immer wieder im Vordergrund. Dieses Leid, die Mühen und Strapazen, die Eltern durch ihr Kind auferlegt bekommen, zieht sich wie einer von mehreren roten Fäden durch das Leben. Bleibt man bei dieser schmerzvollen Wahrnehmung stehen, so kann das Schicksal der Eltern und des Kindes unerträglich wirken. Die Tatsache der Behinderung des Kindes bleibt bestehen, das seelisch-geistige Erleben der Eltern birgt aber die Möglichkeit der Verwandlung
13 des Leidens in sich: Reifung, Entwicklung, innere Stärke, Wesentliches vom Unwesentlichen unterscheiden zu können und andere individuell verschiedene Fähigkeiten“ ( Schulz, 1999: 128). Ich persönlich kenne keine Familie, die ihr behindertes Kind – trotz oder wegen aller Probleme – nicht als echte Bereicherung ihres Lebens erlebt. Besonders die herzliche Spontaneität, die ehrliche Emotionalität und das einfache Da-Sein des behinderten Kindes macht Freude, genauso das Erleben auch kleinster Entwicklungsschritte des Kindes. So existiert oft eine besonders enge und liebevolle Beziehung zwischen Eltern und Kind. 1.5. Psychologische Aspekte Die Geburt eines behinderten Kindes bedeutet zunächst einmal eine herbe Enttäuschung für die Eltern, deren hoffnungsvolle Phantasien hinsichtlich des Kindes sich auch nicht ansatzweise verwirklichen werden. Die Eltern fühlen sich in ihrem Selbstwertgefühl verletzt, evtl. aus verschiedenen Gründen auch schuldig, auf jeden Fall aber völlig hilflos angesichts dieser neuen Situation, auf die es keine Vorbereitung gab. Eigene Lebenspläne müssen radikal geändert werden, die Beziehung zur Umwelt ist belastet. Der Umgang mit dem behinderten Kind erfordert die Übernahme einer neuen Elternrolle. Die Einstellung der Eltern zum Kind hängt nun von der Verarbeitung der Erschütterung und des inneren Konfliktes ab. Wenn sich die Gewahrwerdung der Behinderung über längere Jahre hinstreckt, kann das Gefühl der Eltern als schleichende, ambivalente Verunsicherung bezeichnet werden. Als ehedem normaler Teil der Gesellschaft haben die Eltern genauso negative Tendenzen gegenüber dem Phänomen „Behinderung“ erlernt, sind aber wahrscheinlich stärker bemüht, diese zu unterdrücken. Die Diskrepanz zwischen dem erträumten „idealen“ Kind und dem „realen“ Kind ist sowohl kognitiv als auch emotional nur schwer zu überbrücken. Das Erleben der Eltern ist sowohl schichtspezifisch geprägt als auch vom Bildungsniveau abhängig. Dabei können drei Hauptformen von Reaktionen auf die Behinderung festgestellt werden: Schockgefühle, Schuldgefühle und Abwehrmechanismen (nach Cloerkes, 2001: 238). Zu diesen Abwehrmechanismen, die nötig sind, um das gestörte innere Gleichgewicht wieder zu erlangen, gehören: Verleugnung, Projektion, Intellektualisierung und Sublimierung, wobei die letzten beiden Mechanismen zur Verarbeitung des ungelösten Konfliktes führen können, wenn es geschafft wird, die realistischen Bedürfnisse des Kindes zu sehen und zu erfüllen
14 (nach Speck, 1999: 309). Speck nennt noch weitere Abwehrmechanismen: Abreagieren von Aggressionen, Ritualisierung und Überbehütung bzw. Verwöhnung. Je stärker sich die Einstellungen und Erwartungen an tradierten Norm- und Wertvorstellungen wie Schönheit, körperliche und geistige Unversehrtheit, Erfolg, Leistung, Selbstständigkeit und Autonomie orientieren, desto größer sind die Enttäuschungen und Konflikte. Dabei spielen der Zeitpunkt des Erkennens der Behinderung, Art, Sichtbarkeit und Schweregrad der Behinderung eine große Rolle. Zur Erklärung der Krisenverarbeitung wurden von verschiedenen Autoren Modelle entwickelt, wobei allen Modellen Phasenbeschreibungen gemein sind. Am populärsten ist das Spiralphasenmodell von Schuchardt, das ein generelles Krisenverarbeitungsmodell darstellt. Sie beschreibt hierin acht Spiralphasen, die sich durch das Eingangsstadium, das Durchgangsstadium und das Zielstadium „hoch- schrauben“. Diese acht Phasen heißen Ungewissheit, Gewissheit, Aggression, Verhandlung, Depression, Annahme, Aktivität und Solidarität. „Das Bild der Spirale veranschaulicht sowohl die Unabgeschlossenheit der inneren Vorgänge als auch die Überlagerung verschiedener Windungen im Verlaufe des täglichen Lebens und Handelns mit anderen“ (Schuchardt, 1999: 38). Aus Elternsicht birgt dieses prägnante Modell die Gefahr, noch zusätzlich Leistungsdruck auf die Eltern auszuüben. In meinem Erleben kann ich mich zwar in diesen Phasen wiederfinden, was mir das Gefühl gibt, ich bin „in Ordnung“, andererseits hätte ich gerne ein Patentrezept, wie ich die Spiralspitze möglichst schnell erreiche, da mit diesem letzten Schritt ja eine gewisse Immunisierung gegen Trauer möglich zu sein scheint. Für professionelle Fachkräfte ist trotz aller Schwächen dieses Modells hiermit die Möglichkeit gegeben, Trauerprozesse bei den Eltern zu erkennen, zu deuten und so sensibel zu begleiten. Dabei ist wichtig zu beachten, dass jede gefühlsmäßige Reaktion seinen berechtigten Sinn hat, weder zu pathologisieren, zu verhindern oder womöglich zu kritisieren ist. Jonas, die sich besonders um die mütterlichen Probleme mit der Behinderung bemüht hat, sieht die Aufgabe der professionellen Dienste im Behindertenbereich darin, „...die Mütter in der Bewältigung des Traumas der Behinderung zu begleiten und ein Beziehungsangebot zu machen, in dem Trauerprozess und Autonomieentwicklung in der Interaktion erlebbar werden, zur Sprache kommen können und nicht verdrängt werden müssen“ (1990: 153). Dieser Beratungsprozess braucht viel Zeit und Interaktion in konkreter Beziehung.
15
Allgemein ist festzustellen, dass die Verarbeitung kritischer Lebensereignisse ein sehr
komplexer und individueller Prozess ist, bei dem individuelle Faktoren (Einstellung,
Persönlichkeitsstruktur), situative Faktoren (Lebensumstände, Hilfsangebote) und
gesellschaftliche Faktoren (Zugang zu Informationen) zusammenwirken. Jeder profes-
sionelle Kontakt sollte auf Stärkung der Eltern (nicht, weil sie schwach sind, sondern
weil sie ihre Stärken noch ausbauen können), auf Akzeptanz ihrer Probleme (weil sie
reale Probleme haben, die sie aber – mit selbstbestimmter Unterstützung – alleine
lösen können) und Unterstützung in ihrer besonderen Elternrolle (weil sie normale
Eltern sind, die aber besonders herausgefordert sind) gerichtet sein.
1.6. Soziologische Aspekte
Mit ihrem behinderten Kind erleben Eltern sowohl in ihrer Selbst- als auch in ihrer
Fremdwahrnehmung, dass ihre Elternschaft von der Norm abweicht, denn die Situation
ist erwartungskonträr und traditionslos zu den gesellschaftlich gängigen
Lebenssituationen.
An dieser Stelle möchte ich meine Betrachtungen der verschiedenen Elternrollen nur
auf die Rolle der Mutter beschränken, da sie in der Regel die Hauptbezugs- und
Pflegeperson des behinderten Kindes ist und sich ihr persönliches Leben, der Alltag
und ihre Lebenswelt am meisten durch die Tatsache der Behinderung und die später
beschriebene Heimunterbringung des Kindes ändert.
Grundsätzlich ist festzustellen, dass mit der Geburt eines Kindes in vielen Familien
wieder die traditionelle Rollenverteilung eintritt. Bei der Geburt eines behinderten
Kindes trifft dies in fast allen Fällen zu. „Dem traditionellen Rollenverständnis
entsprechend sind Mütter für die Pflege und Betreuung ihres behinderten Kindes
verantwortlich, während es in das Ermessen der Väter gestellt ist, inwieweit sie neben
ihrer Berufsarbeit häusliche Aufgaben übernehmen“ (Stegie, 1988: 126). Häußler,
Wacker und Wetzler haben in ihrer Studie, die nicht nach Art der Behinderung
differenziert, zur Lebenssituation von Menschen mit Behinderung in privaten
Haushalten festgestellt, dass in über 80 % der untersuchten Haushalte die Pflege
überwiegend durch eine Frau als Hauptpflegeperson erbracht wird (1996: 448).
Für die Mutter ergeben sich hieraus folgende Konsequenzen:
¾ Erfordernis der permanenten Präsenz für die Bedürfnisse des Kindes,
möglicherweise jahrzehntelang und rund um die Uhr.
¾ Aufgabe des Berufes (und damit gravierende ökonomische Schlechterstellung
der Familie) und radikale Einschränkung der Freizeit und Freizeitmöglichkeiten.16
¾ Je nach Behinderung des Kindes: chronische Schlafdefizite und körperliche
Erschöpfungszustände.
¾ Größte psychische Belastung hinsichtlich der Unaufhebbarkeit der Behinderung
und ständig neuer Anforderungen und Krisen im Lebenslauf des Kindes.
¾ Schuldgefühle.
¾ Einseitige Konzentration auf das Kind und dadurch Vernachlässigung der
anderen Familienmitglieder.
¾ Latente Ablehnungstendenzen und übermäßige Ansprüche gegenüber dem Kind.
Für den nochmals getrennt hiervon zu sehenden Kreis der Mütter
schwerstmehrfachbehinderter Kinder hat Dorothee Wolf-Stiegemeyer, selbst Mutter
einer schwerstbehinderten Tochter, in ihrer Umfrage 1999 bei 62 Müttern solcher
Kinder eine deutliche Lebensqualitätsveränderung festgestellt. Ihre
Handlungsmöglichkeiten sind sehr eingeschränkt, zwischenmenschliche Beziehungen
durch Zeit- und Sozialfaktoren erschwert, Selbstachtung, Selbstsicherheit und
Selbstanerkennung werden durch diese Aufgabe tangiert und auch die Lebensfreude
kann aufgrund der emotionalen und physischen Belastung schwinden. „Die
Gesamtsituation von Müttern besonderer Kinder ist – im Verhältnis zu Müttern
„gesunder“ Kinder – eindeutig als eine meist um ein Vielfaches belastetere zu
betrachten“ (Wolf-Stiegemeyer, 2000: 12). Es besteht eine hohe und zunehmende
Erkrankungsgefahr für diese Mütter.
Dieter Schulz beschreibt den Alltag besonders herausgeforderter Mütter
folgendermaßen: „Immer wieder beschreiben Mütter diesen Zwang, den täglichen
Pflichtenkatalog zu erfüllen, als Berg oder Mauer gegen die man nicht ankommt. Das
Gefühl, alles wird zuviel, ich kann es nicht mehr bewältigen, kann plötzlich panikartig
auftreten oder, wenn es chronisch wird, aushöhlend und verzehrend wirken. Die
Lebensfreude schwindet, die Kräfte nehmen ab, alles färbt sich grau in grau. Routine
erfüllt den Alltag und die Seele bleibt auf der Strecke“ (Schulz, 1999: 31).
Das gesellschaftliche Postulat der „Mutterliebe“ erfährt in Bezug auf behinderte Kinder
noch eine besondere Brisanz und setzt die Mütter mehr noch als „normale“ Mütter
unter Druck. Oft folgen die Mütter einem fragwürdigen Idealbild, in dem sie nur sich
selbst als fähig sehen können, der Behinderung ihres Kindes gerecht zu werden. So
wird oft schon die bloße Inanspruchnahme des Familienentlastenden Dienstes von
starken Schuldgefühlen begleitet, und auch die jahre- bis jahrzehntelange innere
Tabuisierung des Gedankens an ein „Anschlusszuhause“ für das Kind hat hierin eine17 seiner Ursachen. Gedanken an eigene Berufstätigkeit oder auch nur ein Hobby werden in oft masochistisch anmutender Weise unterdrückt. Gerade die jungen Mütter heute, oft hoch qualifiziert ausgebildet und mit emanzipatorischem Gedankengut aufgewachsen, empfinden dieses Los als besonders hart. Durch diese Schicksalsrolle fühlen sie sich jeglicher Autonomie beraubt. Im Gegensatz zu den früheren Müttern in vergleichbarer Lage empfinden sie sich in ihrer Hausfrauenrolle durch das behinderte Kind auch nicht „aufgewertet“, ist doch die „Nur“- Hausfrauensituation gesellschaftlich und in harter Währung heutzutage wenig wert. Aber bei vielen Müttern wachsen im Laufe der Jahre die Kompetenzen, sie haben oft eine sehr aktive und bestimmende Rolle, die ihnen auch Selbstbewusstsein gibt. Insgesamt ist festzustellen, dass die Belastung für die Mütter von Außenstehenden kaum nachvollziehbar ist, die Leistung nicht einfach als selbstverständlich erwartet werden sollte und dass Beratung und Unterstützung besonders der Mütter Frauenförderung per se ist, ein in Unternehmen und Behörden schon längst, zumindest in Ansätzen verwirklichtes Gesellschaftsziel. Nach dieser längst nicht abschließenden Übersicht über verschiedene Aspekte aus der familiären Welt mit geistig behinderten Kindern skizziere ich nun kurz Erfahrungen der Eltern aus ihrer oft jahrelangen Zusammenarbeit mit Fachleuten in der Behindertenhilfe, aber auch Wünsche der Eltern, die sich hieraus ergeben. Das ambivalente Durchleben der „Mühle der Professionalität“ prägt und formt die Eltern und bildet das Portal, durch das sie dann später auf die Mitarbeiter in den Heimen zugehen. 1.7. Erfahrungen mit Fachleuten „Der Anlass für Begegnung Eltern-Professionelle ist für Eltern das i. d. R. unvorhersehbare Hineingeraten in die „unverschuldete“ Situation, Eltern eines Kindes mit geistiger Behinderung geworden zu sein“ (Dittmann,2000 : 243 ). Und Eltern behinderter Kinder haben unglaublich viele Kontakte mit Fachleuten. Sie verausgaben sich physisch, psychisch und oft auch finanziell, um ihrem Kind möglichst alle Förder- und Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen. Gerade in den ersten Lebensjahren des Kindes ist der Förderdruck als konkreter Ausfluss der elterlichen Verantwortung extrem hoch und wird fatalerweise durch viele
18 Professionelle aus oft sehr egoistischen Gründen noch geschürt. Durch „Ärztehopping“ über „Therapieshopping“ und „Beratungsdschungel“ erleben Eltern oft unzählige Kontakte mit Fachleuten. Gerade in den ersten Jahren ziehen sich die Eltern aufgrund ihrer schwierigen emotionalen Lage sozial sehr zurück, sie versuchen dadurch, wenigstens im engsten Familienkreis handlungsfähig zu bleiben. Ihr oft einziger, aber intensiver Kontakt nach „draußen“ bilden die beschriebenen Besuche bei Fachleuten, deren Reaktionen sie – selbst ratlos, verunsichert und oft auch hoffnungslos – umso tiefgreifender „ausgeliefert“ sind. Hierzu stellt Eckert in seiner Studie fest: „Die Erfahrungen, die die befragten Eltern im Laufe ihres gemeinsamen Lebens mit dem behinderten Kind im Kontakt zu Fachleuten gesammelt haben, weisen ein sehr heterogenes Bild auf“ (Eckert ,2002: 231). Und: „Das Überwiegen positiver Erfahrungen bildet jedoch eine Ausnahme, so dass nach den Berichten der Eltern die Kontakte zwischen Eltern und Fachleuten kritisch betrachtet werden sollten“ (231). Eine Mutter eines dreijährigen mehrfachbehinderten Kindes erzählte mir einmal begeistert von der Krankengymnastin ihres Sohnes, die vor jeder Stunde sie als Mutter fragen würde: „Sie oder er?“ Und manchmal würde sie sich das Recht zu einem Gespräch mit dieser Frau „herausnehmen“, wohlwissend, dass sie nach diesem Gespräch, in dem sie offen Frust ,Ärger und Enttäuschung „ablassen“ könne, bestens gelaunt und wieder seelisch belebt ihr Kind betreuen kann. Wahrscheinlich hat so ein Gespräch für das Kind eine ebenso wichtige entwicklungsfördernde Bedeutung in Form einer zufriedenen Mutter wie die „Krankengymnastik auf neurophysiologischer Grundlage“. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig der ganzheitliche Blick auf das System Eltern-Kind und das Zutrauen in die Fähigkeit der Eltern ist, sich „zu holen“, was sie brauchen, wenn es ihnen angeboten wird. Weiterhin wichtig für die Eltern sind auf Seiten der Fachleute differenziertes fachliches Wissen mit „Blick über den Tellerrand“ und hohe, menschlich geprägte Einsatz- und Kooperationsbereitschaft der Fachleute, sowie aber auch deren Bereitschaft, sich auf das Kind einzulassen. „Erleben die Eltern des behinderten Kindes, dass ihr Kind von der jeweiligen Fachperson geschätzt und gemocht wird, wirkt sich dies positiv auf ihren Kontakt zu den Fachleuten aus, ist dies nicht der Fall, wird eine Zusammenarbeit deutlich erschwert“ (Eckert, 2002: 233). Wichtige Aspekte beim Aufbau einer tragfähigen Beziehung, die durch gegenseitiges Vertrauen geprägt ist, sind die Wechselseitigkeit des Austausches, die Wertschätzung der elterlichen Kompetenzen durch die Fachleute, Offenheit im Gespräch sowie auch Interesse der professionellen Helfer an der familiären Lebenswirklichkeit, natürlich unter Bewahrung absoluter Verschwiegenheit. Aber das verstärkte Angewiesensein auf
19 institutionelle Angebote durch die besondere Situation mit dem behinderten Kind kann aus Elternsicht beispielsweise als selbstverständliche Notwendigkeit gesehen werden oder aber auch eine verstärkte Fremdbestimmung des familiären Lebens darstellen. Je nach persönlicher Lage der Eltern, nach Stimmung oder Situation kann diese Einstellung variieren, so dass für Fachleute auch immer eine gewisse Unwägbarkeit der elterlichen Bewertung gedanklich präsent sein sollte. Ich selbst empfinde es nach wie vor als Zumutung, dass man wie eine gläserne Familie unzähligen Außenstehenden Einblicke in sein Familienleben geben muss. Die fast überwiegend negative Sicht „unserer“ Familien in der Literatur resultiert m. E. unter anderem auch aus diesen vielen „Fenstern“, die – ungewollt – Eltern Fachleuten geben müssen. Wer das Kind wann und wie zu Bett bringt, wie man die nächtliche „Bewachung“ organisiert, wann man den Haushalt erledigt, wie man das Geld ausgibt , ob und wie man in Urlaub fährt usw. usw., alles Dinge, die normale Familien niemals Außenstehenden offenbaren müssten. Auch wenn man es nicht will.....zwangsläufig muss man sehr viel von sich erzählen bzw. lässt sich implizit vieles erfahren und man weiß nicht, wie der Andere dies einordnet oder auch bewertet. Wer nicht selbst mit einem geistig- oder schwermehrfachbehinderten Kind zusammenlebt, kann einfach vieles nicht nachvollziehen, macht sich falsche Vorstellungen und ordnet so Erzählungen Betroffener vorschnell falsch ein. Erfahrungsgemäß lässt der Förderdruck mit den Jahren deutlich nach, aber die Bedeutung der Fachleute, ihre Meinungen und Ansichten, auch ihre Reaktionen auf das Kind bleiben nach wie vor unverändert hoch, ebenso die Sensibilität der Eltern gegenüber der Umwelt, unter der sie oft leiden müssen (z. B. wegen Tuschelns oder Anstarrens der Mitmenschen), der sie aber auch oft eigene Projektionen unterstellen. Mit diesem emotionalen „hochexplosiven“ Gefühlsgemisch, das den Eltern weder bewusst noch von ihnen intendiert ist, treten sie dann natürlich allen weiteren Fachleuten in ihrem Leben (z. B. den professionellen Betreuern ihrer Kinder in Wohnheimen) entgegen, eine, in der Folge, für alle Beteiligte hochsensible Gratwanderung im Bemühen um ein gutes Verhältnis. Nach wie vor sind für mich alle meinen Sohn mitbetreuenden Fachleute, egal ob Wohnheimbetreuer, die Lehrerin oder der Arzt sehr wichtig. Ob ich will oder nicht, ich werte ihre Aussagen nicht nur auf einer rationalen Ebene sondern „sauge“ sie auch emotional auf. Dabei versuche ich unwillkürlich herauszuhören, wie diese meinen Sohn sehen, ob sie ihn mögen und akzeptieren, was mir z. B bei meinem nichtbehinderten Sohn relativ egal ist. Von anderen Eltern erlebe ich auch oft eine regelrechte Idealisierung z. B. eines bestimmten Lehrers oder Betreuers, der es mit dem Kind
20 besonders „gut kann“ und dadurch schon fast selbst, überspitzt ausgedrückt, eine Le- gitimation zum „Familienmitglied“ hat. Zwischen den unterschiedlichen Lebenswelten der Familie und der des Heimes steht ein Entschluss, dessen Tragweite für die Familie von Heimseite oft nicht gesehen werden kann, was zu Fehleinschätzungen der Situation der Eltern durch die Heimmitarbeiter führen kann. Mit meinen folgenden Ausführungen möchte ich diesen Entschluss und seine Umsetzung aus Sicht der Eltern näher beleuchten.
21 2. Das Heim als „Zweites Zuhause“ für das behinderte Kind 2.1. Der Entschluss „Als die Zeit fortschritt, wurde es auch offenbar, dass mein Töchterlein seine eigenen Gefährten finden müsse. Die Freunde, die bei mir kamen und gingen, konnten niemals seine Freunde sein. So gut und mitleidsvoll sie waren, empfanden sie doch das Kind als eine Anstrengung, und umgekehrt waren sie wieder eine Anstrengung für das Kind und für mich. Es wurde durch diese Tatsachen klar, dass ich ihm eine Welt suchen und finden und es dann hineinversetzen müsse“ (Buck,1975: 52). So beschrieb Pearl S. Buck ihre Empfindungen, die den Entschluss, ein Heim für ihr Kind zu suchen, reifen ließen. Sie suchte für ihr Kind ein Zuhause, eine andere Welt, „...in der es nicht verachtet und zurückgestoßen würde, wo es sein eigenes Niveau finden, wo es Freunde und Zuneigung, Verständnis und Würdigung haben könnte“ (53). Der Gedanke an ein anderes Zuhause neben der Familie wird von den betroffenen Eltern zumeist jahrelang tabuisiert, oft jahrzehntelang verdrängt. So ist es u. a. auch zu erklären, dass ca. zwei Drittel aller geistig behinderten Menschen auch noch in fortgeschrittenem Alter bei den ebenso alternden Eltern leben. Einen Königsweg gibt es hier für die Eltern nicht: Es gibt keine tradierten oder verlässlichen Regeln, wann der heranwachsende oder erwachsene geistig behinderte Mensch das Elternhaus verlassen soll oder kann, es gibt keinen „normalen“ Weg, kein erprobtes Verhaltensmuster. Auch Empfehlungen von Fachleuten reichen immer noch von der Abgabe sofort nach der Geburt bis zur Feststellung, dass solch ein Mensch doch lebenslang zur Familie gehört, wenn auch in der aktuellen Literatur zu diesem Thema immer wieder, als Ausfluss des Normalisierungsprinzips, darauf hingewiesen wird, dass geistig behinderte Menschen im selben Alter wie andere junge Menschen auch das Elternhaus verlassen sollten. Tatsächlich leben auch, nach Einschätzung von Kemme / Kursawe / Thimm (1999: 5), ca. 16.000 Kinder in Heimen der Behindertenhilfe, obwohl die Familie nach herrschender fachlicher Einschätzung immer noch die beste erste Sozialisationsinstanz darstellt. Gründe für die Heimunterbringung von relativ kleinen Kindern (z. B. aufgrund fehlender ambulanter Hilfen) sind wenig er-
22 forscht und anders zu bewerten als der Auszug von Jugendlichen und Erwachsenen aus dem Elternhaus im Sinne der Ablösung (vgl. Kemme / Kursawe / Thimm, 1999: 8). Kinder bleiben, auch als Heranwachsende und Erwachsene, für ihre Eltern auf eine Art immer Kinder, wie viel schwerer ist es für Eltern geistigbehinderter Kinder, die permanent Unterstützung brauchen, diese als endlich Erwachsene zu sehen und sie „gehen“ zu lassen. Allen Eltern fällt es schwer, ihren Kindern Erwachsensein zu un- terstellen, aber Eltern „normaler“ Kinder werden durch diese einfach dazu gezwungen, denn deren natürliche Entwicklung zu Selbständigkeit und damit verbundener Unabhängigkeit sowie ihr gesellschaftlich erwartetes Handeln (Ausbildung, Beruf, eigene Familie) lässt in der Regel keinen anderen Weg zu. „Während Ausbil- dungsabschluss, Berufstätigkeit, finanzielle Selbständigkeit und Auszug Anhaltspunkte dafür bieten, in welchem Maße sich ein junger Erwachsener durch „selbstständige Lebensführung“ vom Elternhaus ablöst, bieten Partnerbindung, Eheschließung und Elternschaft Anhaltspunkte für die emotionale Ablösung und Beziehungsstruktur zwischen erwachsenen Kindern und ihren Eltern“ (Vaskovics,1997: 33). Im Extremfall der schweren geistigen Behinderung oder schwerstmehrfachen Behinderung gibt es hingegen keinen dieser Anhaltspunkte als Indiz für eine Ablösung des behinderten Menschen von seinen Eltern, was bei die- sen völlige Ahnungslosigkeit, wie sie sich nun verhalten sollen, bewirkt. Unter pädagogischen Gesichtspunkten stellt Struck fest: „Eltern müssen die Reifung ihrer Kinder innerlich mitvollziehen, und sie sollten mit dem Bewusstsein erziehen, dass sie sich selbst immer mehr überflüssig zu machen haben“. Und weiter: „Die langsame Ablösung vom Elternhaus ist ein ganz natürlicher Prozess und meistens nur schmerzhaft für klammernde Eltern voller Besitzansprüche an ihre Kinder und solche Mütter und Väter, die ihre Töchter oder Söhne als Partnerersatz missverstanden haben“ (1995: 193). Auch Eltern geistig behinderter Kinder wollen keine „klammernden“, ihre Kinder für eigene Zwecke „missbrauchenden“ Eltern sein, aber: „Wenn Eltern die Behinderung ihres Kindes akzeptiert haben, so fällt ihnen das Loslassen besonders schwer. Sie haben gelernt, das eigene Lebenskonzept so zu verändern, dass das Kind mit seinen Beein- trächtigungen und mit seinem besonderen Unterstützungsbedarf darin einen guten Platz hat“ (Klauß1, 1999: 5). Dabei fällt es den Eltern schwer, die Veränderung ihres Kindes in der Pubertät als „Loslass-Versuch“ zu werten,
23 zumal dann, wenn sie keine Vergleichsmöglichkeit mit Geschwisterkindern haben. „So sieht sich die Bezugsperson häufig einem Jugendlichen gegenüber, der zwar seine Loslösung anstrebt, um seinen Freiraum kämpft und sich dabei wie ein Trotzkind gebärdet, im nächsten Augenblick aber symbiotische Bedürfnisse äußert, Körperkontakt sucht, schmust und unter starken Trennungsängsten leidet“ (Senckel, 1994: 101). Und immer geht es beim „Loslassen“ behinderter Kinder nicht um ein passives „Weggehen-Lassen“ des Kindes, sondern um aktives „Weggeben“ in völlig fremde Hände, ein Unterschied, der im Empfinden der Eltern und auch objektiv sehr schwer wiegt, zumal bei sehr schwer mehrfachbehinderten Kindern. Unter der Überschrift „Loslassen - Gedanken einer Mutter“ beschreibt Renate Helling als Mutter einer schwerstbehinderten 35-jährigen Tochter sowohl ihre als auch die Probleme der Tochter mit dem von Fachleuten so oft unbedacht leichtfertig gefordertem „Loslassen“: „Chantal verstand die Welt nicht mehr. Sie schrie ihren Schmerz des Losgelassenwerdens hinaus.“ Und: „Sind wir froher und glücklicher seitdem wir Chantal losgelassen haben?“ Sie beschreibt, dass sie ihr Kind nun wieder jedes Wochenende bei sich pflegt. Sie selbst hätte das „Loslassen“ weitgehendst wieder aufgegeben, da alle nur darunter gelitten hätten. Und zum Schluss stellt sie die, wohl alle Eltern in vergleichbarer Lage, bewegende Frage: „Aber wer lässt schon ein zweijähriges Kind los in die Obhut vieler fremder Hände?“ (Helling, 2001: 7). Aber auch wenn dann die äußere Ablösung zu klappen scheint und alle können gut mit dem veränderten Beziehungsrhytmus leben; die innere Ablösung braucht wahrscheinlich noch sehr viel Zeit und ist in den meisten Fällen erst mit dem Tod der Eltern endgültig. Die „innere“ Nabelschnur pulsiert immer. Ich kenne viele ältere Mütter, die würden gerne – obwohl ihr Kind schon lange in einem Heim lebt – in dessen „Grab schauen“, bevor sie selbst „gehen“ müssen. Mitarbeiter in Wohngruppen müssen um diese emotionale Befindlichkeit der Eltern wissen und versuchen, Eltern das Gefühl zu geben, es geht auch irgendwann ohne sie gut für das Kind weiter. Damit tragen sie Verantwortung für das, ich nenne es mal „Seelenheil“ der Eltern zu Lebzeiten.
24
(Quelle: „Orientierung“ 1/2003: 11)
Nun möchte ich noch einen anderen, sehr wichtigen, die äußerliche Ablösung
betreffenden Punkt ansprechen. Nachdenklich hat mich die Studie von Klicpera /
Gasteiger–Klicpera über „Einstellungen von Angehörigen und Betreuern zum Leben
eines erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung in der Familie und im Heim“
gemacht. Mit durchschnittlich 40% äußerten sich die Angehörigen gegen ein anderes
Zuhause für ihr erwachsenes behindertes Kind mit dem Grund, der behinderte Mensch
würde den anderen Familienmitgliedern „abgehen“ (Klicpera 1998: 115).
Auch ich habe in Gesprächen mit anderen Eltern sehr oft das Gefühl, dass sie ihr
behindertes Kind, egal, wie alt es ist, einfach nicht gehen lassen wollen, weil es ihnen
so sehr fehlen würde, und ich selbst kenne diesen unglaublich zwingenden Impuls, den
alle Eltern kennen, natürlich auch. Dazu gesellt sich noch das Gefühl, dass Fremde
das Besondere gerade des eigenen Kindes eh nicht schätzen werden können, so dass
eine regelrechte symbiotische Verschmelzung von Eltern und Kind auf Dauer existieren
kann. Eltern ist dieser Mechanismus nicht bewusst, zumal im anstrengenden Alltag
Gedanken daran oft gar keine Chance haben, erst aufzukommen oder aber rigoros
verdrängt werden. Auch die schrittweise Ablösung, wie sie bei normalen Kindern die
Regel ist, z. B. durch Übernachtungen bei Freunden, Verwandten, im Kindergarten, mit
Freizeitgruppen, bei Klassenfahrten und Schulfreizeiten, ist oft bei behinderten Kindern25 aus verschiedenen Gründen, die sich unter anderem aus der Schwere der Behinderung ergeben, nicht im normalen Umfang möglich. Erst als mir einmal ein Lehrer nach der ersten Klassenfahrt mit meinem Sohn sagte, ich solle ihn unbedingt öfters alleine Fahrten mit anderen Menschen machen lassen, er habe den dringenden Eindruck, der Junge bräuchte mehr Freiheit und autonome Entscheidungsmöglichkeiten, fiel es mir „wie Schuppen von den Augen“ und ich konnte überhaupt erst einmal ein Bewusstsein für die Autonomiebedürfnisse meines Kindes entwickeln, zu sehr standen bis dahin Pflege, Versorgung und Schutz seiner körperlichen Bedürfnisse im Alltag im Vordergrund. Diesem Lehrer bin ich noch heute dankbar für sein sensibles Beobachten der Kinder und mutiges Ansprechen der Eltern. Ängste, Unsicherheiten, ambivalente Gefühle, Schuldgefühle und Pflichtgefühl lassen den Gedanken an ein weiteres Zuhause für das Kind „undenkbar“ erscheinen.........bis der Gedanke dann doch auf einmal irgendwie da ist! Vielleicht, weil ein Fachmann mal von einem guten Heim erzählte, weil der Klassenkamerad oder Werkstattkollege nun in einem solchen wohnt oder weil ein Elternteil schwer erkrankt ist und die häusliche Situation zu eskalieren droht und Alternativen gesucht werden müssen, aber auch weil der Gedanke an die Zukunft nicht mehr länger verdrängt werden kann. Im Prinzip müssen rationale Gründe die emotionalen Befindlichkeiten „besiegen“, sonst kommt es nie zu dieser, den Alltag und das Leben aller Beteiligten gravierend verändernden Entscheidung. Hinsichtlich des Auszugsalters der behinderten Menschen hat sich in den letzten Jahren eine Änderung ergeben. „Auch konnte ein deutlicher Unterschied zwischen den Elterngenerationen bei der Unterstützung der Ablösung vom Elternhaus festgestellt werden; jüngere Eltern sind eher bereit, die Ablösung als eine selbstverständliche Entwicklung anzusehen und sich bei der Gestaltung der künftigen Wohn- und Lebensform zu engagieren“ (Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, 2002: 102). Diese Entwicklung kann ich auch in meinem Bekanntenkreis beobachten. Trotzdem dauert es oft noch Jahre, bis der Entschluss im Kopf dann wirklich realisiert wird. Dabei sind sowohl die in den letzten Jahren ausgebauten ambulanten Entlastungs- sowie Freizeitangebote als auch das in der Familienkasse oft nicht mehr wegzudenkende Pflegegeld auch noch Gründe für die „Vertagung“ der Entscheidung. 2.2. Die Umsetzung
Sie können auch lesen