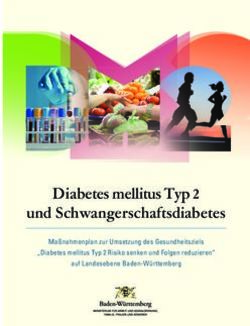ETUDES ET CONFÉRENCES - Inklusion - Sammlung der Beiträge der dritten nationalen Konferenz zur non-formalen Bildung im Kinder- und Jugendbereich ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
ETUDES ET CONFÉRENCES Inklusion Inklusion Inklusion Sammlung der Beiträge der dritten nationalen Konferenz zur non-formalen Bildung im Kinder- und Jugendbereich
Inhaltsverzeichnis
Vorwort3
I. Inklusion 5
I. 1. Konzepte,Befunde aus der Forschung und wie Sprache Teilnahme ermöglicht
Germain Weber
I. 2. Vers un système plus inclusif : renforcer la fonction sociale des lieux d’éducation et d’accueil de jeunes enfants.
Anne-Françoise Dusart ; Joëlle Mottint
I. 3. Prozesse inklusiver Kinder- und Jugendarbeit
Anke Oskamp
II. Beispiele der Praxis 35
II. 1. Incluso (A.P.E.M.H.)/Maisons Relais Commune Differdange
II. 2. Maison des jeunes «An der Sonn» : Theater an der Sonn
II. 3. Maison Relais Redange/Attert
III. Diskussionsgruppen 43
III. 1. Petite Enfance
III. 2. Petite Enfance et Enfance
III. 3. Enfance 1
III. 4. Enfance 2
III. 5. Jeunesse 1
III. 6. Jeunesse 2
Im Rahmen der Qualitätsentwicklung in der außerschulischen Kindertagesbetreuung und der Jugendarbeit wurde
die dritte Konferenz zur non-formalen Bildung unter das Thema «Inklusion» gestellt. Die Pädagogik der Inklusion
betrachtet die Verschiedenheit aller Menschen als Normalität. An diese Normalität sind die Strukturen anzupassen -
nicht umgekehrt.
Verschiedene Experten erläuterten in ihren Vorträgen den Inklusionsbegriff sowie die Anforderungen an die
Einrichtungen und an die Fachkräfte um die Inklusion bestmöglich umzusetzen.
Praxisbeispiele aus Luxemburg und Diskussionsgruppen regten dazu an, die eigene pädagogische Arbeit zu
reflektieren und gemeinsam neue Wege zu gestalten.
An der Konferenz vom 2.12.2014 (Parc Hôtel Dommeldange) nahmen in etwa 220 pädagogische Fachkräfte
aus Kindertageseinrichtungen und Jugendstrukturen teil.
Impressum
Editor Service National de la Jeunesse
Layout und Realisation reperes.lu Erscheinungsjahr 2015
2Vorwort
Inklusion ist als grundlegendes Konzept, sowohl im öffentlichen Diskurs als auch in der pädagogischen Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen, in den letzten Jahren in den Vordergrund gerückt. Dabei geht es auch, aber
nicht ausschließlich, um die Teilnahme von Menschen mit Behinderung : Der moderne Inklusionsbegriff steht für
eine uneingeschränkte Teilnahme aller Menschen an sämtlichen Prozessen und Aktivitäten der Gesellschaft.
Die nationalen Leitlinien zur non-formalen Bildung betonen in diesem Sinn, dass inklusives Denken auf der
Wertschätzung von Verschiedenartigkeit beruht : „Eine inklusive Pädagogik schafft eine Lernumgebung, die den
individuellen Lernansprüchen und - dispositionen aller gerecht wird und jedem einzelnen Kind bzw. Jugendlichen die
Entfaltung seiner Potenziale ermöglicht.” (Leitlinien zur non-formalen Bildungen im Kindes-und Jugendalter ; www.
enfancejeunesse.lu/leitlinien)
In anderen Worten : Inklusion bedeutet die Vielfalt der Gesellschaft als Entwicklungschance zu sehen und zu
nutzen. Während der dritten Konferenz zur non-formalen Bildung im Kindes-und Jugendalter (2.12.2014) haben
die verschiedenen Referenten diese „Vision für das Zusammenleben aller Menschen” (Anke Oskamp) aus
unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.
Germain Weber, Dekan der Fakultät für Psychologie der Universität Wien betont,dass Inklusion ein Paradigmen
wechsel bedeutet und dann lebendig wird, wenn es den verschiedenen Akteuren gelingt zu neuen sich gegenseitig
respektierenden und unterstützenden Formen des Zusammenlebens zu kommen.
Anne-Françoise Dusart und Joëlle Mottint, Projektleiterinnen bei „Réseau des initiatives Enfants-Parents-Professionnels”
unterstreichen die Wichtigkeit der außerschulischen Kindertagesbetreuung für die soziale Inklusion : “…la crèche,
l’école maternelle, les activités extrascolaires et autres lieux d’éducation et d’accueil de jeunes enfants représentent de
formidables vecteurs d’inclusion sociale pour les familles, en particulier pour les plus fragilisées d’entre elles.”
Anke Oskamp, Preisträgerin 2013 von „Inklusion geht doch !”, regt mit ihrer Checkliste für inklusive Kinder-und
Jugendarbeit dazu an, sich umfassend mit dem Thema Inklusion in der eigenen Praxis zu beschäftigen : ”Inklusion
ist vor allem die Forderung nach einer Haltung, die geprägt ist von dem Wunsch und dem Willen, jeden Menschen
teilhaben zu lassen an Gesellschaft.”
Neben diesen drei Vorträgen der Konferenz findet der Leser in der vorliegenden Veröffentlichung konkrete Beispiele
aus der Praxis im Kinder-und Jugendbereich :
• Die konsequente Umsetzung von Inklusion in den Kindertagesstätten (Maisons Relais) der Gemeinde
Differdingen mit der Unterstützung von INCLUSO ; Association des parents d’enfants mentalement handicapés
(APEMH).
• Das schon seit mehreren Jahren durchgeführte integrative Theaterprojekt vom Jugendhaus „An der Sonn“
mit der a.s.b.l. Trisomie 21.
• Ein konkretes Fallbeispiel von Umsetzung des Inklusionskonzeptes in der Maison Relais „Beiestack“
(Maison Relais Redange).
Wie auch bei den vorherigen Konferenzen hatten die Teilnehmer die Möglichkeit sich am Nachmittag auszutauschen
und die pädagogische Inklusionsarbeit zu reflektieren : Die Protokolle der Diskussionsgruppen zeigen u.a. auch,
dass Inklusion und die Voraussetzungen hierzu, gemeinsam als Team getragen werden müssen, die pädagogische
Haltung des Fachpersonals wesentlich ist und jedes Kind bzw.Jugendlicher „Inklusion braucht“. Es ist nicht zielführend
“auf die Defizite einzelner Kinder zu fokussieren. Vielmehr ist die gesamte Gruppe der von uns betreuten Kinder ein
gemeinsames Ganzes mit individuell verschiedenen Stärken und Schwächen“ (Protokoll Arbeitsgruppe Enfance 2).
Die Konferenz wurde organisiert vom Ministerium für Bildung, Kinder und Jugend und dem Service national de la
jeunesse mit der Unterstützung von der Entente des Foyers de jour a.s.b.l., der Agence Dageselteren (Arcus a.s.b.l.),
der Unité de Formation et d’Education Permanente (A.P.E.M.H. a.s.b.l.), der Croix-Rouge und der Entente des
gestionnaires des maisons de jeunes a.s.b.l.
Die Vorträge und weiterführende Dokumente zur Konferenz können ebenfalls auf der Internetseite des Weiterbildungs
portals www.enfancejeunesse.lu eingesehen werden.
C. Bodeving, M. Achten, C. Meyer
3I Inklusion
5Inklusion
I.1. Konzepte, Befunde aus der Forschung und
wie Sprache Teilnahme ermöglicht1
Prof. Dr. Germain Weber
In vielen europäischen Ländern prägt das Thema Inklusion in den letzten Jahren zunehmend den
gesellschaftspolitischen Diskurs. Der Begriff Inklusion, eng verbunden mit der gesellschaftlichen Exklusion von
Randgruppen, wie beispielsweise Menschen mit Behinderung, schließt dabei zu anderen großen Themen und
Herausforderungen unserer Zeit an. Auf einen ersten Blick scheinen einige von diesen zur Inklusionsthematik weit
entfernt, wie etwa die Fragen zur ökologischen Nachhaltigkeit, oder der Umgang mit knappen Ressourcen bzw.
das Thema der Stärkung demokratischer Prozesse und Strukturen. Auch wirtschaftliche Herausforderungen, ob
bereits spürbare oder absehbare, sowie die Finanzkrisen in Europa werden eher mit globaleren Verschiebungen
in diesen Bereichen diskutiert und kaum in Zusammenhang mit gesellschaftlicher Inklusion gesehen. In einem
gewissen Naheverhältnis zu den Themen Integration bzw. Inklusion werden dann schon jene gesellschaftlichen
Problemzonen besprochen, die mit der hohen (Jugend-) Arbeitslosigkeit verbunden sind und dem häufig damit
einhergehenden steigenden Extremismus. Inklusion kennen wir dann vor allem aus unseren Debatten um das
Bildungssystem. Auch Veränderungen im Migrationsverhalten, aber vor allem die Herausforderungen, die mit der
demographischen Alterung unserer Gesellschaften einhergehen, sieht man durchaus im Kontext von Inklusion. Und
Behinderung ist, par excellence, das Thema für Inklusions- und früher von Integrationsdebatten. Allein eine zarte
Vorschau der Auswirkungen einer „Geronto-Gesellschaft“ auf den im Nachkriegseuropa konzipierten Wohlfahrtsstaat,
lässt keine Zweifel aufkommen, dass das gewohnte soziale Modell in vielen Regionen markant unter Stress kommen
wird. Das gemeinsame an allen Themen dürfte sein, dass deren Bewältigung mit gewichtigen gesellschaftlichen
Transformationsprozessen einhergehen wird. Zu den beiden Kategorien Bildung und Soziales werden
gesellschaftliche Verhaltensänderungen unter anderem aus einer Inklusionsperspektive erörtert und entscheidend
für den Erfolg aus der Debatte wird die Neuformulierung von zentralen gesellschaftsethischen Fragen und den
daraus abgeleiteten Antworten sein. Weiter ist nicht auszuschließen, dass ein, vom Inklusionsthema abgeleiteter
Diskurs, eine Brücke für gesellschaftliche Neugestaltung in jenen Herausforderungsbereichen schlagen kann, deren
Verhältnis zur Inklusionsthematik heute nicht so evident erscheint.
Inklusion und gesellschaftlicher Wandel
Insgesamt steht viel auf dem Spiel : sozialer Frieden und die damit verbundene zukünftige Lebensqualität der
Menschen in diesen Gesellschaften. Ausschlaggebend für diese zukünftige Lebensqualität wird sein, wie es uns
gelingen wird, den gesellschaftlichen Zusammenhalt neu zu weben. Hierbei dürfte das in den letzten Jahren
gesellschaftlich breit getragene und rechtlich gestärkte Prinzip der Nicht-Diskriminierung eine mitausschlaggebende
Rolle spielen. Und zwar in dem Sinne, wie es uns gelingt Nicht-Diskriminierungs-Denken im gesellschaftlichen
Zusammenleben des Alltags aufzunehmen und zu leben. Eine neue Fairness in der Verteilung wirtschaftlicher
und sozialer Güter wird zu suchen sein. Der Erfolg aus solchen Transformationen wird unter anderem, vom Grad
der gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe aller Personen abhängen, d.h. inklusive der Menschen mit
Behinderungen, deren Platz traditionell am Rande der Gesellschaft zugeordnet war. Und gesellschaftliche Teilhabe
wird sehr stark davon abhängen, wie es uns gelingen wird, neuartige Kooperationsformen zur Sicherstellung des
Unterstützungs- und Begleitbedarfs in unseren Sozialräumen zu entwickeln.
Vor allem Menschen mit intellektuellen oder psychischen Beeinträchtigungen lebten und leben weiterhin
mancherorts in Europa sehr fernab von dem, was unter gesellschaftlicher Teilhabe zu verstehen ist. Sie sind in
ihren fundamentalen Rechten gravierend beschnitten, was einen Lebensweg gemäß eigenen Vorstellungen stark
einschränkt bzw. unterbindet. Wie gesagt, wird die Inklusionsdebatte häufig auf die Situation von Menschen
mit Behinderung bezogen. Von Veränderungen, die aus diesem Diskurs hervorgehen, wird ein Mitzieheffekt für
manche andere der erwähnten Herausforderungsfelder oder Randgruppen zu erwarten sein. Und das macht
die Inklusionsdebatte nicht nur spannend sondern hebt ihre breitere gesellschaftliche Relevanz hervor. Bisherige
Annahmen und eingeschlagene Wege bzw. wie wir Dinge bisher getan haben, werden vermehrt hinterfragt. Die
Auswirkungen dieser Veränderungen auf den sozialen Frieden gilt es prospektiv zu verstehen, um zu entsprechenden
1 Der Beitrag wurde zuerst veröffentlicht in : Beiträge zur Inklusion. Non-formale Bildung und Betreuung in früher Kindheit und im
Schulalter Band 2. Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, 2014
6Maßnahmen und Prozessen einzuladen, die neue Wege sozialen Zusammenhalts und sozialer Resilienz eröffnen.
In diesem Kontext ist Inklusion, als politische Idee zu verstehen, im Sinne eines weitreichenden Leitgedankens für
anstehende gesellschaftliche Transformationsprozesse.
Inklusion als Generator jenes sozialen Kitts, mit dem notwendige Transformationen auf vertrauensvollem Weg, eher
friedlich gemeistert werden könnten ? Oder, Inklusion als die soziale Energie zur nachhaltigen Neuentwicklung des
sozialen Zusammenhalts in unseren Gesellschaften in einer Epoche größerer Transformationen ?
Entscheidend bei der Beantwortung dieser Fragen wird sein, wie Gesellschaften das Miteinander ihrer Vielfalt
neu aufsetzen und dabei jene Fähigkeiten entwickeln, über die sich soziale und wirtschaftliche Teilnahme sowohl
verantwortungsvoll als auch vertrauenswürdig neu organisieren und leben lässt.
Geschichtlich gesehen sind gesellschaftliche Transformationsprozesse eng an jeweils neue politische Ideen
gebunden. Es wäre überzogen, die Idee der Inklusion im direkten Verhältnis zu großen Entwürfen der politischen
Ideengeschichte zu sehen. Gelingt es aber, ein gut abgestimmtes Verständnis zur Idee und zum Thema Inklusion
innerhalb der Gesellschaft aufzubauen, welches quer durch gesellschaftliche Gruppierungen mitgetragen wird,
könnte diese sowohl bescheidene, als auch überzeugende Idee der Inklusion, ein nicht unbedeutender Bestandteil
einer breiteren gesellschaftlichen Transformationsstrategie darstellen.
Was verstehen wir unter Inklusion und was meinen wir damit ?
Die Idee der Inklusion hat ihre Wurzeln in einem menschenrechtlichen Denken. Unter Inklusion werden die
gesellschaftliche Anerkennung der universellen Einzigartigkeit und die Anerkennung der gegenseitigen Abhängigkeit
verstanden. Dies bildet die Grundlage einer Ethik der anerkannten Abhängigkeit, die durch Gegenseitigkeit
begründet ist (MacIntyre, 2001). Diese Grundlage, die nicht direkt an einen bestimmten religiös definierten
Handlungsrahmen gebunden ist, dürfte für Transformationsprozesse in multikulturellen Gesellschaften eine breit
getragene Legitimität finden. Mit Inklusion wird auch anerkannt, dass wir in unserer Gesellschaft, unserem Land,
unserer Region, unserer Gemeinde, eine Einheit sind, dies obwohl wir nicht die Gleichen sind. Dabei wird die
Vielfalt unter uns durch verschiedenste Faktoren bedingt, sei es das Geschlecht, der kulturelle oder religiöse
Hintergrund, die geschlechtliche Orientierung oder aber die Beeinträchtigung und die Behinderung. Aus dieser
Perspektive und im Sinne der Interdependenz meint Inklusion, dass wir in unserer Gesellschaft auch jene Förder-
und Unterstützungssysteme sicherstellen, die es dem Einzelnen ermöglichen, gleichberechtigt am Leben in der
Gesellschaft teilzunehmen. Demnach sind Unterstützungssysteme zur Sicherstellung gesellschaftlicher Teilhabe
nicht Ausdruck von Wohlwollen der Gesellschaft gegenüber den nicht so „Glücklichen“, sondern diese Unterstützung
wird aus dem Verständnis ziviler Verantwortung begründet. Auf diesem Hintergrund meint Shafik Asante : „Wir
wurden alle in eine Gesellschaft geboren“ (2002, S. 1). Und sinngemäß erläutert er weiter, dass wenn es uns gelingt,
diese Aussage als wahr zu würdigen, sich die Gesellschaft, im Sinne von gesellschaftlichem Zusammenhalt und
Lebensqualität des Einzelnen und von Gruppen, schlagartig verbessern würde.
Wird die Vielfalt und die Heterogenität einer Gesellschaft als selbstverständlich und zueinander gehörend gesehen,
folgt diese dem Gedanken der sozialen Inklusion. Diesem Denken liegen ein Zugehörigkeitsverständnis aller Mitglieder
sowie ein Verständnis der gegenseitigen Verbindung und prinzipiellen Mitverantwortung zwischen den einzelnen
Teilnehmern der Gesellschaft zu Grunde. Dies erlaubt es jene Distanzen, Barrieren und Abtrennungen zu überwinden,
die gesellschaftlich durch die vielen Spezialstrukturen aufgebaut und gepflegt wurden, und die wir für all jene Gruppen
vorgesehen hatten und haben, die von uns als gesondert angesehen wurden und werden (Weber, 2009).
Parallel zum stetigen Ausbau an Spezialstrukturen, wie z.B. im Behindertenbereich oder im Altenpflegewesen,
hat sich in den letzten Jahrzehnten eine exponentiell gewachsene professionelle Leistungserbringungslandschaft
entwickelt. An vielen Orten existieren diese Sektoren nebeneinander. Diese Sektoren benutzen unterschiedliche
Philosophien und viele davon respektieren, die sich aus einer menschenrechtlichen Perspektive ergebenden
Anforderungen nicht. Für die Nutzer dieser Sektoren geht das oft mit gravierenden Benachteiligungen hinsichtlich
gesellschaftlicher Teilhabe einher. Soziale Unterstützung und Pflege wurde zunehmend an eine hochprofessionelle
und hochspezialisierte Welt delegiert. Dabei leben viele Nutzer dieser Sektoren an Orten, wo eigentlich viele
Menschen nicht wirklich leben möchten. Viele dieser Fragen werden in der Grazer Deklaration zu Alter und
Behinderung angesprochen (Weber & Wolfmayr, 2006). Inwieweit die Weiterführung dieses Modells zur Beantwortung
der anstehenden Fragen zweckmäßig sein wird, erscheint mehr als hinterfragungswürdig.
7Inklusion verlangt sowohl gesamtgesellschaftliche Anstrengungen als auch Anstrengungen von ihren Gruppen
sowie den einzelnen Personen. Im Unterschied zur Integration, wo die Anstrengungen von einigen wenigen
Personen bzw. einigen wenigen gesellschaftlichen Strukturen zum Wohle der zu Integrierenden geleistet wird,
werden Inklusionsleistungen, in der idealisierten Vorstellung, von allen teilnehmenden und handelnden Personen der
Gesellschaft erbracht. Mit Inklusion wird demnach nicht ein bloßer Begriffswechsel gemeint, sondern es handelt sich
um einen grundlegenden Wechsel der Perspektive, einen Paradigmenwechsel.
Der rasche Kritiker wird hier anführen, dass mit dem Inklusionsgedanken eine gesellschaftliche Utopie vorliegt, und
wir in wenigen Jahren diese Idee der Inklusion ad acta legen werden ! Oder ist Inklusion doch eine gesellschaftliche
Vision, mit einer klaren Zielsetzungen und konkreten Aufträgen für neu zu gestaltende Wege, die zu einem
gesamtgesellschaftlichen Mehrwert führen können ?
Wie zuvor erläutert, lässt sich Inklusion aus der Perspektive verschiedener Themen darstellen und analysieren. So
kann die Analyse entweder von bestimmten Personengruppen ausgehen, beispielsweise Menschen mit Behinderung
oder Menschen mit Migrationshintergrund oder es stehen „gesellschaftliche Strukturen bzw. „Funktions- und
Nutzgüter“ im Vordergrund, wie beispielsweise Schule, Arbeitswelt oder Sonderinstitutionen.
In den folgenden Ausführungen wir der Focus auf die Inklusion von Menschen mit Behinderungen gelegt, wobei
einige Ausführungen speziell auf Menschen mit Lernschwierigkeiten (intellektueller Beeinträchtigung) ausgerichtet
sind. Dabei werden ausgewählte Lebensbereiche exemplarisch herausgenommen, um die Wirkungsmöglichkeiten
von Inklusion bestmöglich zu verdeutlichen.
Inklusion und Behinderung
Die Arten und Weisen, wie wir über Menschen mit intellektueller, psychischer und/oder körperlicher Behinderung
gedacht haben, prägten den gesellschaftlichen Umgang mit diesen Personengruppen, dies mit allen damit
verbundenen Konsequenzen. Aus einer sozialhistorischen Herangehensweise lassen sich verschiedene
Denkansätze, hier zusammengefasst in ihrer zeitlichen Folge, beschreiben : Von der wilden Inklusion und Exklusion,
über Separation und Extinktion, zurück zur Separation, dann hin zur Normalisierung und Integration und nun in den
letzten Jahren Richtung Inklusion (erweitert, in Anlehnung an Wienberg, 2013). Dabei sehen wir, in welcher Weise die
jeweiligen Denkmuster, sowohl politische als auch ökonomische Prozesse im Behindertenbereich bestimmten und
dadurch jeweils Weichenstellungen für sehr unterschiedliche Lebenschancen von Menschen mit Behinderungen
gesetzt wurden.
Was kann Inklusion für Menschen, deren Leben von früh an durch Lernschwierigkeiten gekennzeichnet ist bzw.
deren intellektuell-kognitive Kompetenzentwicklungen, aus welchen Gründen auch immer, bereits ab einem sehr
jungen Alter Beeinträchtigungen zeigen, bedeuten ? Mit welchen Folgen hat diese Personengruppe durch eine Nicht-
Inklusionspolitik zu rechnen und welches sind gesamtgesellschaftliche Auswirkungen, die mit solchem Denken und
Handeln einhergehen ? Die folgenden Analysen lassen relativ leicht Analogien zu anderen Gruppen zu, Gruppen,
die wegen welchen anderen Merkmalen oder Merkmalskombinationen auch immer, aus der gesellschaftlichen Mitte
ausgeschlossen wurden.
Die über viele Jahre andauernde formalisierte Sonderstellung für Menschen mit Behinderungen hatte als
Folge, dass sie aus der Mitte der Gesellschaft ausgeschlossen waren. Mit Mitte ist jener Ort gemeint, der nicht
behinderten Gleichaltrigen in der Gesellschaft typischerweise angeboten wird. Menschen mit Behinderungen
und hier speziell Menschen mit intellektuell-kognitiven Behinderungen, waren und sind in unseren Gesellschaften
durch den systematischen Ausschluss in vielfältigster Form benachteiligt, und waren und bleiben in ihren Rechten
deutlich geschwächt. Dabei wird die Anzahl der von Behinderung betroffenen Menschen oft unterschätzt. In der
Europäischen Union leben beispielsweise ca. 80 Millionen Menschen mit Behinderungen und von denen wiederum
sind es ca. 5 Millionen Menschen mit intellektueller Behinderung, die „mit uns“ leben.
Der oben erwähnte Paradigmenwechsel wurde spätestens mit der UN Konvention zu den Rechten von Menschen
mit Behinderung (BRK) (UN, 2006) in die Wege geleitet. Entscheidende Motive zur Entwicklung dieser Konvention
sind in jener Tatsache zu sehen, dass Menschen mit Behinderungen in der Wahrnehmung ihrer Rechte im Vergleich
8zu Menschen ohne Behinderung weltweit benachteiligt und diskriminiert werden, dass Behinderung, global
gesprochen, hoch mit Armut korreliert und dies wiederum mit eingeschränkten Bildungschancen sowie zu geringen
Chancen hinsichtlich Teilnahme am Arbeitsmarkt führt.
Einzigartig für eine multinationale Menschenrechtskonvention ist, dass einmal durch das Parlament des jeweiligen
Landes ratifiziert, die BRK rechtsverbindlich ist. Das vorgeschriebene Monitoring zur Umsetzung der Prinzipien
und Rechte gibt Anlass zur gut begründeten Annahme, dass mit der Umsetzung der Konvention substantielle
gesellschaftliche Veränderungen verbunden sein werden. Dabei führt die BRK keine neuen Menschenrechte ein,
sondern präzisiert die allgemeinen Menschenrechte auf ihre jeweilige Relevanz für Menschen mit Behinderung. Und
damit bietet die BRK uns die Gelegenheit einige der fest verwurzelten Praktiken und politischen Grundsätzen in
Bezug auf Menschen mit Behinderung zu überprüfen.
Dem Dokument liegt das ethisch-rechtliche Prinzip zu Grunde, dass Menschen mit Behinderungen, wie alle
sonstigen Bürgerinnen und Bürger auch, das grundlegende Recht zur gleichberechtigten Teilhabe in der
Gesellschaft haben. Dies hat Implikationen für alle Lebensbereiche, und für alle Lebensphasen. Generell sollen mit
der Umsetzung der Konvention Benachteiligungen und Diskriminierungen gegenüber Menschen mit Behinderung
in der Gesellschaft abgeschafft werden. Mit der Ratifizierung der BRK durch das Europäische Parlament und
die EU-Kommission im Jahr 2010, wird der Wille zu Transformation einer Gesellschaft, in der Menschen mit
Behinderungen uneingeschränkt am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben teilnehmen können, explizit zum
Ausdruck gebracht. Eine Gesellschaft die niemanden ausschließt wird als wesentlich für intelligentes, nachhaltiges
und integratives Wachstum in der Europäischen Strategie zu Behinderung 2010-2020 eingestuft (EU-KOM, 2010).
Inklusive Grundhaltung
Der Grundstein einer inklusiven Haltung liegt in der prinzipiellen Akzeptanz des einzelnen Menschen in der
Gemeinschaft, in der er lebt, und in dem Umstand, dass diese Gesellschaft dem Einzelnen, Chancengleichheit in
der Entwicklung seiner Talente und Möglichkeiten sichert. In Analogie zur dieser bedingungslosen Anerkennung
gesellschaftlicher Zugehörigkeit des Einzelnen, kann aus psychologischer Sicht die ursprüngliche Akzeptanz
des Neugeborenen durch seine Eltern gesehen werden. In diesem neuen Beziehungsgeschehen entwickeln sich
Bindungsmuster, die für den Zusammenhalt prägend werden.
Die Mechanismen zur Entstehung von Diskriminierung, ein wesentlicher Aspekt wenn wir die Stärkung einer
inklusiven Grundhaltung in unserer Gesellschaft anstreben, lassen sich wiederum aus einer sozialpsychologischen
Perspektive beschreiben. Hier sind es Klischees und Stereotypen, die in der Entwicklung von Vorurteilen und
in weiterer Folge in der Entstehung und Aufrechterhaltung sozialer Gruppenzuordnungsprozessen von hoher
Wirksamkeit sind, und die in einem nicht zu unterschätzendem Ausmaß zu Ungleichheit und sozialer Diskriminierung
beitragen. Nach dem recht gut erforschten „stereotype content model“ entstehen Stereotype gegenüber einer
Personengruppe anhand von unbewussten Bewertungen auf zwei Dimensionen (Fiske et al., 2002). Einerseits
werden die Absichten eines Protagonisten der betreffenden Personengruppe als gut oder schlecht beurteilt
und anderseits werden auch dessen Fähigkeiten diese Absichten zu realisieren bewertet. Das Gefühl, oder
anders ausgedrückt das Vorurteil, mit dem wir auf die Hauptperson reagieren, bestimmt überwiegend das
Bewertungsergebnis, das in eine diskriminierende, diese Personengruppe ablehnende Haltung münden kann.
Neben der Entstehung von Stereotypen und Vorurteilen, liegen zu deren Vermeidung und dem Abtrainieren von
diesen auch gut abgesicherte Forschungsergebnisse vor. Zusammenfassend besagen diese Befunde, dass je
besser man eine Person kennenlernt, desto differenzierter sich das Bild, das man sich von dieser Person macht,
entwickelt. Der direkte und unmittelbare Kontakt ist demnach der günstigste Weg, wenn Klischeevorstellungen nicht
aufkommen bzw. abgelegt werden sollen. Klischeevorstellungen, Stereotypen und Vorurteile stellen, gesellschaftlich
gesehen, höchstwahrscheinlich die Hürde dar, die es in der Verfestigung der Inklusionsidee und der Verbreitung der
Inklusionshaltung zu überwinden gilt (Whitley & Kite, 2010).
In diesem Sinne kann mit inklusiven Begegnungszonen im Leben eines Menschen nicht früh genug begonnen
werden. Ein entsprechendes Angebot würde eine Gesellschaft, die in Richtung Inklusion denkt, bereits in jenen
Strukturen anbieten, in die wir Kinder ab dem frühesten Alter einladen und beginnt mit einer inklusiven Eltern-
Säuglingsberatung. Am Beispiel von Kindern mit Behinderung würde dies bedeuten, dass diese ab der Geburt nicht
ausgegrenzt werden sollen und die nicht behinderten Kinder somit weniger Stereotype und Vorurteile gegenüber den
anderen entwickeln.
9Inklusion und Schule
Eine Gesellschaft, die sich ihrer Diversität bewusst ist, setzt auf Inklusion und dies ab dem frühesten Lebensalter
ihrer Mitglieder. Hier führt ein inklusives Schulsystem, so die These, zu einem solideren gesellschaftlichen Fundament
für Chancengleichheit, Nicht-Diskriminierung sowie Akzeptanz und Respekt gegenüber dem, der heute noch als „ein
Fremder“ – ein Kind, ein Jugendlicher, ein Erwachsener mit Behinderung - erlebt wird.
International gesehen, kann in der ersten Dekade dieses Jahrhunderts eine zunehmende Nachfrage für die Inklusion
von Kindern mit Behinderungen in allen Ebenen der „mainstream“ Bildung beobachtet werden. Dies reicht vom
Inklusionsdiskurs auf der Ebene schulpolitischer Entscheidungsnehmern (Vlachou, 2004), über die Auswirkung
inklusiver vorschulischer Settings auf die Entwicklung der Kinder, dies aus elterlicher Sicht (Stahmer et al., 2003),
bis hin zur Akzeptanz von Lehrern und Lehrerinnen inklusive Unterrichtsmethoden im Rahmen von Weiterbildungen
zu erwerben (Molto, 2003). Erste Umstellungen auf ein inklusives Schulsystems erfolgten in einigen Ländern
bereits in den beiden letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts. Als Vorreiter sind skandinavische Länder, wie
beispielsweise Finnland, Norwegen und Schweden anzuführen, aber auch die autonome Provinz Südtirol setzte ab
Ende der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts systematisch auf die Umstellung eines integrativen und dann eines
inklusiven Schulsystems. Im Sinne einer nachhaltigen Stärkung inklusiver Beschulung hat Südtirol seit 2013 ein neues
gesetzliches Programmabkommen zwischen Kindergärten, Schulen und territorialen Diensten sowie Leitlinien für
die Zuweisung von zusätzlichem Personal erlassen. In den territorialen Diensten, ist das Arbeitsservice sowie das
Amt für Ausbildungs- und Berufsberatung neu als Programmpartner dazugekommen, Kooperationspartner, die in
der Vorbereitung des beruflichen Einstiegs insbesondere von Schülern mit besonderen Bedürfnissen zum Einsatz
kommen (Autonome Provinz Bozen, Deutsches Schulamt, 2014). Diese Entwicklung ist stringent, da verbindliches
Zusammenwirken von Strukturen, die bisher ohne systematische Berührungspunkte zueinander gekennzeichnet
waren, hier als entscheidend für die angestrebte Wirkung erkannt werden.
In Österreich, wo die Schulorganisation Länderkompetenz ist, zeigt sich das Bundesland Steiermark hinsichtlich
schulischer Inklusion als Vorreiter. Der Grund hierfür, recht einfach, war eine entsprechende politische Entscheidung !
Diese hat dazu geführt, dass im Schuljahr 2006/07 82,4 % der Kinder mit Behinderungen in der Steiermark in einem
inklusiven Setting beschult wurden. Dagegen ist im Bundesland Niederösterreich für Kinder mit Beeinträchtigung die
Sonderschule das Regelangebot, mit lediglich 32 % der Kinder mit Behinderung, die in integrativen Settings beschult
werden (Lebenshilfe Österreich, 2010).
In den Ländern und Gegenden, die ihr Schulsystem zu einem inklusiven entwickelt haben, werden die Eltern
typischerweise eingeladen, ihre Kinder vorrangig in diesem einzuschulen. In diesen Ländern oder Regionen wird
weiterhin, allerdings stark reduziert, spezifische Sonderschulstrukturen zur Verfügung gestellt, da diese für sehr
wenige Kinder mit Behinderung von Vorteil erscheinen (Gray, 2005). Der Erfolg einer inklusiven Beschulung steht
in engem Zusammenhang mit den investierten Ressourcen, einem qualifizierten und motivierten Personal, den
Kontexten und Rahmenbedingungen sowie nicht zu unterschätzen, der Bereitschaft und Kompetenz aller Involvierten
zur internen Problemlösung. Ein früher, bis heute sehr nützlicher Beitrag zur Entwicklung von Inklusionsprozessen in
Schulen und zur Bestimmung des Inklusionsindexes in diesen wurde von Booth und Ainscow (2002) vorgelegt und
eine deutschsprachige Adaptierung erfolgte durch Boban und Hinz (2003).
Zentrales Merkmal einer inklusiven Beschulung stellt der individuelle Bildungs- und Entwicklungsplan dar, erstellt mit
und für jeden einzelnen Schüler und daran gekoppelt der individualisierte Unterricht. Dabei wird der Lernprozess
typischerweise durch Team-Teaching und Peer-Teaching begleitet. Die Lehrer sind mit inklusiven Lernpraktiken
ausgewiesen und Fachkräfte benachbarter Professionen stehen für spezifische Bedarfssituationen zur Verfügung.
Im Alltag inklusiver Schulen werden die Schüler eingeladen, ihre Kompetenzen und besonderen Fähigkeiten auch
im Rahmen von Peer-Unterstützung und Peer-Förderung einzubringen. Dadurch werden über die akademischen
Kompetenzen hinausgehend, wichtige frühe Erfahrungen zu sozialen Skills im Umgang mit Verschiedenheit, wo
Behinderung eine besondere Position einnimmt, aufgebaut (Biewer, 2010). Diese frühen Erfahrungen im Umgang
mit Vielfalt und Behinderung dürften zur Grundsteinlegung für nachhaltige Akzeptanz und gelebten Respekt
und insgesamt zum Aufbau einer inklusiven Haltung entscheidend sein. Die Früchte aus einer frühen inklusiven
Sozialisation dürften weiterhin für eine erfolgreiche Neuausrichtung des sozialen Zusammenhalts eine wichtige
Rolle einnehmen.
10Inklusive Bildungs- und Lernprozesse setzen auf Lehrer und Lehrerinnen, die mit den Grundzügen inklusiver
Pädagogik vertraut sind. Hier wird die Verantwortung jener Einrichtungen ersichtlich, die für die Ausbildung von
Lehrpersonal zuständig sind. Die entsprechenden Curricula an Universitäten, Hochschulen und Pädagogischen
Akademien sind auf die Anforderungen eines Unterrichtens in inklusiven Settings dahingehend zu überarbeiten.
Aus ihrem Forschungsauftrag heraus tragen Universitäten zusätzlich eine Verantwortung zur systematischen
Weiterentwicklung didaktischer Methoden und pädagogischer Kompetenzen, die inklusives Lernen bereichern,
speziell jener pädagogischen Kompetenzen, über die Lernprozesse von Menschen mit Lernschwierigkeiten
erfolgreich begleitet werden (Weber, 2012).
Auf dem Hintergrund der Ratifizierung der BRK ergibt sich für aus öffentlichen Mitteln finanzierte Universitäten
und Lehrerausbildungseinrichtungen ein eindeutige Verantwortung in der Umsetzung jener Anforderungen, die in
Zusammenhang mit Artikel 24, und der damit verbundenen Verpflichtung zur inklusiven Schule stehen.
Inklusion und Gesundheit
In vielen Gegenden Europas wurden Menschen mit Behinderungen, oft bereits ab dem frühen Kindesalter, in
Heimen untergebracht. Aus manchen Studien dieser Zeit geht hervor, dass Menschen, die über längere Zeiten in
Institutionen lebten, einen deutlich schlechteren Gesundheitsstatus aufzeigten, als Gleichaltrige, die in typischen,
so genannten „normalen“ Umwelten lebten. Häufig wurde der Zustand der schlechteren Gesundheit mit dem
Faktum der Behinderung dieser Personen in Zusammenhang gedacht. Spätere Studien zeigten aber die negativen
Effekte von institutionellen Rahmenbedingungen wie dem Gruppenleben im Heim, ein Leben exklusiv unter
behinderten Menschen, Faktoren, die gemäß den Studien als Prädiktoren für die Entwicklung eines schlechteren
Gesundheitszustand zu verstehen sind. In diesen Studien wurde Gesundheit nach den Kriterien der Welt-
Gesundheits-Organisation (WHO, 2009) untersucht. Diese definiert die WHO als einen Zustand des vollständigen
körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens. Das Fehlen einer Krankheit oder eines Gebrechens, bedeutet
demnach noch nicht Gesundheit.
Eine rezente kanadische Studie, die sich mit der Wirkung inklusiver Beschulung befasst, berichtet nun neben der
Beziehung zwischen Inklusion und Lernerfolg, auch über die Verbindung zwischen Inklusion und Gesundheit (WHO
Kriterien). Die Beobachtungen bezogen sich auf Kinder und Jugendliche mit Behinderung, die Schulen besuchten,
die entweder als hoch inklusiv oder weniger inklusiv eingestuft wurden (Timmons & Wagner, 2008). Die Daten wurden
in einer über Kanada großangelegten Mikrozensuserhebung erfasst. Bei über 8.000 Kindern und Jugendlichen mit
Behinderung – im Alter zwischen 5 und 14 Jahren - wurden der schulische Fortschritt und der Gesundheitsstatus,
mit den Kategorien „hohe“, „mittlere“ und „geringe“ Inklusion in Beziehung gesetzt. Dabei wurde ein Schulsetting
in die Kategorie „hohe Inklusion“ aufgenommen, wenn folgende Bedingungen gegeben waren : a) ein Kind mit
Behinderung die Regelschule in seiner direkten Umgebung besuchte, b) dort jene Unterstützung und Hilfsmittel
erhielt, die es wegen seiner Behinderung benötigte, c) mit altersgleichen Kindern ohne Behinderung unterrichtet
wurde, d) nicht aus der Klasse für bestimmte schulische Aktivtäten herausgenommen wurde und e) die Eltern der
Kinder mit Behinderung einen aktiven Status als Kooperationspartner mit der Schule hatten. „Mittlere Inklusion“
kennzeichnet sich durch schulische Aktivitäten in zum Teil getrennten Gruppen – behinderte Kinder unter sich – und
durch keinen Kooperationsstatus der Eltern aus. Die Kategorie „geringe Inklusion“ steht für die Schule bzw. Klassen,
die ausschließlich von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung besucht werden und sehr wenig Kontakt zu nicht
behinderten Gleichaltrigen haben.
Die Ergebnisse der Studie sind eindeutig und durch hohe statistische Signifikanz gekennzeichnet : Unter hohen
inklusiven Bedingungen erzielen Kinder und Jugendliche mit Behinderung deutlich bessere Lernergebnisse
und Lernfortschritte. Geringe schulische Inklusion geht mit geringem schulischem Lernfortschritt einher. Für den
Gesundheitsstatus wird ein gleiches Ergebnis und Muster berichtet : Die Wahrscheinlichkeit über einen sehr guten
Gesundheitsstatus zu verfügen, steigt proportional mit der Höhe des Inklusionsgrades der Beschulung von Kindern
und Jugendlichen mit Behinderungen. Im Schulsetting mit geringer Inklusion finden sich deutlich mehr Kinder mit
einem schlechten Gesundheitszustand. Beim Gesundheitsbefund zeigte sich darüber hinaus, dass die Beziehung
„Gesundheit und Inklusion“ unabhängig vom Stärkegrad der Beeinträchtigung war. Demnach sind Kinder und
Jugendliche mit stärkeren Beeinträchtigungen in Schulen mit hohem inklusiven Setting, signifikant gesünder, als
Kinder und Jugendliche mit vergleichbar schweren Beeinträchtigungen in „gering inklusiven“ Schulen.
11Diese methodisch bestens durchgeführte Studie besticht mit ihren Ergebnissen und liefert nicht nur Anlass zur
Replikation und zu vertiefenden Folgeuntersuchungen. Der Befund sollte uns darüber hinaus ermutigen, verstärkt
auf eine inklusive Denk- und Handlungsausrichtung in unserer Gesellschaft zu setzen, ist doch eine gute Gesundheit
eine zentrale Determinante für die Teilnahme in der Gesellschaft.
Inklusionswege zu einer unabhängigen Lebensführung
Ein Leben in der Gemeinschaft, gekennzeichnet durch eine unabhängige Lebensführung, die gegebenenfalls mit
einer entsprechenden Unterstützung gesichert wird, ist ein zentrales Merkmal der Inklusionsperspektive. In Artikel 19
der BRK wird diese Position unmissverständlich für Menschen mit Behinderungen festgehalten. Demnach wohnen
Menschen mit Behinderungen und Menschen mit Lernschwierigkeiten in der lokalen Gemeinschaft, wo ihnen
wohnortnah jene Unterstützungsdienste angeboten werden, die sie benötigen. Der Anspruch auf eine unabhängige
Lebensführung ist eng mit Selbstbestimmung verbunden, und für diese wiederum nimmt persönliche Assistenz eine
besondere Bedeutung an. Mit der Selbstbestimmung geht die Selbstverantwortung gegenüber dem eigenen Leben
und der Mitverantwortung am Leben von nahestehenden Personen einher, dies im Sinne einer auf Gegenseitigkeit
beruhenden Ethik anerkannter Abhängigkeit. Geht es um die Suche eines geeigneten Wohnortes und eines
passenden Wohnumfeldes für einen Menschen mit Lernschwierigkeiten, wird der Grad an Inklusion in diesem
Prozess daran ersichtlich, wie diese Person in die Entscheidungsfindung einbezogen wird und welchen Stellenwert
ihr dabei gegeben wird. Typischerweise wird diese Person von Anfang bis zum Ende ihres Wohnprojektes und bei
allen dabei zu beantwortenden Fragen gleichberechtig mit allen anderen daran Beteiligten einbezogen sein, dies bis
hin zur gemeinsamen Erbringung von Unterstützungsleistungen.
Co-Produktion als Inklusionsmethode
Ein gleichberechtigter Beteiligungsprozess bedarf einer offenen, dialogischen und achtsamen Begleitung, in welcher
Selbstbestimmung sowie Mitverantwortung ausgewogen berücksichtigt wird und wo Antworten und Lösungen
von allen getragen werden. In einer auf dieser Weise erarbeiteten Entscheidungsfindung wird die Person, um die
es hier geht, zum Co-Produzenten des Ergebnisses. Und dieses Ergebnis, stellt dann die gemeinsame Wurzel für
eine in der Praxis umgesetzte und gemeinsam gelebte Inklusion dar. Alle in diesem Prozess involvierten Personen
tragen Mitverantwortung an dem Praxisprojekt. Die Partnerschaft eines Co-Produktionsprozesses umfasst neben
Verantwortlichen aus öffentlich- bzw. privatrechtlichen Finanzierungsträgern bzw. Vertretern des Non-Profit Bereichs,
die eine Finanzierungsgrundlage und fachliche Kompetenzen einbringen, die sozialen Kernpartner. Letztere kommen
aus dem Gemeinwesen und haben einen Bezug zu jenen Personen, die Unterstützung und soziale Begleitung
benötigen. Diese Partner reichen von jenen Personen, die mit dem betroffenen Menschen leben, der Familie,
Personen aus der Nachbarschaft bzw. der Gemeinde sowie der Zivilgesellschaft. Dabei bringen alle Beteiligten
dieser sozialen Kernpartner einen definierten Teil ihrer Zeit sowie ihre Kompetenzen ein. Die Co-Produktionsmethode
hat als Ziel, ein auf Gegenseitigkeit beruhendes Gewebe im Sozialraum neu zu entwickeln, das respektvolle und
sichere Unterstützung unter einander anbietet. Das Konzept der Co-Produktion ist eng mit dem von Edgar Cahn
entwickelten Konzept der Zeit-Bank verbunden und stellt eine neuartige wirtschaftliche Strategie zur Sicherstellung
von Unterstützungsleistungen bei sozialen Herausforderungen dar (Cahn, 2004 ; Time Banking, 2014). Die über diese
Methodik entwickelte gegenseitige Mitverantwortung kennzeichnet sich durch eine Haltung, die sich recht gut mit
folgendem kurzen Satz beschrieben lässt : „In diesem Projekt geht es um uns alle“. Am Beispiel des unterstützten
Wohnens zeigt uns die Methode der Co-Produktion Wege auf, wie durch Teilhabeprozesse, segregierendes Denken
überwunden werden kann. In einem traditionellen „unterstützten“ Wohnsystem werden wesentliche Entscheidungen
in der Regel ohne gleichberechtigte Einbeziehung des Menschen mit Behinderung und seinen informellen
Unterstützer getroffen, mit dem Ergebnis, dass in Kategorien von „uns“, den „Sozialexperten“ und „ihnen“, den
„Behinderten“, gedacht wird. Der Weg der Co-Produktion, mit seinem inklusiven Denkansatz, fördert eindeutig die
Kategorie „uns“, und damit die Haltung, dass es alle betrifft, die hier involviert sind.
Eine EU Strategie zu Wegen aus dem Heim
In den Epochen, in denen wir gemäß einem Segregations- und Exklusionsmodell für Menschen mit Behinderung
gedacht haben, sind als entsprechende Wohnorte vor allem Heime, typischerweise in Form von großen
Heimstrukturen, häufig an entlegenen Orten für Menschen mit Behinderungen errichtet worden. Entsprechende
Unterbringungsorte waren vor allem Versorgungsorte, wo die Bewohner kaum Möglichkeiten zur persönlichen
Gestaltung ihres Lebens außerhalb dieser Einrichtung angeboten wurden. Die Tages- und Jahresabläufe an solchen
12Orten waren in der Regel einer strengen Ordnung patriarchalen Charakters unterworfen. Das ethische Prinzip
des Handelns von Verantwortlichen und Personal folgte dem Motto „zum Wohle des behinderten Menschen“ zu
entscheiden. Demnach war der Wille des behinderten Menschen von geringer Bedeutung und somit blieb die
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung an solchen Wohnorten weitestgehend eingeschränkt bzw. sie
war schlicht nicht vorhanden. Allein aus einer Menschenrechtsperspektive sind entsprechende fremdbestimmte
Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderung unhaltbar. Auch die Sichtweise, bürgerliche Rechte allein auf der
Grundlage von Behinderung abzusprechen, ist ordnungs- und menschenrechtlich in Frage zu stellen. Entsprechende
Praktiken sind schlicht verfassungswidrig !
In Zusammenhang mit der Entwicklung der Europäischen Behindertenstrategie 2010-2020 (EU-KOM, 2010) stellte
sich das Thema „selbstbestimmt leben“, als eines jener Top Themen, die von Menschen mit Behinderungen genannt
wurden. In diesem Kontext verfasst die EU-Kommission bereits 2009 den Bericht zum Thema „Übergang von der
Heimpflege zur gemeindenahen Pflege“ (EU-KOM, 2009). Und mit der Ratifizierung der BRK durch das EU Parlament
im Jahr 2010 gewinnt die Menschenrechtsposition zu Gunsten von Menschen mit Behinderungen innerhalb der EU
an Stärke. In Zusammenhang mit den menschenrechtswidrigen Unterbringungen von Menschen mit Behinderungen
in Heimen, von Kleinkindern bis zu alten Menschen, wird ein Leitfaden zum Übergang von institutioneller Betreuung
zur Betreuung in der Gemeinschaft für diese Personengruppe formuliert (EEG, 2012).
Kennzeichen und Merkmale für Behinderteninstitutionen sind unter anderem, dass dort nur Menschen mit
Behinderung leben, diese Personen über ihren Unterbringungsort nicht selbst entscheiden können, auch nicht
mitreden können mit wem sie zusammen leben wollen und oft ihr Zimmer und ihr Bad nicht abschließen können.
Darüber hinaus existieren in solchen Settings fixe Hausregeln für Essen und Schlafen, Besuchsregelungen erfolgen
nicht nach Entscheidungen des Bewohners, Menschen mit Behinderungen haben keinen Einfluss auf die Anstellung
des Betreuungspersonals, und wenn Menschen mit Behinderung mit Betreuern unzufrieden sind, wird oftmals
der behinderte Mensch zum Ausziehen gedrängt. Aber auch religiöse, kulturelle und sexuelle Präferenzen werden
in Heimen häufig nicht respektiert. Es stellt sich die Frage, mit welchen Argumenten und mit welchem Recht wir
Menschen mit Behinderung in solch unwürdigen Bedingungen leben lassen ?
Die Lebensqualität in Einrichtungen, die durch Merkmale dieser Art gekennzeichnet sind, wird übereinstimmend, in
vielen Forschungsarbeiten mit sehr niedrig berichtet. Auch der Gesundheitsstatus von Heimbewohnern ist niedriger,
als jener von Personen, die in der lokalen Gemeinschaft, personenzentriert begleitet und unterstützt werden. Zudem
ist wissenschaftlich belegt, dass bereits kürzere Aufenthalte in Heimsettings mit ungünstigen Auswirkungen auf die
Hirnreifeentwicklung bei Kindern einhergehen.
Unterschiedliche Realisierungen von Transformationsprozessen
Die Transformation vom Wohnen in segregierten Settings institutionellen Charakters, zu kleinen Betreuungs- und
Wohneinrichtungen im Sozialraum, ist nicht nur eine besondere Herausforderung in einigen jener Ländern,
die in rezenteren Jahren als Mitglieder der Europäischen Union aufgenommen wurden. Entsprechende
Transformationsleistungen, hin zu inklusivem Wohnen, mit Unterstützung zu einer selbstbestimmten Lebensführung,
sind in vielen EU Ländern an vielen Orten erforderlich. In skandinavischen Ländern lassen sich konsequente und
mit den Ideen von Inklusion und Selbstbestimmung kongruent verpflichtete Umstellungen landesweit beobachten.
Erfolgreiche Transformationsprozesse zeichnen sich durch eine klare Planung, versehen mit Vorbereitungen auf
verschiedenen Ebenen aus. Dabei geht es um vor allem die verflechtende Weiterentwicklung und Mitnutzung
von bestehenden Diensten, Vereinsaktivitäten und Programmen, die bereits in der Gemeinde, dem Sozialraum,
existieren und wo Menschen mit Behinderungen nun gleichberechtigt teilnehmen können. Für eine erfolgreiche
Umsetzung dieses Weges sind die Lebenswegbegleiter von Menschen mit Behinderung, also ihre „Betreuer“ bzw.
„Erzieher“, oder wie auch immer heute noch genannt, auf inklusive Aufgabenstellungen und den damit verbundenen
Anforderungen entsprechend vorzubereiten und einzuschulen.
Von Land zu Land haben Entscheidungsnehmer einerseits unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich des Zeitplans
von institutionellen Transformationsprozessen. Andererseits zeichnen sich deutliche Differenzen in den Vorstellungen
einzelner Länder ab, was die Anzahl der jener Personen anlangt, die als Gruppe, familienähnlich oder ähnlich einer
Wohngemeinschaft, in einem Haus oder einer Wohnung begleitet werden sollen. Diese Entscheidungen werden
in der Regel einseitig, also „traditionell“, meistens von jenen Stellen, die für die Finanzierung verantwortlich sind,
genommen. Das ergibt, dass die Nutzer in diese Entscheidungen oft nicht einbezogen sind, obwohl Wohnen für die
Identität und die Selbstbestimmung des Menschen von hoher Relevanz ist.
13So hat Irland diese Wohngruppengröße mit maximal 4 Personen, Ungarn dagegen mit 30 Personen definiert. Mögen
diese Unterschiede durch die Ausgangslage und die existierende langjährige „Kultur“ in der Heimunterbringung der
jeweiligen Länder gesehen werden so wird eine Unterbringung und Betreuung von 30 Personen mit Behinderungen
in einem Haus in der Regel sich eher mit den weiter oben beschriebenen Institutionsmerkmalen überschneiden
werden. Unterstützung in der lokalen Gemeinde im Sinne der Achtung des Rechts auf Selbstbestimmung benötigt
eine Lebenswegbegleitung, die mit der einzelnen Person abgesprochen ist – im Sinne einer personenzentrierten
Planung, und welche die Vorstellungen, die dieser Mensch gegenüber seinem Leben hat, respektiert, unterstützt und
mit Achtsamkeit begleitet.
Ein Mensch mit Behinderung, wie jeder andere Mensch auch, wird je nach Lebensphase unterschiedliche
Bedürfnisse und Vorstellungen zu seiner Wohnsituation haben. So kann es sein, dass ein junger erwachsener
Mensch mit Behinderung einige Jahre in einer Wohngemeinschaft leben möchte, dann für eine gewisse Zeit die
Erfahrung des Alleinwohnens sucht, anschließend möglicherweise in einer Partnerschaft lebt und später im Leben
als älterer Bürger mit Behinderung in einem anderen Rahmen wohnen und unterstützt werden möchte. Was hiermit
zum Ausdruck gebracht werden soll, ist, dass Leben in der Gemeinschaft in den unterschiedlichen Lebensphasen,
in unterschiedlichen Wohnformen, auch mit unterschiedlichen Personenkonstellationen gekennzeichnet ist,
also einen dynamischen Charakter aufweist. Dieser Aspekt wird in der Umsetzung von einer Betreuung in
„kleinen Wohngruppen“ in der lokalen Gemeinschaft, durch normativ rigide Vorgaben nicht beachtet. Ein Leben
in der Gemeinschaft, das ein gesundes sein will, dies im Sinne subjektiver Lebensqualität, bietet Optionen für
Selbstverwirklichung und Selbstwirksamkeit, und betrifft vor allem das „Wohnen“. Die bereits weiter oben erwähnte
Methode der Co-Produktion bzw. vergleichbare personenzentrierte Methoden stellen für eine stringente Umsetzung
des Inklusionsgedanken nützliche und empfehlenswerte Ansätze dar (Sanderson, 2000).
Eine inklusive Wohn-Landkarte für Europa
Würden wir heute eine europäische „Wohn-Landkarte“ bezüglich des Grades einer unabhängigen, selbstbestimmten
Lebensführung zeichnen, würden wir eine sehr bunte Gesamtkarte vorfinden. Als Wohnformen würden
wir neben Institutionen, die dem Exklusions- und Segregationsmodell folgen, über sogenannte integrative
Wohnhäuser und Wohngemeinschaften mit unterschiedlich ausgeprägtem institutionellem Charakter, auch
Wohnformen mit weitgehend selbstbestimmtem Leben in der Gemeinschaft finden können. Allerdings würde die
Farbzusammensetzung von Land zu Land sehr variieren und insgesamt würde die Farbe, die eine gute unabhängige
und selbstbestimmte Lebensführung abbilden würde, noch in vielen Gegenden fehlen. Eine solche Karte sollte dann,
in 10 Jahren von heute gesehen, bereits farblich ganz anders ausschauen, mit einer Dominanz jener Farbe, die für
die Kategorie „in der Gemeinschaft lebend, dies weitgehend unabhängig und selbstbestimmt“ steht. Auf diese Weise
ließe sich der Erfolg des angestrebten Transformationsprozess bestens zum Ausdruck bringen.
Dieser Zielrichtung diametral gegenüber stehen laufende öffentliche Investitionen in Heimen und Großeinrichtungen,
sei es zu Zwecken der Renovierung bzw. der Erweiterung bestehender Strukturen oder aber in die Investition
Neubauten, also nach traditionellen Gesichtspunkten organisierten und strukturierten Heimen. Diese Feststellung
bezieht sich sowohl auf entsprechende Strukturen die für Kinder, erwachsene Menschen mit Behinderungen sowie
alte Menschen an vielen Stellen gebaut werden.
In einigen Gegenden Europas erkennen die in diesem Bereich politisch Handelnden ihre entsprechende
Verantwortung und stellen sich der Frage : „Was muss das Land ändern, damit die Wohnangebote für Menschen
mit Behinderungen der BRK entsprechen ?“ Im Land Salzburg wurde kürzlich die geplante Großinvestition zwecks
Renovierung eines abgelegenen Heims mit 120 Betten, eine Schlossanlage, politisch gestoppt. Mit einem Teil des
Geldes sollen nun Investitionen für unterstützte, sozialraumorientierte Wohnansätze getätigt werden. Der andere
Teil soll in das Heim investiert werden, für die Bewohner, die dort weiter leben möchten. Sicherlich eine mehr als
pragmatische Zwischenlösung. Allerdings geht es bei Inklusion immer auch um die soziale Einbindung in den
Stadtteil, das Dorf, die Gemeinde, mit dem Ziel eine neue Kultur des Zusammenlebens aufzubauen, die niemanden
ausschließt. Hier werden sozialraumorientierte Ansätze als gut geeignete Formen zur Annäherung an dieses Ziel
gesehen, da Teilhabechancen durch örtliche Teilhabeplanungen in kommunaler Verantwortung gestützt werden. Dies
bedeutet letztlich, dass auch Menschen mit schweren Beeinträchtigungen, eine Personengruppe, die bisher nicht
speziell hervorgehoben wurde, selbst entscheiden können, wo, wie und vor allem auch mit wem sie zusammenleben.
Sicher ein ernst zu nehmendes Ziel, mit großen Herausforderungen, die sich überwinden lassen !
14Kosteneffektivität und Wohnen im Sozialraum
Häufig wird aus einer ökonomisch-sozialpolitischen Perspektive argumentiert, dass Wohnen in der Gemeinschaft,
im Sozialraum und die Unterstützung in solchen kleinen Gruppen, sich mit den vorhandenen Finanzmitteln nicht
realisieren lässt und begründet hiermit Investitionen in traditionelle Heimkonzepte auf eine rein ökonomische Weise.
Die Frage der Kosteneffektivität wurde und wird durchaus kontrovers diskutiert und zwecks Klärung beauftragte
die Europäische Kommission die „London School of Economics“ mit einer entsprechenden Studie. In dieser
Untersuchung, die Daten aus 28 europäischen Ländern berücksichtigte, wird die Betreuungsqualität mit den Kosten
aus a) teuren und b) günstigeren Großinstitutionen sowie c) gemeindenahen kleinen Wohneinrichtungen, dies im
Sinne einer Kosteneffektivität, verglichen (Mansell et al., 2007). Generell zeigte sich, dass die Kosteneffektivität
zu Gunsten einer Betreuung in kleinen gemeindenahen Einrichtungen steigt. Obwohl der Kostensatz in kleinen
gemeindenahen Wohneinrichtungen sowohl für Menschen mit leichteren als auch mit schweren Behinderungen
günstiger ist, findet dort eine bessere Betreuungsqualität statt. Lediglich für Menschen mit schwereren
Behinderungen, die in günstigen Großeinrichtungen betreut wurden, sind die Kosten in gemeindenahen
Wohngruppen höher, dies bei deutlich höherer Betreuungsqualität und insgesamt besserer Kosteneffektivität. Mit
diesem Befund wird Entscheidungsträgern eine überzeugende Grundlage zu Gunsten des Wandels angeboten, mit
der Voraussetzung, dass eine genügend langfristige Sicht hinsichtlich Kosten- und Ergebniswandel genommen wird.
Was benötigt wird
Die Erfahrungen, die Menschen mit intellektuellen Behinderungen und Menschen mit psychischen Störungen
aus neun verschiedenen EU Ländern, in Zusammenhang mit einer unabhängigen Lebensführung gemacht
haben, unter Berücksichtigung von ihren Wahl- und Kontrollmöglichkeiten, wurden in einem rezenten Bericht
der Agentur für Grundlegende Rechte der Europäischen Union präsentiert (FRA, 2012). Das Fazit dieses
Berichtes lautet, dass in vielen der untersuchten Ländern Anstrengungen zur Reduzierung eines Lebens in
Institutionen unternommen worden sind bzw. Institutionen geschlossen werden konnten. Damit allerdings eine
unabhängige Lebensführung in der Gemeinschaft verstärkt Wirklichkeit werden kann, sind gemäß den Autoren
eine Reihe von begleitenden sozialpolitischen Reformen, insbesondere in den Bereichen Bildung, Gesundheit,
Arbeit und Kultur sowie unterstützende Dienste notwendig. In vielen Ländern sind zusätzlich Änderungen in der
Rechtslage der Handlungsfähigkeit für Menschen mit Behinderung erforderlich, dies im Sinne einer unterstützten
Entscheidungsfindung, als Alternative zur Vormundschaft.
Über eine konsequente, schrittweise Entwicklung inklusiver sozialer Räume sind die angesprochenen
Transformationsprozesse umsetzbar und die damit verbundenen Ziele auch erreichbar. Hierzu liegen einige nützliche
Instrumente vor, die sich Gemeinden, Städte und Regionen auf diesem Weg nutzbar machen können. Für die
Umsetzung der BRK gibt es beispielsweise den Leitfaden „Unsere Gemeinde wird inklusiv !“ des Bundesministeriums
für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie aus Rheinland-Pfalz (Heiden, 2013). Bezogen auf Menschen mit
Lernschwierigkeiten liegt das Brückenbauprojekt der Lebenshilfe Baden-Württemberg (2010) vor. Für einen globaleren
Inklusionsansatz, der sich auf alle Personengruppen einer Gemeinde bezieht, steht der Inklusionsindex zur Verfügung
(Montag Stiftung, 2011). Mit diesen Instrumenten konnten an verschiedenen Orten bereits bemerkenswerte Beiträge
für eine inklusivere Gesellschaft erzielt werden.
Inklusion und sprachliche Barrierefreiheit
Behinderung und Barrierefreiheit wird traditionell in Zusammenhang mit architektonischer Zugänglichkeit
besprochen, also der systematischen Entwicklung von gebauten Umwelten, in denen Menschen mit körperlichen
und / oder sensorischen Einschränkungen eine unbehinderte, d.h. selbständige Mitbenutzung in diesen gebauten
Umwelten vorfinden.
Erst in jüngerer Zeit wird nachdrücklich auf die diskriminierende Eigenschaft von Sprache gegenüber verschiedenen
Personengruppen verwiesen. Dies im Sinne, dass mit gängiger Sprache und ihrer Komplexität, die vermittelten
Inhalte von verschiedenen Personengruppen nicht wirklich verstanden werden und diese somit von den Botschaften
exkludiert bleiben. Tatsächlich sind viele Menschen auf leichte Sprache angewiesen, um Themen, die für sie wichtig
sind oder die sie interessieren, lesen und verstehen zu können. Ohne leichte Sprache, ob in schriftlicher oder
15Sie können auch lesen