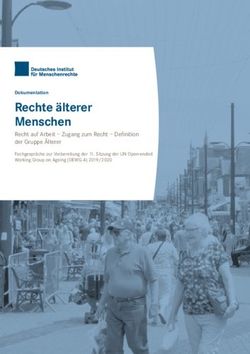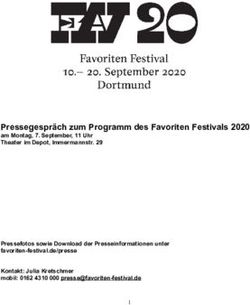Landesgesundheitskonferenz Berlin - Gesundheitsförderung ja! Aber wie? Was wir gemeinsam für mehr Qualität, Nachhaltigkeit und ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
13. Landesgesundheitskonferenz Berlin
Gesundheitsförderung ja! Aber wie?
Was wir gemeinsam für mehr Qualität,
Nachhaltigkeit und Angebotsvielfalt tun wollen.
12. Oktober 2016, Tagungswerk JerusalemkircheImpressum
Herausgeber Fachliche Auskunft
Fachstelle für Prävention und Gesundheits- Marisa Elle
förderung im Land Berlin
Satz und Layout
c/o Gesundheit Berlin-Brandenburg e. V.
Connye Wolf, www.connye.com
Friedrichstraße 231, 10969 Berlin
Tel.: (030) 44 31 90 60 Druck
E-Mail: fachstelle@gesundheitbb.de Laserline, Berlin
Redaktion Bildnachweise
Stefan Pospiech (V.i.S.d.P.) S. 2: Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
Jennifer Dirks, Nancy Ehlert, Marisa Elle, Alle weiteren Bilder von Ernst Fesseler, www.ernstfesseler.de
Katharina Lietz, Stefan Weigand
Stand: Dezember 2016
Die Fachstelle für Prävention und Gesundheitsförderung hat seit 2008 die Geschäftsstelle der Landesgesundheitskonferenz
Berlin und wird von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung finanziert. Träger ist Gesundheit Berlin-
Brandenburg e. V.
Gemeinsam für ein gesundes Berlin“ ist seit 2014 das gemeinsame Motto der Mitglieder der Landesgesundheitskonferenz für
Aktivitäten, Angebote und Projekte im Rahmen der Gesundheitsziele.
Die Inhalte der vorliegenden Dokumentation spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung der Redaktion wider.Inhalt
Inhaltsverzeichnis
Begrüßung durch Staatssekretärin Emine Demirbüken-Wegner . . . . . . . . 2
Fachvorträge
Qualität in der Gesundheitsförderung. Das Ziel ist klar, aber wer ist auf
welchem Weg?
Prof. Dr. Gesine Bär, Alice Salomon Hochschule Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Wo stehen wir in Berlin?
Stefan Pospiech,
Geschäftsführer Gesundheit Berlin-Brandenburg e. V. . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Fachforen
Lernwerkstatt Good Practice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Gesundheit wirkungsorientierter fördern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Möglichkeiten und Anforderungen des GKV-Leitfadens . . . . . . . . . . . . . . 17
Qualitätsentwicklungsprozesse am
Beispiel des Systems Frühe Hilfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Kooperation und Partizipation in der Gesundheitsförderung bei
älteren Menschen am Beispiel der Stadtteilzentren . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Abschluss
Podiumsdiskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Projektmesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Glossar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Mitglieder der LGK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Über die Fachstelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1Begrüßung
Staatssekretärin Emine Demirbüken-Wegner
Der Titel „Gesundheitsför- Arbeitsalltag, wenn es z. B. darum geht, neue
derung ja! Aber wie? Was Angebote zu entwickeln und durchzuführen,
wir gemeinsam für mehr kann dies als zusätzliche Belastung empfun-
Qualität, Nachhaltigkeit den werden, denn Qualität stellt unterschied-
und Angebotsvielfalt tun liche Anforderungen an finanzielle, personelle
wollen“ fragt danach, wie und organisatorische Ressourcen.
wir Gesundheitsförderung
Der Einsatz von Verfahren zur Qualitätsent-
und Prävention in Berlin
wicklung und -sicherung kann jedoch bedeut-
wirksam gestalten können.
same Vorteile für Projekte und Maßnahmen
Wenn wir langfristig gute
bringen: Zunächst sind sie ein hilfreiches
und wirksame gesundheitliche Angebote in
Instrument, um sich mit der Qualität der ei-
Berlin entwickeln wollen, müssen wir uns
genen Arbeit auseinanderzusetzen. Durch die
noch stärker mit den Themen Qualitätsent-
Umsetzung von qualitätssichernden Maßnah-
wicklung und -sicherung auseinandersetzen.
men und Prozessen lässt sich die Wirksamkeit
Erfreulicherweise messen bereits viele Institu-
einer Maßnahme überprüfen und verbessern
tionen diesem Thema eine große Bedeutung
und ihre Legitimation erhöhen. Darüber hin-
bei. Inzwischen wurden verschiedene Instru-
aus unterstützen sie dabei, ein gemeinsames
mente und Verfahren entwickelt, mit deren
Verständnis für Qualität und gute Praxis in
Hilfe die Bedingungen für Wirksamkeit und
der Gesundheitsförderung und Prävention zu
Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen der Ge-
entwickeln. Ein wesentliches Ziel ist es, Ange-
sundheitsförderung und Prävention geschaf-
bote so zu gestalten, dass besonders Bevöl-
fen und verbessert werden sollen. Das Thema
kerungsgruppen in schwieriger sozialer Lage
Qualität ist Bestandteil rechtlicher Regelun-
erreicht werden. Damit kann wiederum wirk-
gen, einschlägiger Empfehlungen und Leitli-
sam zum Abbau gesundheitlicher Ungleich-
nien/Leitfäden wie z. B. dem GKV-Leitfaden
heit beigetragen werden.
Prävention oder den Good Practice-Kriterien
des Kooperationsverbunds Gesundheitliche Die neuen gesetzlichen Regelungen zur Stär-
Chancengleichheit. kung der Prävention und Gesundheitsförde-
rung unterstützen diesen Prozess und nennen
Anbieterinnen und Anbieter sowie Akteu-
als ein zentrales Ziel, die Qualität von Angebo-
rinnen und Akteure stehen häufig vor der
ten sicherzustellen und die Wirksamkeit von
Herausforderung, ein für ihre Maßnahme
Leistungen zu fördern. Bei der heutigen Ver-
sinnvolles und hilfreiches Verfahren oder
anstaltung soll es vor allem darum gehen, zu
Instrument der Qualitätsentwicklung und
erörtern, was wir von dem Thema Qualitäts-
-sicherung aus dem zum Teil unübersicht-
sicherung in Berlin erwarten, wie wir Maßnah-
lichen Angebot auszuwählen, in der Praxis
men in guter Qualität in der Gesundheitsför-
anzuwenden und dabei die bestehenden Rah-
derung und Prävention umsetzen und wie wir
menbedingungen und Strukturen vor Ort zu
erfolgversprechende Ansätze und Strategien
beachten. In der praktischen Arbeit und im
weiter in die Praxis verbreiten können.
2Begrüßung
Zum Programm der heutigen Fachforum 5 schaut auf die Zielgruppe der
Landesgesundheitskonferenz älteren Menschen und fragt, wie Angebote
der Gesundheitsförderung partizipativ und
Die fünf Fachforen und Werkstätten greifen
in Form von Kooperationen gestaltet werden
die benannten Aspekte auf und laden Sie dazu
können. Anhand der Stadtteilzentren wird
ein, ausgewählte Instrumente und Verfahren
diskutiert, wie vorhandene Qualitätsmerk-
der Qualitätsentwicklung und -sicherung ken-
male in die Praxis umgesetzt werden. Wie
nenzulernen, eigene Erfahrungen einzubrin-
können Kooperationen z. B. mit Nachbar-
gen und gute Praxisbeispiele bekanntzuma-
schaftsinitiativen, Pflegeeinrichtungen oder
chen.
Sportvereinen zur Weiterentwicklung von
Fachforum 1 beschäftigt sich mit den Good gesundheitsfördernden Angeboten für ältere
Practice-Kriterien des Kooperationsverbunds Menschen beitragen, um so neue Zielgruppen
Gesundheitliche Chancengleichheit. Diese zu erreichen?
stellen Akteurinnen und Akteuren einen Rah-
Die heutige Veranstaltung soll auch dazu
men zur Verfügung für die Ausgestaltung ge-
beitragen, ein gemeinsames Verständnis für
sundheitsfördernder Angebote. In der Good
Qualität in der Gesundheitsförderung und
Practice-Lernwerkstatt arbeiten die Teilneh-
Prävention in Berlin zu entwickeln. Ein wei-
menden gemeinsam daran, wie sie die Krite-
terer Schritt wird dabei sein, sich über ge-
rien für die Qualitätsentwicklung der eigenen
meinsame Empfehlungen zu verständigen,
Arbeit nutzen können.
wie sich der Transfer von Ansätzen der Quali-
Die Bedeutung von Wirkungsorientierung in tätsentwicklung und -sicherung in die Praxis
der Gesundheitsförderung wird im Fachfo- der Gesundheitsförderung und Prävention
rum 2 behandelt. Der Begriff der Wirkungs- unter der Nutzung bestehender Strukturen in
orientierung wird hier genauer beleuchtet. In Berlin verbessern lässt und was diesbezüglich
einer Werkstatt kann alltagsnah erprobt wer- für die Arbeit der Landesgesundheitskonfe-
den, wie dies in der Praxis umgesetzt werden renz abgeleitet werden kann. Diese Empfeh-
kann. lungen für die künftige Arbeit der Landesge-
sundheitskonferenz und ihre Mitglieder sind
Im Fachforum 3 geht es um die Möglichkei-
Gegenstand der abschließenden Podiumsdis-
ten und Anforderung an den GKV-Leitfaden
kussion, zu der ich Sie herzlich einlade.
als zentrales Instrument zur Förderung von
Leistungen der Krankenkassen. Hier soll mehr Lassen Sie uns gemeinsam darüber sprechen,
Transparenz geschaffen werden über Verfah- wie wir Gesundheit nachhaltig fördern, Prä-
rensprozesse, Handlungsfelder und Kriterien. vention wirksam ausbauen, Qualität dauer-
haft sichern und Angebote lebensweltorien-
Wie Qualitätssicherung in einem Netzwerk
tiert weiter entwickeln können.
gewährleistet werden kann, wird im Fachfo-
rum 4 am Beispiel der Bundesinitiative Frü- Mein Dank gilt allen, die diese Landesge-
he Hilfen diskutiert. Hier stellen sich Fragen sundheitskonferenz organisiert haben. Aus
wie: Was braucht es, um aufeinander ab- unserem Haus, aber natürlich auch von Ge-
gestimmte Leistungen und eine von vielen sundheit Berlin-Brandenburg e. V. Herr Po-
Akteurinnen und Akteuren getragene Unter- spiech, Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und
stützungsstruktur qualitätssichernd weiter- Mitarbeitern im Hintergrund: Herzlichen Dank
zuentwickeln? Welche Instrumente und Vor- für Ihre Arbeit! Ich wünsche Ihnen eine gute
aussetzungen sind nötig, um die Wirksamkeit Landesgesundheitskonferenz und freue mich
sowohl einzelner Angebote als auch der ge- auf die Vorträge und auf die weitere Arbeit.
samten Netzwerkarbeit nachzuweisen? Herzlichen Dank für Ihr Kommen!
3Fachvorträge
Qualität in der Gesundheitsförderung.
Das Ziel ist klar, aber wer ist auf welchem Weg?
Prof. Dr. Gesine Bär, Alice Salomon Hochschule Berlin
Für die Erklärung von Fachbegriffen
aus dem Qualitätsdiskurs nutzen Sie
Ausgehend von der empanzipatorischen Gesundheitsförderung als
bitte unser Glossar ab S. 37. WHO-Definition von Gesundheitsförderung Kompetenzentwicklung plus
und Vorschlägen zur Wirkungsorientierung Strukturveränderung
wird dargestellt, wie breit die Qualitätsvor-
Ziel der Gesundheitsförderung ist es, die De-
stellungen in der Debatte variieren. Hierin
terminanten von Gesundheit zu beeinflussen.
liegen Herausforderungen für Wissenschaft
Dazu werden zwei strategische Ansätze zu-
und Praxis, die ebenfalls benannt werden. Im
sammengeführt:
Fazit wird dafür plädiert, den Austausch über
gute Qualität in der Praxis zu stärken – über n die Stärkung der persönlichen und sozialen
regelmäßige Anlässe für Dokumentation und Gesundheitskompetenzen und die Erweite-
Qualitätsentwicklung sowie über eine Inves- rung von Handlungsspielräumen zur Ge-
tition in qualifizierte Netzwerkerinnen und sunderhaltung einerseits,
Netzwerker.
4Fachvorträge
n die politisch gesteuerte Verbesserung der die Angebotsentwicklung wichtige Wirkungs-
Gesundheitsdeterminanten sowie der Ab- bereiche.
bau bestehender sozial bedingter gesund-
Die Handlungsfelder der Ottawa-Charta sind:
heitlicher Ungleichheiten andererseits.1
n die Entwicklung einer gesundheitsfördern-
Demzufolge muss bei der Frage der Qualitäts-
den Gesamtpolitik,
entwicklung diskutiert werden: Wie werden
diese beiden Komponenten jeweils umge- n die Schaffung gesundheitsförderlicher
setzt? Es geht also um mehr als Verhaltens- Lebenswelten,
prävention oder Health Literacy.
n die Unterstützung gesundheitsbezogener
Gemeinschaftsaktionen,
Wirkungsorientierung als Mehr- n die Entwicklung persönlicher Kompetenzen
komponentenmodell und
Das Stufenleiterkonzept der Wirkungsorien- n die Neuorientierung der Gesundheits-
tierung der PHINEO-Beratung (siehe S. 15) dienste.
benennt wichtige orientierende Dimensionen:
Output, Outcome, Impact. Output bedeutet: Die Breite der
Was macht eine Interaktion ganz konkret? Qualitätskriterienkataloge
Wie kommen die Zielgruppen da hin? Out-
come meint: Erst da, wo Wirkung entsteht, Zum Thema „Primärprävention von Über-
verändert eine Intervention auch tatsächlich gewicht bei Kindern“ haben wir uns auf die
etwas. Die letzte Stufe ist dann Impact: Die Suche nach Qualitätskatalogen gemacht. Wir
Gesellschaft verändert sich. In dieser Umset- haben 62 verschiedene Dokumente gefun-
zung werden die beiden genannten Aspekte den.2
von Gesundheitsförderung in eine Reihen- Ein Standard setzendes Dokument ist der
folge gebracht. Zunächst gibt es eine starke Leitfaden der Gesetzlichen Krankenversiche-
Orientierung auf die Zielgruppen der Inter- rung (GKV). Der GKV-Leitfaden Prävention
vention und ganz zum Schluss im Bereich des skizziert drei große Förderfelder, wobei die
Impacts weitet sich der Blick auf die gesell- betrieblichen und nicht-betrieblichen Setting-
schaftlichen Veränderungen. Ansätze den oben genannten Kriterien von
Dazu gibt es Alternativen. In der Ottawa- Gesundheitsförderung unmittelbar entspre-
Charta werden fünf Handlungsfelder parallel chen. Die kursbezogene Prävention kommt
geführt, unter denen eines die individuelle hierbei zu kurz. Im Leitfaden werden jeweils
Kompetenzerweiterung ist. Das Wirkungs- die Förderkriterien, Ausschlusskriterien und
modell „quint-essenz“ von Gesundheits- Anforderungen zur Anbieterqualifikation bei
förderung Schweiz versucht ebenfalls, die Maßnahmen definiert und regelmäßig weiter-
Gleichzeitigkeit von Veränderungsprozessen entwickelt.
abzubilden. Zu vielen anderen Qualitätskriterienkatalo-
Hier sind neben der Entwicklung persönlicher gen gibt es große Schnittmengen wie Ziel-
Kompetenzen auch die soziale, gruppenbezo- gruppen- bzw. Sozialraumbezug, Partizipa-
gene Mobilisierung, die Interessenvertretung tion, Multiplikatorenkonzept. Bei genauerer
und die organisierte Zusammenarbeit sowie Betrachtung fallen jedoch Unterschiede zwi-
2 Bär et al. 2016: Übergewichtsprävention bei Kindern. In:
1 Quelle: Pschyrembel Sozialmedizin. Berlin: de Gryter, Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesund-
2007, S. 199. heitsschutz 2016 (59) 11: 1405-1414.
5schen den Dokumenten auf, zum Beispiel in hören, werden im Setting von ihrer Trainerin
der Frage, wer bei der Qualitätsmessung ein- erreicht, aber eher nicht durch eine externe
bezogen werden soll. Es gibt Ansätze, in denen Kursleitung. Über ein „Train the Trainer“-Ver-
steht das Expertinnen- und Expertenwissen fahren konnten die konkurrierenden Kriterien
an erster Stelle mit klaren Qualitätsvorstel- schließlich teilweise in Einklang gebracht wer-
lungen. Andere Ansätze verfolgen wiederum den. Zu anderen Teilen mussten alternative
den Grundgedanken, dass Qualität durch lo- Fördertöpfe gefunden werden. Im Sinne der
kales Wissen entsteht. Die Menschen vor Ort Qualitätsentwicklung sind beide geforderten
– Fachkräfte wie Bewohnerinnen und Bewoh- Komponenten von Gesundheitsförderung
ner – werden als Expertinnen und Experten ih- erkennbar: Zum einen werden die Kompeten-
rer Lebenswelt einbezogen. Es wird dabei mit zen der Trainerin und der Teilnehmerinnen
Lernspiralen argumentiert: Qualität entsteht, des Bewegungsangebots gefördert und zum
wenn wissenschaftlich verallgemeinertes und anderen wird eine Weiterentwicklung der För-
praxisgebundenes Wissen miteinander ver- derformate betrieben, die besser vulnerable
flochten werden. Zielgruppen unterstützt.
Qualitätsentwicklung in der Fazit: Streckennetze,
Komplexitätsbewältigung Wegbereiterinnen und -bereiter
Aus dem umfassenden Veränderungsan- Die Anforderungen an Maßnahmen der Ge-
spruch von Gesundheitsförderung und der sundheitsförderung sind hoch: Wir wollen
Vielstimmigkeit der Qualitätsvorstellungen eine Integration von mehreren Ebenen und
entstehen verschiedene Herausforderungen, wir wollen, dass lokale Bedarfe angemessen
von denen eine im Folgenden genannt wird: berücksichtigt werden. Wir wollen nicht im-
mer eine Schablone von außen anlegen und
Was ist zu tun, wenn sich Kriterien gegenseitig
dennoch Qualitätsstandards, die nicht nur zu
ausschließen oder stören? Was ist, wenn die
Insellösungen führen. Das erfordert ein Mehr
Settinglogik anderen Förderkriterien der
an Kommunikation, im Sinne einer intensiven
Krankenkassen entgegensteht?
Vermittlung von Praxis und Qualitätskriteri-
Praxisbeispiel: Für ein Bewegungsangebot für en zum einen und im Sinne einer Vermittlung
Mädchen in einem Stadtteil in Hamburg wur- zwischen verschiedenen Qualitätsdiskursen
de eine Förderung beantragt, um mehr und zum anderen. Im Bild der Überschrift ge-
bessere Trainingszeiten anbieten zu können. sprochen: Es geht darum, ein Streckennetz
Der angefragte Fonds wurde durch Mittel der zu entwickeln, um Akteurinnen und Akteure
Krankenkassen gespeist. Die Krankenkasse zusammenzubringen, die auf verschiedenen
wendete ein, dass es sich bei der Kursleitung Wegen unterwegs sind.
um eine Stadtteilakteurin ohne eine durch die
Wie können diese genannten Qualitätsdiskur-
GKV anerkannte Ausbildung handelte. Dahin-
se miteinander verbunden werden? Meinen
ter stand die nachvollziehbare Logik: auch in
alle das Gleiche, wenn sie von Qualität spre-
diesem Stadtteil sollte ebenso gute Qualität
chen? Gibt es Vorannahmen, Dissonanzen,
an Gesundheitsangeboten stattfinden wie an-
Schnittmengen? Und wie lässt sich dabei die
derswo. Die Initiierenden fürchteten jedoch,
Autonomie der Träger bewahren?
dass niemand mehr am Angebot teilnehmen
würde, wenn eine externe, geprüfte Kurslei- Es geht weiterhin darum, für die lokale Wei-
tung eingesetzt würde. 20 aktive Mädchen, terentwicklung von Qualität Beraterinnen
die genau zur gewünschten Zielgruppe ge- und Berater wie die Koordinierungsstellen
6Fachvorträge
Gesundheitliche Chancengleichheit als Weg- für die Funktion des Wissenstransfers, um
bereiter und -begleiter zu haben. Allgemeine diese Anpassung zu begleiten,
Qualitätsvorstellungen müssen immer wieder
n regionale Präventionsbeauftragte bei der
lokal rückgekoppelt werden, damit Qualität
GKV, wenn es um GKV-Gelder und deren
vor Ort entstehen kann.
Einsatz geht.
Was kennzeichnet gute Praxis? Und wie kön-
Die Koordinierungsstellen Gesundheitliche
nen wir sie hier erhalten und dort verbreiten?
Chancengleichheit auf Landesebene werden
Deshalb sind Vermittlungsprozesse und ver- jetzt über das Präventionsgesetz ausge-
mittelnde Personen wichtig. Und zwar auf den baut. Das ist eine sehr gute Nachricht für die
verschiedenen Ebenen: aktuellen Fragen der Qualitätsentwicklung.
Denn sie sind zentral für die Koproduktion
n lokale Koordinatorinnen und Koordinatoren
von Qualität in der Gesundheitsförderung und
in den Settings,
zwar in dem doppelten Sinne, als Entwicklung
n Akteurinnen und Akteure in der Fachverwal- von Kompetenzen sowie als Strukturverände-
tung oder bei den Trägern, die Qualitätsvor- rungen zum Beispiel bei der Umsetzung von
stellungen vermitteln, Gesundheitszielen und integrierten kommu-
nalen Strategien.
n überregional vermittelnde Akteurinnen und
Akteure und wissenschaftliche Begleitung
7Wo stehen wir in Berlin?
Stefan Pospiech, Geschäftsführer Gesundheit Berlin-Brandenburg e. V.
Wer sind die Wegbereiter und -begleiter in Ber- der Qualitätsentwicklung schafft und das auch
lin beim Thema Qualität? Welche Akteurinnen im Rahmen der heutigen Konferenz reflektiert
und Akteure geben Impulse für die Qualitäts- und erweitert werden soll.
entwicklung? Der folgende Beitrag beleuchtet
eine nicht vollständige Auswahl von Strukturen
Aktionsprogramm Gesundheit
und Prozessen in diesem Feld.
Im Aktionsprogramm Gesundheit (APG) stellt
das Land Berlin Haushaltsmittel zur Stärkung
Die Landesgesundheitskonferenz
der Prävention und Gesundheitsförderung zur
Auftrag der LGK ist es, gemeinsam über Fragen Verfügung. Ein Ziel ist es, bestehende Struktu-
der gesundheitlichen Versorgung und der ge- ren und Angebote in ihrer Qualität weiterzuent-
sundheitlichen Lage der Berliner Bevölkerung wickeln und zudem dort, wo Bedarfe bestehen,
zu beraten. Dazu koordinieren die Mitglieder über Förderungen auch Impulse zu setzen. Das
ihre Aktivitäten und geben bei Bedarf Empfeh- APG bildet so einen wichtigen Baustein in einer
lungen, die im Rahmen der Selbstverpflichtung gesamtstädtischen Strategie für ein gesundes
umgesetzt werden. Berlin.
Ein gemeinsames Qualitätsverständnis ist eine Hervorzuheben ist, dass das APG nicht allein
wichtige Grundlage, um konsentierte Ziele zu von der für Gesundheit zuständigen Senatsver-
erreichen. Vor dem Hintergrund des Präven- waltung gesteuert und koordiniert wird, wel-
tionsgesetzes und den daraus entstehenden che die finanziellen Mittel zur Verfügung stellt.
Strukturen, Prozessen und Maßnahmen wur- Es hat sich eine ressortübergreifende Arbeits-
de das Thema in diesem Jahr als Schwerpunkt gruppe aus Bildung, Sport, Stadtentwicklung
für die Arbeit der LGK gewählt. Gemeinsame und Gesundheit sowie Bezirken herausgebil-
Gesundheitsziele bilden einen wichtigen Ori- det, die zum Ziel hat, Qualitätsverständnis und
entierungspunkt für die in der Formulierung Förderprogramme aufeinander abzustimmen
begriffenen Landesrahmenvereinbarungen und stärker zu verzahnen.
in den Bundesländern. Berlin hat mit der LGK
eine etablierte und anerkannte Struktur, die
Koordinierungsstelle
Gesundheitsziele verabredet hat. Daher ist
Gesundheitliche Chancengleichheit
eine Frage, die auf der 13. öffentlichen LGK
gestellt wird: Was wollen wir mit den Aktivitä- Länder, Krankenkassen und auch die Bundes-
ten erreichen, die wir unter dem Dach der LGK zentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
verabreden? Das ist sowohl eine politische als fördern seit einigen Jahren gemeinsam die Ko-
auch eine fachliche Frage, die ein gemeinsames ordinierungsstellen Gesundheitliche Chancen-
Verständnis von Qualität voraussetzt. gleichheit. Im Rahmen der BZgA-Beauftragung
durch den GKV-Spitzenverband wurde diese
Zwei Bausteine in diesem Prozess gehören eng
Struktur in ihrem Aufgabenprofil erweitert
zusammen: Um Transparenz über gesund-
und mit besseren Ressourcen ausgestattet. Ihr
heitsbezogene Aktivitäten zu schaffen, wirkt
zentraler Auftrag ist die Netzwerk-Bildung, der
die LGK an der Gesundheitsberichterstattung
Aufbau von Kooperationen und die Qualitäts-
mit. Dadurch kann die LGK auf einen großen
entwicklung der Prävention und Gesundheits-
Fundus an Sozial- und Gesundheitsdaten zu-
förderung im übergeordneten Setting Kommu-
rückgreifen. Hinzu kommt ein Berichtswesen,
ne zu unterstützen. Der Auf- und Ausbau von
welches Transparenz über die konkreten Inter-
Präventionsketten in Berlin kann so – auch über
ventionen in den Lebenswelten und Prozesse
das APG – noch deutlicher befördert werden.
8Fachvorträge
Bezirkliche Strukturen welten – Entwicklung und Sicherung von Qua-
lität“ wurde der Frage nachgegangen, wie über
Zentral in der lebensweltbezogenen Gesund-
bestehende Qualitätsmanagementsysteme der
heitsförderung ist die kommunale Ebene. Ber-
Trägerorganisationen gesundheitsförderliche
lin hat mit der Organisationseinheit Qualitäts-
Aspekte verstärkt werden können.
entwicklung, Planung und Koordination des
Öffentlichen Gesundheitsdienstes (OE QPK) Positiv hervorzuheben ist: Die Implementierung
eine wichtige Struktur, um Koordination und von Prävention und Gesundheitsförderung in
Kooperation zu befördern. Neben diesen Aufga- die vorhandenen Qualitätsmanagementsyste-
ben gehört es auch zum Profil der QPKs, fachli- me stößt auf großes Interesse. Wichtige Vor-
che Standards zur Sicherung von Qualität und aussetzungen hierfür sind leistungsrechtliche
Nachhaltigkeit zu erarbeiten und weiterzuent- Grundlagen und finanzielle Ressourcen.
wickeln. Zudem haben die QPKs die Leistungen
Die Herausforderung ist, bestehende Instru-
des Öffentlichen Gesundheitsdienstes im Blick
mente aus der Prävention und Gesundheits-
und unterstützen die Qualitätssicherung im
förderung anschlussfähig an die bestehenden
Hinblick auf die von ihnen beauftragten Träger.
Qualitätsmanagementsysteme zu machen, da-
mit sie nicht als „Störgröße“ wahrgenommen
Projekt Wirkungsorientierung – werden.
Paritätischer Wohlfahrtsverband
Berlin
Ein weiterer Prozess in Berlin ist das Projekt Fazit
Wirkungsorientierung in der sozialen Arbeit n Das Thema Qualitätsentwicklung und
des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin in -sicherung ist eine Querschnittsaufgabe
Zusammenarbeit mit PHINEO. Ziel ist es, von- unterschiedlicher Ressorts, Träger- und
einander zu lernen und die Mitgliedsorganisa- Unterstützungsstrukturen.
tionen des Paritätischen Wohlfahrtsverbands
n Berlin verfügt über ein großes Potenzial
Berlin darin zu unterstützen, über Fragen der
an Strukturen und Prozessen, in denen
Wirksamkeit zu reflektieren. Im Mittelpunkt
ein nachhaltiger Dialog zur „Qualität der
steht die Frage, welche Wirkungsindikatoren
Gesundheitsförderung“ geführt werden
für die Arbeit zugrunde gelegt werden können.
kann.
Zu den Teilnehmenden zählen unterschiedliche
n Die Ausgangslagen und Voraussetzun-
Träger aus der Suchthilfe, der Genderarbeit, der
gen bei den Beteiligten sind sehr unter-
Prävention und Gesundheitsförderung.
schiedlich, so dass Vorgaben und Nach-
weise zur Wirksamkeit und Qualitätssi-
Qualitätsentwicklung als Störfaktor? cherung diesen Rahmenbedingungen
angepasst sein müssen.
Wohlfahrtsverbände sind Träger vieler Le-
benswelten wie Kitas, Familienzentren, Begeg- n Es bedarf ausreichender personeller Ka-
nungsstätten oder Pflegeheimen und damit pazitäten in den Trägerorganisationen,
zentrale Akteurinnen und Akteure in diesem um die definierten Ziele und Aufgaben
Feld. Im Rahmen des bundesweiten Kooperati- umsetzen zu können.
onsprojekts „Gesundheitsförderung in Lebens-
9Fachforen
Fachforen
Lernwerkstatt Good Practice
Impuls:
Christina Schadt, Fachstelle für Suchtprävention Berlin gGmbH
Moderation: Holger Kilian, Gesundheit Berlin-Brandenburg e. V.
Was macht die Praxis zur Förderung gesundheitlicher Chancengleichheit aus? Die zwölf Good
Practice-Kriterien des Kooperationsverbunds Gesundheitliche Chancengleichheit stecken einen
Rahmen für die Ausgestaltung gesundheitsfördernder Angebote ab. In der Good Practice-Lern-
werkstatt arbeiteten die Teilnehmenden gemeinsam daran, wie sie die Kriterien für die Quali-
tätsentwicklung der eigenen Arbeit nutzen können.
Ziel des Fachforums war es, den Good Prac- n Wie greift „Na klar“ das Thema Qualitäts- Nähere Informationen zu den Good-
tice-Ansatz des Kooperationsverbunds Ge- entwicklung auf? Practice-Kriterien unter:
www.gesundheitliche-chancengleichheit.
sundheitliche Chancengleichheit für die de/good-practice
n Welche der Good Practice-Kriterien sind im
Teilnehmenden inhaltlich und methodisch
Bereich der Suchtprävention besonders re-
erfahrbar zu machen und gemeinsam einen
levant?
Zugang zu oder auch einen neuen Blick auf die
Kriterien guter Praxis zu bekommen. Praktike-
rinnen und Praktiker bekommen die Möglich- Good Practice-Kriterium
keit, ihre eigenen Erfahrungen einzubringen „Konzeption“
und darüber zu diskutieren, was „gute Praxis“ Die Konzeptentwicklung des Projekts wurde
im Rahmen ihrer Arbeit ausmacht. mit Hilfe der Good Practice-Kriterien „Konzep-
Mit dem Good Practice-Bilderrätsel1 wurde tion“ und „Partizipation“ umgesetzt. Dem-
ein kreativer Einstieg gewählt, um den Teil- nach werden bei der Konzeption der Maßnah-
nehmenden die Good Practice-Kriterien als me u. a. überprüfbare Ziele festgelegt.
Qualitätskonzept näher zu bringen. Ziel ist Für die Kampagne wurden folgende Ziele ge-
es zu reflektieren, welche Ideen und Assozi- setzt:
ationen die Teilnehmenden mit den 12 Good
Practice-Kriterien verbinden. n Prävention von riskantem sowie abhängi-
gem Alkohol-, Cannabis- und Partydrogen-
Veranschaulicht wurden die Kriterien durch konsum
das Good Practice-Beispiel der Berliner Lan-
desinitiative zur Alkohol- und Drogenpräven- n Stärkung des Settingansatzes mit Schwer-
tion „Na klar – unabhängig bleiben!“, vor- punkt „Freizeitverhalten von Kindern, Ju-
gestellt von Christina Schadt, Fachstelle für gendlichen, jungen Erwachsenen im Hin-
Suchtprävention Berlin gGmbH. Dabei wurden blick auf Suchtmittelkonsum und riskante
folgende Fragen behandelt: Verhaltensweisen“
n Förderung von Risikokompetenz
1 Jede Kleingruppe erhält einen Satz aus 12 Bildern und
12 Icons der Good Practice-Kriterien. Es steht für jede n Förderung eines allgemeinen Gesundheits-
Arbeitsgruppe eine vorbereitete Pinnwand bereit, auf der das
bewusstseins
Ergebnis festgehalten werden soll: Auf der Pinnwand sind
die Icons der 12 Kriterien angeordnet, darunter oder darum
herum sind 12 Bilder angepinnt. Die Teilnehmenden ordnen n Wissensvermittlung und Aufklärung
jedes der 12 Bilder einem der 12 Kriterien zu.
11n Vernetzung – über klassische Netzwerke hi- Einzelhandels, des Ordnungsamts, den Ver-
naus waltungen sowie Akteurinnen und Akteure
aus der Politik.
n Unterstützung von Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren
Good Practice-Kriterium
n Verknüpfung mit dem nationalen Gesund- „Qualitätsmanagement“
heitsziel „Alkoholkonsum reduzieren“
Qualitätsmanagement zielt darauf ab, Maß-
Positiv hervorgehoben wurde dabei das res- nahmen bedarfs- und fachgerecht sowie par-
sortübergreifende Engagement für die Kam- tizipativ und zielgruppengerecht zu planen, zu
pagne sowie die gemeinsame Konzepter- gestalten und umzusetzen, sie kontinuierlich
arbeitung mit einer Planungsgruppe unter weiterzuentwickeln und somit immer besser
Mitarbeit von zwei Senatsverwaltungen, aller am Bedarf auszurichten. Folgende Maßnah-
Berliner Kommunalverwaltungen und der men wurden hierfür umgesetzt:
Fachstelle für Suchtprävention.
n Operationalisierung durch regelmäßig ta-
gende Planungsgruppe,
Good Practice-Kriterium
„Zielgruppenbezug“ n Vera nstaltungen und Projekte auf ge-
samtstädtischer Ebene,
In der Phase der Konzeption werden die
Zielgruppen präzise bestimmt und deren n Veranstaltungen und Projekte in den Berli-
Problemlagen genau beschrieben. Folgende ner Bezirken,
Zielgruppen werden für das Projekt „Na klar
n Öffentlichkeitswirksame Kommunikation,
– unabhängig bleiben!“ benannt: Erwachsene,
Presse- und Medienarbeit,
insbesondere Eltern; Jugendliche sowie Mul-
tiplikatorinnen und Multiplikatoren – z. B. n Erstellung und Betrieb einer Kampagnen-
pädagogische Fachkräfte, Beschäftigte des Website,
12Fachforen
n Interaktive Tools, n Settingansatz: Wie kann das Angebot in den
Strukturen der Lebenswelt verankert wer-
n Qualitätssicherung und -entwicklung, Eva-
den?
luation der Maßnahmen.
Für die Wirkungsorientierung wurde auf das
Good Practice-Kriterium „Kosten-Wirksam-
keits-Verhältnis“ Bezug genommen. In diesem
Zusammenhang standen das gemeinsame Diskussionsergebnisse
Handeln und ressortübergreifende Arbeiten
n Die Good Practice-Kriterien bieten über
zwischen Senat und Bezirken im Vordergrund.
die Handlungsfelder der Gesundheits-
Für die Umsetzung des Good Practice-Kriteri- förderung hinaus einen gemeinsamen
ums „Dokumentation/Evaluation“ wurden In- Rahmen für „gute Arbeit“.
strumente wie Kundenbefragung, Feedbacks,
n Die Kriterien müssen durch Beispiele
Jahresauswertungen wie auch Rückmeldun-
mit Leben gefüllt werden. Die Umset-
gen von Entscheidungsträgern genutzt.
zung in den jeweiligen Handlungsfel-
Anhand eines Projektbeispiels zur Canna- dern erfordert eine gründlich reflek-
bisprävention reflektieren die Teilnehmenden tierte „Übersetzung“ der Kriterien.
der Werkstatt, wie ausgewählte Good Practi-
n Es bestehen vielfältige Wechselwirkun-
ce-Kriterien angewendet werden können.
gen und -beziehungen zwischen den
Die ausgewählten Kriterien waren: Good Practice-Kriterien: Sie sind als ein
System zu verstehen.
n Multiplikatorenkonzept: Welche Multipli-
katorinnen und Multiplikatoren sollten wie n Die Good Practice-Kriterien können
eingebunden werden? dabei unterstützen, den Fortschritt der
eigenen Qualitätsentwicklung festzu-
n Empowerment: Wozu und wie sollten die
stellen.
Zielgruppen befähigt werden?
13Gesundheit wirkungsorientierter fördern
Impulse:
Anne Jeglinski, Leiterin der Geschäftsstelle Bezirke, Paritätischer
Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin
Charlotte Buttkus, Projektleiterin Pilot Wirkungsorientierung, PHINEO gAG
Moderation: Dagmar Lettner, Gesundheit Berlin-Brandenburg e. V.
„Die Wirkungsorientierung stellt ein Kernelement im Selbstverständnis der Freien Wohlfahrts-
pflege dar“, so die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) in einer
Standortbestimmung vom 25.9.2015. In der Praxis stellt jedoch das Managen und Bewerten von
Wirkungen die Akteurinnen und Akteure der freien Wohlfahrtspflege vor Herausforderungen.
Was heißt Wirkungsorientierung ganz konkret? Wie kann sie in der Praxis umgesetzt werden?
Und was bedeutet das für die Gesundheitsförderung? Diese Fragen wurden in der Werkstatt
beleuchtet und gemeinsam diskutiert.
Modellprojekt ner Landesverbands. Die Bewertung des Qua-
„Wirkungsorientierung“ litätsmanagements richtet sich jedoch insge-
samt stark auf quantitative Aspekte aus. Um
Anne Jeglinski berichtete über die Koopera-
hier den Blick auch auf die Qualität der Arbeit
tion des Paritätischen Wohlfahrtsverbands,
Nähere Informationen zu Phineo unter:
zu richten, wuchs das Interesse daran, auch
Landesverband Berlin, mit dem gemeinnüt-
www.phineo.org die Wirkung einzelner Angebote und Maß-
zigen Analyse- und Beratungshaus PHINEO.
nahmen zu betrachten und dieses Feld für die
Bereits Anfang der 1980er Jahre kamen kon- Mitgliedsorganisationen zu erschließen.
troverse Debatten hinsichtlich der Qualitäts-
Dafür wurde Kontakt zu PHINEO aufgenom-
entwicklung und -sicherung innerhalb sozia-
men, einem Analyse- und Beratungshaus,
ler Organisationen auf. Auf Grund steigender
das sich stark auf den Bereich Wirkung fo-
Kosten für Sozialhilfeausgaben wurde über
kussiert. 2014 schlossen beide Institutionen
mögliche Optimierungen nachgedacht. Für
den Kooperationsvertrag zum Pilotprojekt
den Paritätischen Wohlfahrtsverband stellte
„Wirkungsorientierung“, an dem sich 17 Mit-
die Basis für Qualitätsentwicklung das Kon-
gliedsorganisationen beteiligen. Ziel des Pi-
zept der ISO 9000 dar: ein komplexes Gebilde,
lotprojekts ist es, Chancen und Grenzen von
das eigentlich auf Wirtschaftsunternehmen
Wirkungsorientierung in der Praxis der sozia-
ausgelegt ist. Somit ließ es sich nicht pro-
len Arbeit zu erproben. Dabei setzt Wirkungs-
blemlos auf soziale Organisationen übertra-
orientierung als Weiterentwicklung des bishe-
gen. Ende der 1990er Jahre entwickelte der
rigen Qualitätsmanagements auf diesem auf.
Paritätische Wohlfahrtsverband daher ein ei-
genes System der Qualitätsentwicklung und
-sicherung, um Selbstevaluation und Fortbil- Wirkungsorientierung nach Phineo
dungen innerhalb kleinerer Organisationen Charlotte Buttkus ging in ihrem Impuls auf
zu realisieren und die Mitgliedsorganisatio- die Wirkungsorientierung ein. Gemeinnützige
nen bei der Implementation zu unterstützen. soziale Organisationen setzen das Ziel, Wir-
Neben Fortbildungen usw. entwickelten sich kungen gegenüber bestimmten Zielgruppen
Qualitätsgemeinschaften innerhalb des Berli- bzw. der gesamten Gesellschaft zu erreichen.
14Fachforen
Grafik 1
Quelle: PHINEO gAG 2016
Die Wirkung der gesundheitsförderlichen und genen Maßnahmen und der Qualitätssiche-
präventiven Interventionen spielt in der tägli- rung.
chen Arbeit eine tragende Rolle, jedoch ist die
Wirkungen sind Veränderungen, die Orga-
Transparenz darüber noch nicht ausreichend
nisationen mit ihren Aktivitäten bei ihren
in den Organisationen verankert. Es fehlt an
Zielgruppen, deren Lebensumfeld oder der
einem einheitlichen Verständnis von Wirkung.
Gesellschaft erreichen. Wirkungsorientierung
Wirkung kann als Veränderung in Folge einer
bedeutet, dass ein Projekt oder Angebot dar-
durchgeführten Intervention betrachtet wer-
auf ausgelegt ist, Wirkungen zu erzielen und
den. Dabei wird zwischen Output, Outcome
es entsprechend geplant und umgesetzt wird.
und Impact unterschieden (vgl. Grafik 1).
Dazu gehört es, die eigenen Ziele im Blick zu
Mit Hilfe der unten stehenden Wirkungslogik behalten. Die Wirkungsziele beschreiben die
können Zusammenhänge verständlich darge- gewünschte Veränderung bei den Zielgrup-
stellt werden. Die Wirkungstreppe, ein Instru- pen und gelten als Grundlage für Steuerung
ment zur Differenzierung von Wirkungszielen, und Analyse. Während der Zielformulierung
hilft Organisationen bei der Reflexion der ei- wird ein gemeinsames Verständnis und Ori-
Grafik 2
Quelle: PHINEO gAG 2016
15entierung für die Projektarbeit geschaffen. Nach beiden Impulsreferaten schloss sich eine
‘Wirkungsorientiert‘ heißt, Projekte von ih- lebhafte, durchaus kontroverse Diskussion zu
rem Ende her zu denken: Was soll das Projekt Möglichkeiten und Grenzen von Wirkungsori-
bewirken? Wen soll es erreichen? Und welche entierung und zur Einordnung des Pilotpro-
Veränderungen soll es bei der Zielgruppe aus- jekts für den Paritätischen Wohlfahrtsver-
lösen? Die Ziele sollten dabei verständlich for- band und seine Mitgliedsorganisationen an.
muliert, mess- bzw. überprüfbar, realistisch
erreichbar und zeitlich terminiert sein.
Diskussionsergebnisse
1. Erläuterungen zum Ansatz des Pilotprojekts
n Qualitätsmanagement und Wirkungsorientierung sind Elemente einer Professionalisie-
rung, die auch in die soziale Arbeit und Gesundheitsförderung Eingang gefunden haben.
n Die Wirkungsanalyse kann als sinnvolle Methode zur Professionalisierung der Arbeit im
sozialen Bereich beitragen.
n Das PHINEO-Modell gibt keine Ziele vor, sondern ist eine Art, wie man darüber nachden-
ken und dann auch steuern kann.
n Das Projekt „Wirkungsorientierung“ soll dazu beitragen, den oft diffus gestellten An-
forderungen an Wirkungsorientierung proaktiv begegnen zu können. Dafür wird unter
anderem eine Fortbildung zum Wirkungsmanagement pilotiert.
n Nicht nur erwünschte Veränderungen in der direkten Arbeit mit Zielgruppen können mit
der Wirkungstreppe abgebildet werden, auch die Änderung von Politik ist eine Interven-
tion mit Wirkungslogik.
2. Offene Fragen
n Wer legt fest, welche Wirkungen angestrebt werden sollen und wie diese überprüft wer-
den? Was geschieht, wenn die angestrebten Wirkungen nicht erreicht werden? Wird im
Rahmen einer wirkungsorientierten Arbeit die Komplexität von Setting-Interventionen auf
wenige messbare Indikatoren reduziert bzw. normiert?
3. Anforderungen für die Einführung von Wirkungsorientierung
n Wirkungsorientierung einzuführen, erfordert zusätzliche Ressourcen, um bisherige Pro-
zesse und Strukturen zu reflektieren und Mitarbeitende fortzubilden.
n Der Begriff des Wirkungsmanagements ist ganz zentral. Es muss jeweils der Zusammen-
hang zum Qualitätsbegriff im jeweiligen Handlungsfeld hergestellt werden.
16Fachforen
Möglichkeiten und Anforderungen des
GKV-Leitfadens
Impulse:
Ulrike Beyer, IKK Brandenburg und Berlin
Dr. Christa Preissing, Berliner Kita-Institut für Qualitätsentwicklung (BeKi)
Martina Breitmann, Pfefferwerk Stadtkultur gGmbH
Moderation: Marisa Elle, Gesundheit Berlin-Brandenburg e. V.
Der Leitfaden Prävention der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ist in der Primärpräventi-
on das zentrale Instrument zur Förderung von Leistungen der Gesetzlichen Krankenkassen. Doch
welche Anforderungen stellt der GKV-Leitfaden an Qualität? Wie sehen einerseits die Möglichkei-
ten und andererseits die Beschränkungen der GKV-Leitfaden-Finanzierung aus? Ziel des Fach-
austausches war es, Transparenz über Verfahrensprozesse, Handlungsfelder und Kriterien für
Akteurinnen und Akteure zu schaffen. Hierbei wurde insbesondere das Setting Kita betrachtet.
Nähere Informationen zum GKV-
Leitfaden Prävention unter:
GKV-Leitfaden Prävention berücksichtigt werden. Um Nachhaltigkeit www.gkv-spitzenverband.de
Ulrike Beyer stellte den GKV-Leitfaden Prä- zu erreichen und Fehlentwicklungen vor-
vention in seinen Grundzügen vor. Dieser zubeugen, ist es allerdings entscheidend,
erfährt eine dynamische Weiterentwicklung Einrichtungen bedarfsgerecht zu versorgen.
und wird 2017 dem Präventionsgesetz ange- Spezifische Kontextfaktoren wie Lebens- und
passt. Hierbei gilt Partizipation als Maßstab Arbeitsbedingungen sowie persönliche Prä-
für Qualität und die Zielgruppe als Experte ferenzen spielen dabei eine wichtige Rolle.
für ihr Zurechtkommen in wichtigen Alltags- Bereits vorhandene gesundheitsförderliche
und Berufssituationen. Dies ist nicht gleich- Angebote können von Krankenkassen mittels
bedeutend mit einer ausschließlichen Fokus- Fortbildung und Beratung gefördert und be-
sierung auf den Standpunkt der Zielgruppe. gleitet werden. Auf Grund der Vielzahl an Be-
Das Urteil der Professionellen muss weiterhin darfen und Präventionsansätzen ist eine „eins
17zu eins“-Unterstützung aller Einrichtungen des Leitfadens wird diese pädagogische Kon-
nicht möglich. Fachveranstaltungen und -di- zeption im Setting verankert. Nicht nur die
aloge ermöglichen hingegen die Vernetzung Beobachtung der Entwicklungsprozesse der
und den fachlichen Austausch über die eigene Kinder, die Stärkung von Partizipation und
Kita hinaus. Auch der direkte Austausch vor Kooperationen mit allen Beteiligten wirken
Ort ist wichtig zwischen Eltern, Kindern, Mit- sich auf die Qualitätssicherung aus, sondern
arbeitenden, Kita-Leitung, Kita-Träger sowie auch die kreative Alltags- und Raumgestal-
Kinder- und Jugendgesundheitsdienst. Einer- tung. Grundlage dessen sollte eine sensible
seits bietet der Leitfaden dafür gute Qualitäts- Auseinandersetzung mit dem individuellen
standards. Andererseits ist Prävention eine Gesundheitsbewusstsein sein. Dies ist bei
gesamtgesellschaftliche Aufgabe und geht Eltern, Kindern und Erziehenden vorhanden,
über den Leitfaden und die Fördermittel der jedoch durch sozio-kulturelle Diversitäten un-
Krankenkassen hinaus. Bildungs-, Arbeits-, terschiedlich ausgeprägt.
Wohnraum- und Städtebaupolitik beeinflus-
Um die Qualität in der Kita zu sichern, hat
sen die Verhältnisse vor Ort erheblich.
Berlin als bisher einziges Bundesland eine
Strategie entwickelt, welche sich der Quali-
Qualitätsentwicklung in Berliner tätsentwicklung und -sicherung widmet. In
Kitas dieser vom Senat für Bildung, Jugend und
Dr. Christa Preissing begrüßt den GKV-Leit- Wissenschaft und den Trägerorganisationen
faden. Die enge Kooperation von Bildungs- formulierten Qualitätsentwicklungsvereinba-
einrichtungen und dem Gesundheitssektor rung, verpflichten sich öffentlich finanzierte
wurden von ihr besonders hervorgehoben. Träger, gesundheitsförderliche und präven-
Pädagogisch-methodische Aufgaben der Er- tive Maßnahmen im Leitbild und im pädago-
zieherinnen und Erzieher, welche im Berli- gischen Konzept der Kitas zu verankern. Das
ner Bildungsprogram (BBP) formuliert sind, BeKI prüft, ob Qualitätskriterien des Berliner
gelten als Grundlage für eine kontinuierliche Bildungsprogramms bei der externen Evalua-
Qualitätsentwicklung in den Kitas. Mit Hilfe tion beachtet werden. Anfang 2017 wird das
18Fachforen
BeKI einen zusammenfassenden Bericht über Rahmen der gesundheitsförderlichen Maß-
die externe Evaluation publizieren. Hierbei ist nahmen, damit die Sicherung von Qualität
eine positive Entwicklung im Bereich der Ge- gewährleistet werden kann. Den Eltern sollte
sundheit und des seelischen Wohlbefindens mehr Beteiligung und leichterer Zugang er-
zu verzeichnen. möglicht werden, da sie als Expertinnen und
Experten für ihre Kinder verstanden werden.
Praxis in der Kita Knirpsenbude
Martina Breitmann berichtete praxisnah
über Qualitätsentwicklung und -sicherung
gesundheitsförderlicher Maßnahmen. Seit Diskussionsergebnisse
2012 nimmt ihre Kita am „Landesprogramm n Der Impuls für Gesundheitsförderung
Kitas bewegen – für die gute gesunde Kita“ muss aus der Kita selbst kommen.
teil. Das Konzept YoBEKA ist eine Kombinati-
on aus Yoga, Bewegung, Entspannung, Kon- n Eine Bedarfsanalyse ist Basis für die
zentration und Achtsamkeit. Die Kita Knirp- Schwerpunktsetzung. Die GKV kann
senbude entschied sich für dieses Konzept, bei Hinweisen auf bestehende Förder-
da die Eltern mit der pädagogischen Arbeit strukturen und/oder Mittelgebende
unzufrieden waren und die Mitarbeitenden unterstützen.
sich Möglichkeiten zur Entspannung und zum n Die Moderation/Begleitung von Quali-
Ausgleich wünschten. Dies wurde mit Hilfe ei- tätsentwicklungsprozessen von außen
ner Bedarfserhebung deutlich. Um Konzepte ist hilfreich.
der Prävention und Gesundheitsförderung
ganzheitlich zu realisieren, ist eine klare n Die (Unterstützungs-)Angebote der
Positionierung des Kita-Trägers notwendig. GKV sind im Setting Kita wenig be-
Damit Kita und Träger gut über vorhandene kannt.
Angebote und Leistungen der GKV informiert n Im Setting Kita werden interdisziplinä-
sind, ist ein reibungsloser Informationsfluss re Fachberatungen und eine verbesser-
und Transparenz darüber unabdingbar. Hin- te Personalausstattung benötigt.
zu kommt die Einbeziehung der Eltern im
19Qualitätsentwicklungsprozesse am Beispiel des
Systems Frühe Hilfen
Impulse:
Friederike Schulze, Landeskoordinierungs- und Servicestelle
Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen Berlin
Tobias Prey, Organisationseinheit Qualitätsentwicklung, Planung und
Koordination, Bezirksamt Mitte zu Berlin
Moderation: Jana Alfes, Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales
Berichtet wird über den Aufbau eines einheitlich anwendbaren Instruments zur Wirksamkeits-
betrachtung im Netzwerk Frühe Hilfen am Beispiel des Bezirks Berlin Mitte. Darüber hinaus
stehen Strukturen und Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung im Rahmen der Bundesinitiative
„Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“ im Fokus.
Nähere Informationen zur Hier stellen sich Fragen wie: Was braucht es, und den Einsatz von Familienhebammen und
Bundesinitiative Frühe Hilfen unter:
www.fruehehilfen.de/bundesinitiative- um aufeinander abgestimmte Leistungen und vergleichbaren Berufsgruppen aus dem Ge-
fruehe-hilfen eine von multiprofessionellen Akteurinnen sundheitsbereich sowie Ehrenamtsstrukturen
und Akteuren getragene Unterstützungs- und weitere Angebote im Bereich Frühe Hilfen.
struktur qualitätssichernd weiterzuentwi- Die niedrigschwelligen Angebote der Informa-
ckeln? Welche Instrumente und Vorausset- tion, Beratung und Unterstützung richten sich
zungen sind nötig, um die Wirksamkeit so- an werdende Eltern und Familien mit Kindern
wohl einzelner Angebote als auch der gesam- von 0-3 Jahren.
ten Netzwerkarbeit nachzuweisen?
Bei der Qualitätsentwicklung und -sicherung
wird der Fokus auf die Qualifizierung der Ak-
Bundesinitiative Frühe Hilfen
teurinnen und Akteure, die Evaluation von
Friederike Schulze stellt die Umsetzung der Angeboten und die Erprobung von Modell-
Bundesinitiative Frühe Hilfen in Berlin vor. projekten gelegt. Als Beispiel für Qualitäts-
Diese fördert neben Aus- und Aufbau von entwicklung auf Landesebene stellte Frau
Netzwerken Früher Hilfen die Qualifizierung Schulze die mit Hilfe von Fachreferentinnen
Grafik 3
QE/QS auf
Landesebene (LKS, SenBJW)
Steuerungs- Evaluation (Netzwerke,
gremium Familiengutscheine)
Qualifizierung Initiierung interdiszipli-
der bezirklichen NWK närer Qualitätszirkel
Multiprofessionelle Leitfaden (NWK, Fam-
Fachveranstaltungen Heb, Ehrenamt)
Regelmäßige
Austauschtreffen
20Fachforen
und -referenten durchgeführte Qualifizierung Bedeutung der Evaluation von
der bezirklichen Netzwerkkoordination dar. Angeboten
Die Qualitätsentwicklung in den Frühen Hil-
Tobias Prey erläuterte, warum Evaluation hin-
fen generiert sich sowohl aus Top-down als
sichtlich der Wirksamkeit der Angebote und
auch aus Bottom-up-Prozessen, d. h. Empfeh-
Netzwerkarbeit der Frühen Hilfen notwendig
lungen aus Theorie und Wissenschaft werden
ist. Die Interventionen bieten nicht nur wert-
ebenso berücksichtigt wie Erfahrungen aus
volle präventive Hilfen und humanistische
der Praxis.
Gewinne für Familien, sondern stellen eine
Der Ansatz der partizipativen Qualitätsent- finanzielle Entlastung für den öffentlichen
wicklung empfiehlt eine gleichberechtigte Haushalt dar. Wäre dies belegbar, würde sich
Zusammenarbeit zwischen Akteurinnen und die mangelnde bedarfs- und sachgerechte
Akteuren, der Zielgruppe und der Planungs- Finanzierung als Verstoß gegen die Landes-
und Steuerungsebene. Multiprofessionell haushaltsordnung darstellen, so Tobias Prey.
erarbeitete Leitfäden unterstützen die Ak- Das Netzwerk Frühe Hilfen in Mitte hat aus
teurinnen und Akteure auf bezirklicher Ebene diesem Grund den Einstieg in eine gemeinsa-
bei der Umsetzung der professionellen und me Evaluation beschlossen. Sowohl Politik auf
ehrenamtlichen Angebote. Multiprofessionel- Landes- und Bezirksebene als auch potenziel-
le Fachveranstaltungen und interdisziplinäre le Netzwerkpartnerinnen und -partner, Träger
Qualitätszirkel tragen dazu bei, Systemgren- und Familien sollen Antworten zur Wirksam-
zen zu überwinden und ein gemeinsames keit erhalten. Der Prozess der Evaluationsent-
Verständnis von Frühen Hilfen in Berlin zu wicklung wird als netzwerkweite Entwicklung
entwickeln. verstanden. Bereits seit über zweieinhalb
21Jahren beschäftigen sich die Akteurinnen und
Akteure mit deren Entwicklung. Hierzu bedarf Diskussionsergebnisse
es einer Vertrauensbasis innerhalb des Netz- n Qualität in den Angeboten der Frühen
werks, sowie Offenheit und Wertschätzung Hilfen bedeutet passgenaue Angebote,
gegenüber verschiedenen Handlungslogiken qualifizierte Fachkräfte und funktio-
der Partnerinnen und Partner. Auf Grund des nierende Netzwerke.
sehr komplexen Vorhabens einer Evaluation
entschied sich die Arbeitsgruppe, externe Un- n Qualitätsentwicklung in einem Netz-
terstützung in Anspruch zu nehmen. Tobias werk braucht eine kritische und aktive
Prey gibt zu bedenken, dass das Erhebungs- Auseinandersetzung aller beteiligten
instrument die Wirkung der Angebote und Partnerinnen und Partner.
des Netzwerks nicht im vollen Maße erfassen n Qualitätsentwicklung muss als berufli-
kann. Diese können jedoch qualitativ einge- ches Selbstverständnis verstanden und
schätzt und beurteilt werden. gelebt werden.
n Eine externe Unterstützung/Beglei-
tung bei der Qualitätsentwicklung ist
eine hilfreiche Ressource.
22Fachforen
Kooperation und Partizipation in der
Gesundheitsförderung für ältere Menschen am
Beispiel der Stadtteilzentren
Impulse:
Anna Zagidullin, stellvertretende Leiterin der Geschäftsstelle Bezirke des
Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Landesverband Berlin e. V.
Markus Runge, stellvertretender Geschäftsführer des
Nachbarschaftshauses Urbanstraße e. V.
Gerald Saathoff, Leiter der Villa Mittelhof e. V., Stadtteilzentrum in
Zehlendorf
Eva Bittner, Theater der Erfahrungen – Werkstatt der alten Talente,
Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V.
Moderation: Anna Zagidullin
Die Zahl der älteren Menschen steigt. Daher richten sich immer mehr Angebote der Gesundheits-
förderung an diese Zielgruppe. Dabei besteht zum Teil noch Unklarheit darüber, wie genau die
Angebote für ältere Menschen qualitätsorientiert ausgestaltet werden können. Im Fachforum
wird beispielhaft anhand der Stadtteilzentren diskutiert, wie vorhandene Qualitätsmerkmale in
die Praxis umgesetzt werden. Wie können Kooperationen z. B. mit Nachbarschaftsinitiativen,
Pflegeeinrichtungen oder Sportvereinen zur Weiterentwicklung von gesundheitsfördernden An-
geboten für ältere Menschen beitragen? Und welchen Stellenwert hat in diesem Zusammenhang
die Beteiligung (Partizipation) der älteren Menschen im Sozialraum?
Infrastrukturförderprogramm Teilhabe älterer Menschen in
Stadtteilzentren Kreuzberg
Anna Zagidullin stellte die Kooperationsverein- Markus Runge berichtete vom Netzwerk „Für
barung zur Umsetzung des Infrastrukturför- mehr Teilhabe älterer Menschen in Kreuz-
derprogramms Stadtteilzentren zwischen dem berg“. Der inhaltliche Schwerpunkt zielt auf
Land Berlin und dem Paritätischen Wohlfahrts- die Entwicklung und Ausgestaltung vielfäl-
verband als Arbeitsgrundlage der entsprechen- tiger Zugänge zu älteren Menschen ab. Um
den Einrichtungen vor. Ziele in diesem Rahmen Kooperations- und Vernetzungsstrukturen
sind die Stärkung des bürgerschaftlichen Enga- qualitätsorientiert aufzubauen, ist eine Kon-
gements und der Teilhabe, die Schaffung von tinuität in der Koordination des Netzwerks
Zugängen und die Vernetzung in der Stadt. nötig. Wichtig ist zudem, das Wir-Gefühl als
Auch gesundheitsförderliche Aktivitäten kön- Netzwerk zu stärken (z. B. durch gemeinsame
nen umgesetzt werden. Angesichts der knap- Aktionen), Wertschätzung in der Einbindung
pen Ressourcen der Stadtteilzentren, gerade von Mitgliedern zu zeigen sowie konkrete Ak-
auch für koordinierende Aufgaben, können tivitäten als machbare Meilensteine zu for-
gesundheitsförderliche Angebote für ältere mulieren und deren Erreichen zu sichern. Für
Menschen derzeit jedoch nur in begrenztem den nachhaltigen Erhalt des Netzwerks hat es
Umfang realisiert werden. sich als wichtig herausgestellt, auch nach in-
23Sie können auch lesen