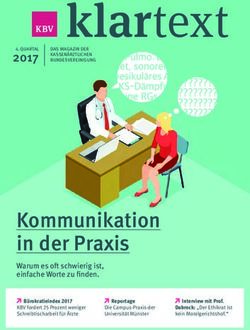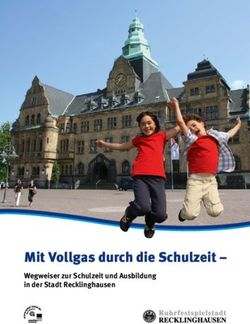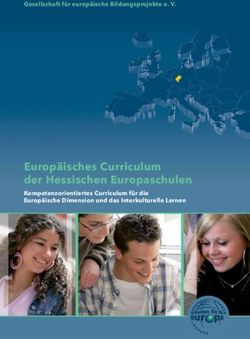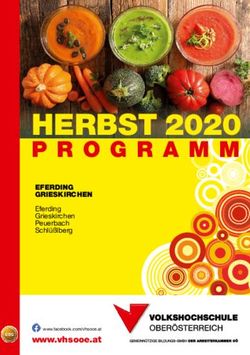Rettungssanitäter Heute-Bo o - Amazon AWS
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
J. Luxem K. Runggaldier (Hrsg.)
Rettungssanitäter
Heute ook inklu
5. Auflage
siv
E-B
e
B E
R O
E P
E S
LBENUTZERHINWEISE
Aus Rettungsdienst RS/RH wird Rettungssanitäter Heute. Dies ist das B) Grundlagen im Tätigkeitsfeld Maßnahmen auswählen, durch-
neue Lehr- und Lernbuch für die Ausbildung zum Rettungssanitä- Rettungsdienst führen und dokumentieren
ter. Es umfasst alle Inhalte, die für die Ausbildung und den Beruf als
Rettungssanitäter erforderlich sind. C) Ersteinschätzung und Untersu- Notfallsituationen erkennen,
Für die Rettungssanitäterausbildung existieren bisher keine bundesein- chung in Notfallsituationen erfassen und bewerten
heitlichen Regelungen oder Gesetze. Als Grundlage des Buches dienen des- D) Lebensrettende Maßnahmen In Notfallsituationen lebens-
halb länderspezifische Ausbildungsrichtlinien und Lehrpläne, die sich auf rettende und lebenserhaltende
einen handlungs- und lernfeldorientierten Ansatz beziehen und allesamt Maßnahmen durchführen
auf denselben acht Ausbildungszielen basieren. Inhaltlich deckt das Lehr- E) Diagnostik und Therapie Bei Diagnostik und Therapie
buch sämtliche vorhandene Ländercurricula ab und bezieht Empfehlungen mitwirken
des Ausschusses „Rettungswesen“ der Bund-Länder-Ebene ein.
F) Interaktion und Kommunikation Betroffene Personen unterstützen
Neue Ausbildungsziele aus den Länder- Anzahl der Unter- G) Zusammenarbeit in Gruppen und In Gruppen und Teams zusam-
curricula (A) richtseinheiten (UE) Teams menarbeiten
A1) Maßnahmen auswählen, durchführen und 46 UE H) Qualitätsstandards Qualitätsstandards im Rettungs-
dokumentieren dienst sichern
A2) Notfallsituationen erkennen, erfassen und 20 UE
Farbleitsystem Die Teile A bis H sind mit verschiedenen Farben
bewerten
gekennzeichnet.
A3) In Notfallsituationen lebensrettende und 46 UE Struktur der Kapitel Der Aufbau der einzelnen Kapitel folgt einer ein-
lebenserhaltende Maßnahmen durchführen heitlichen Struktur:
A4) Bei Diagnostik und Therapie mitwirken 20 UE • Fallbeispiel/Szenario
A5) Betroffene Personen unterstützen 10 UE
• Inhaltsübersicht
• Inhalte des Kapitels
A6) In Gruppen und Teams zusammenarbeiten 10 UE • Wiederholungsfragen
A7) Tätigkeit in Notfallrettung und qualifizier- 4 UE Dieses durchgängige Konzept unterstützt den Lernprozess und das fall-
tem Krankentransport orientierte Denken.
A8) Qualitätsstandards im Rettungsdienst 4 UE
sichern Kästen Im Text sind wichtige Informationen besonders gekennzeichnet.
Für die Kästen wird dabei ein durchgängiges Farbleitsystem genutzt:
Um sich schnell in Rettungssanitäter Heute zurechtzufinden, sind folgen-
de Besonderheiten dieses Lern- und Arbeitsbuches zu berücksichtigen: MERKE
Gliederung des Buches Zur leichten und schnellen Orientierung ist der Sehr wichtige Informationen zu einem Thema.
Inhalt in Rettungssanitäter Heute in acht Abschnitte untergliedert, die sich
an die obenstehenden Ausbildungsziele anlehnen.
Entsprechend einer modernen Lernfelddidaktik werden die Lesenden
im Buch zunächst an den Beruf und das Berufsbild des Rettungssanitäters ACHTUNG
Warnhinweise, häufig vermeidbare Fehler bei der Arbeit im Ret-
herangeführt und dann mit dem komplexen Handlungsfeld im Rettungs-
tungsdienst und Hinweise auf besonders zu beachtende Umstände.
dienst vertraut gemacht. Im Vordergrund steht die Ausbildung von beruf-
licher Handlungskompetenz. Denn Auszubildende sollen in der Lage
sein, im Krankentransport die Gesamtsituation im Blick zu behalten und P R A X I ST I P P
im Notfalleinsatz den Notfallsanitäter und Notarzt adäquat zu unterstützen.
Neben der medizinischen Fachkompetenz werden deshalb auch Inhalte Praxisrelevante Informationen für die Arbeit im Rettungsdienst.
dargestellt, die zur Ausbildung von Sozial-, Personal- und Methoden-
kompetenz dienen. Zielsetzungen sind Lernfeldorientierung sowie die
Vernetzung von Theorie und Praxis. IM FOKUS
Gliederung Rettungssanitäter Acht Ausbildungsziele Stichwortartige Zusammenfassung, z. B. der Ursachen, Sympto-
Heute me, Maßnahmen und Therapie eines typischen Krankheitsbildes
A) Berufsfeld Notfallversorgung und Tätigkeit in Notfallrettung und oder das Vorgehen bei einem Notfall oder Überblick über Systeme
Krankentransport qualifiziertem Krankentransport oder Theorien im Rettungsdienst u. ä.
VIII
0005261237.INDD 8 2/19/2022 8:01:52 AMBENUTZERHINWEISE
DEFINITION GESETZESTEXTE
Wichtige Auszüge aus Gesetzestexten
Kurzbeschreibung wichtiger Begriffe o. ä.
FALLBEISPIEL
Die Fallbeispiele geben Einsicht in authentische Situationen. Hier-
mit wird eine Brücke geschlagen zwischen der im Kapitel vermittel-
ten Theorie und ihrer Ausgestaltung in der Realität.
LERNZIELE
Die Lernziele führen im Sinne einer Zusammenfassung des Kapitels
in das Thema ein. Darüber hinaus weisen sie auf wichtige Inhalte hin,
die nach Studium des Kapitels als bekannt vorausgesetzt werden.
WIEDERHOLUNGSFRAGEN
Die Wiederholungsfragen am Ende des Kapitels geben Gelegenheit, die entsprechenden Textstellen, in denen die Antworten zu finden
den gelesenen bzw. gelernten Inhalt zu reflektieren. Verweise auf sind, ermöglichen eine selbstständige Lernkontrolle.
Abkürzungen Häufig wiederkehrende Begriffe werden im Text abge- Vernetzungen und Querverweise Die Texte eines Lehrbuches lassen sich
kürzt. Im Anhang findet sich ein ausführliches Verzeichnis der verwendeten nicht wie eine Perlenkette Fakt für Fakt und Satz für Satz aneinanderreihen.
Abkürzungen. Viele Themen werden während der Ausbildung von verschiedenen Seiten
beleuchtet. Jede Disziplin hat ihre eigene Sicht und betont andere Schwer-
Abbildungen und Tabellen Mehr als 460 Abbildungen veranschaulichen punkte bei ein und demselben Thema. Um Wiederholungen zu vermeiden,
z. B. medizinische oder rettungsdienstliche Gegebenheiten, zeigen wichtige beziehen sich die entsprechenden Textstellen der einzelnen Kapitel aufein-
Zusammenhänge oder typische Situationen aus dem praktischen Berufsall- ander, indem sie durch Verweise miteinander vernetzt sind.
tag des Rettungsdienstes.
Zahlreiche Tabellen fassen bestimmte Sachverhalte in einer schnell zu Online-Anbindung Ergänzend zum Buch finden Sie online auf der Platt-
überschauenden Weise zusammen und erleichtern dadurch das Lernen in form plus-im-web.de weitere Materialien zum Lernen und Lehren:
besonderem Maße. • Mehr als 40 Animationsvideos
Die Abbildungen und Tabellen sind jeweils kapitelweise nummeriert. An • 50 Arbeitsblätter mit Lösungen
den entsprechenden Textstellen wird auf die dazugehörige Abbildung oder • 20 anatomische Abbildungen zum Download
Tabelle verwiesen. • 2 Fallbeispiele zur Prüfungssimulation inkl. Lösungen
• 1 Gegenüberstellung der Inhalte der Vorauflage (Rettungsdienst
Register Besonders schnell lassen sich gesuchte Informationen über das RS/RH) mit den Inhalten dieses Buches
detaillierte Register am Ende des Buches finden. Sie erhalten darauf Zugriff mit dem Pincode auf der hinteren Buch
deckelinnenseite.
Fehler gefunden?
An unsere Inhalte haben wir sehr hohe Ansprüche. Trotz aller Sorgfalt kann es jedoch passieren, dass sich ein Fehler einschleicht
oder fachlich-inhaltliche Aktualisierungen notwendig geworden sind.
Sobald ein relevanter Fehler entdeckt wird, stellen wir eine Korrektur zur Verfügung. Mit diesem QR-Code gelingt der schnelle
Zugriff.
https://else4.de/978-3-437-48044-7
Wir sind dankbar für jeden Hinweis, der uns hilft, dieses Werk zu verbessern. Bitte richten Sie Ihre Anregungen, Lob und Kritik an folgende
E-Mail-Adresse: kundendienst@elsevier.com
IX
0005261237.INDD 9 2/19/2022 8:01:52 AMINHALTSVERZEICHNIS
A BERUFSFELD NOTFALLRETTUNG UND KRANKEN- 4.9 Stoffwechsel, Wasser- und Elektrolythaushalt,
TRANSPORT Säure-Basen-Haushalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
1 EINFÜHRUNG IN DAS BERUFSFELD RETTUNGSDIENST
ANDREAS FROMM (1.1–1.2), JÜRGEN LUXEM (1.3, 1.5), 5 INFEKTIONEN UND HYGIENE
DENNIS LENTZ (1.4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
JÜRGEN LUXEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
1.1 Tätigkeitsfelder im Rettungsdienst . . . . . . . . . . . . . 4
5.1 Infektionslehre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
1.2 Ethische Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5.2 Hygiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
1.3 Grundlagen des Lernens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
5.3 Infektionstransport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
1.4 Berufsrechtliche Regelungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.5 Arbeitsschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6 EINSATZTAKTIK UND EINSATZORGANISATION
TOBIAS SAMBALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
2 ORGANISATION DES RETTUNGSDIENSTES 6.1 Führung im rettungsdienstlichen Einsatz . . . . . . . . 152
DENNIS LENTZ (2.1–2.5), JÜRGEN LUXEM (2.6–2.7). . 19
6.2 Massenanfall von Verletzten und Erkrankten . . . . . 154
2.1 Definitionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
6.3 Leitstelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
2.2 Organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.3 Rettungskette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
7 KRANKENTRANSPORT
2.4 Finanzierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 TOBIAS SAMBALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
2.5 Rettungsdienstpersonal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 7.1 Grundlagen des Krankentransports . . . . . . . . . . . . 162
2.6 Rettungsdienstfahrzeuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 7.2 Phasen des Krankentransports . . . . . . . . . . . . . . . . 166
2.7 Geschichte des Rettungsdienstes . . . . . . . . . . . . . . 38 7.3 Transfer und Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
7.4 Pflegerische Versorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
B GRUNDLAGEN FÜR DAS TÄTIGKEITSFELD 7.5 Fehlervorbeugung und besondere Situationen . . . 190
RETTUNGSDIENST
3 GRUNDLAGENWISSEN PHYSIK, CHEMIE
UND BIOLOGIE 8 GEFAHRENSITUATIONEN
JÜRGEN LUXEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 TOBIAS SAMBALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
3.1 Physik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 8.1 Gefahren an der Einsatzstelle . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
3.2 Chemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 8.2 Zusammenarbeit an der Einsatzstelle . . . . . . . . . . . 198
3.3 Biologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 8.3 Brandbekämpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
8.4 Gefahrgutunfälle und Rettungsdienst . . . . . . . . . . . 200
4 ANATOMIE UND PHYSIOLOGIE55
JÜRGEN LUXEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 9 FUNK
4.1 Herz, Kreislauf und Blut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 TOBIAS SAMBALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
4.2 Atmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 9.1 Funkarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
4.3 Nerven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 9.2 Analoges Funkmeldesystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
4.4 Sinnesorgane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 9.3 TETRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
4.5 Stütz- und Bewegungsapparat . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 9.4 Vergleich von digitalem und analogem Funk . . . . . 213
4.6 Verdauung und Abdomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 9.5 Gesprächsabwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
4.7 Harnorgane, Nebenniere und männliche 9.6 Alarmierung per Funk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Geschlechtsorgane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 9.7 Funk in der Telemedizin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
4.8 Weibliche Geschlechtsorgane
und Schwangerschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
XI nhaltsverzeichnis
10 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 15 REANIMATION
DENNIS LENTZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 JÜRGEN LUXEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
10.1 Rechtliche Stellung des Rettungsfachpersonals . . 220 15.1 Herz-Kreislauf-Stillstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
10.2 Strafrechtliche Verantwortung . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 15.2 Therapie des Herz-Kreislauf-Stillstands . . . . . . . . . 322
10.3 Schadensersatzhaftung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 15.3 Postreanimationsphase (ROSC) . . . . . . . . . . . . . . . . 334
10.4 Straßenverkehrsrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 15.4 Reanimation im Kindesalter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
10.5 Sonstige Rechtsfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
10.6 Medizinprodukterecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 16 SCHOCK
10.7 Infektionsschutzgesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 JÜRGEN LUXEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
16.1 Pathophysiologie des Schocks . . . . . . . . . . . . . . . . 340
C ERSTEINSCHÄTZUNG UND UNTERSUCHUNG IN 16.2 Beurteilung des Schocks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
NOTFALLSITUATIONEN 16.3 Schockformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
11 BASISDIAGNOSTIK UND UNTERSUCHUNG
JÜRGEN LUXEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
17 WUNDBEURTEILUNG UND WUNDVERSORGUNG
11.1 Grundlagen der Patientenbeobachtung . . . . . . . . . 251 JÜRGEN LUXEM, BENJAMIN LORENZ . . . . . . . . . . . . . 355
11.2 Grundlagen der strukturierten 17.1 Wunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
Patientenuntersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
17.2 Blutungen und Blutstillung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
11.3 Fallstricke der Patientenuntersuchung . . . . . . . . . . 262
17.3 Fremdkörperverletzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
11.4 Besondere Vorgehensweise bei Großschadens
17.4 Amputationsverletzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
ereignissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
18 RETTUNGSTECHNIK, LAGERUNGSARTEN UND
12 APPARATIVE DIAGNOSTIK UND MONITORING
IMMOBILISATION
JÜRGEN LUXEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
JÜRGEN LUXEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
12.1 Blutdruckmessung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
18.1 Rettungstechniken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
12.2 Blutzuckermessung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
18.2 Lagerungsarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
12.3 Pulsoxymetrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
18.3 Immobilisationstechniken (Ruhigstellung) . . . . . . . 383
12.4 EKG-Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
12.5 Kapnometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
E DIAGNOSTIK UND THERAPIE
12.6 Fiebermessung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
19 EKG UND HERZRHYTHMUSSTÖRUNGEN
12.7 Geräte- und Beurteilungsfehler . . . . . . . . . . . . . . . . 274 JÜRGEN LUXEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
19.1 Grundlagen des EKgs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
13 DOKUMENTATION UND ÜBERGABE 19.2 EKG-Ableitungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
JÜRGEN LUXEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
19.3 Grundlagen der
13.1 Dokumentation im Rettungsdienst . . . . . . . . . . . . . 280 EKG-Beurteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
13.2 Übernahme und Übergabe von Notfallpatienten . . 286 19.4 Normaler Sinusrhythmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
19.5 Herzrhythmusstörungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
D LEBENSRETTENDE MASSNAHMEN 19.6 Supraventrikuläre Herzrhythmusstörungen . . . . . . 405
14 AIRWAYMANAGEMENT UND NARKOSE 19.7 Ventrikuläre Herzrhythmusstörungen . . . . . . . . . . . 406
JÜRGEN LUXEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
14.1 Airwaymanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
20 MEDIKAMENTENA PPLIKATION
14.2 Narkose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 ANDREAS LOBMÜLLER, JÜRGEN LUXEM. . . . . . . . . . 409
14.3 Beatmung mit Notfallrespiratoren . . . . . . . . . . . . . . 316 20.1 Applikationsformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
20.2 Darreichungsformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
20.3 Material für Infusion und Injektion . . . . . . . . . . . . . 418
20.4 Häufige Komplikationen und
Lösungsmöglichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
XII nhaltsverzeichnis
21 PHARMAKOLOGIE 25.9 Spezielle traumatologische Notfallsituationen . . . 540
JÜRGEN LUXEM, ANDREAS LOBMÜLLER. . . . . . . . . . 429
21.1 Allgemeine Pharmakologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
26 NEUROLOGISCHE NOTFÄLLE
21.2 Spezielle Pharmakologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 JÜRGEN LUXEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
26.1 Bewusstseinsstörungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
22 KARDIOZIRKULATORISCHE NOTFÄLLE 26.2 Ischämischer Insult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545
JÜRGEN LUXEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 26.3 Hämorrhagischer Insult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
22.1 Herzinsuffizienz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 26.4 Epileptische Krampfanfälle und Epilepsien . . . . . . 550
22.2 Arteriosklerose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 26.5 Bandscheibenvorfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553
22.3 Koronare Herzkrankheit (KHK) . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
22.4 Entzündliche Herzerkrankungen . . . . . . . . . . . . . . . 465
27 GYNÄKOLOGISCHE NOTFÄLLE UND GEBURTSHILFE
22.5 Akutes Koronarsyndrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 JÜRGEN LUXEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555
22.6 Kardiales Lungenödem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 27.1 Erkrankungen und Verletzungen
22.7 Hypertone Krise/hypertensiver Notfall . . . . . . . . . . 472 im Genitalbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556
22.8 Vasovagale Synkope/Orthostase . . . . . . . . . . . . . . 473 27.2 Komplikationen während der Schwangerschaft . . . 559
22.9 Gefäßverschlüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 27.3 Geburtshilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565
23 RESPIRATORISCHE NOTFÄLLE 28 PÄDIATRISCHE NOTFÄLLE
JÜRGEN LUXEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 JÜRGEN LUXEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
23.1 COPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 28.1 Entwicklung und Altersperioden . . . . . . . . . . . . . . . 574
23.2 Asthma bronchiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 28.2 Ersteinschätzung in Notfallsituationen . . . . . . . . . . 574
23.3 Pneumonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 28.3 Anatomische und physiologische Besonderheiten 576
23.4 Aspiration und Bolusverlegung . . . . . . . . . . . . . . . . 485 28.4 Respiratorische Notfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578
23.5 Hyperventilationssyndrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 28.5 Exsikkose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
28.6 Fieberkrampf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
24 AKUTES ABDOMEN UND METABOLISCHE NOTFÄLLE 28.7 Beinahe-Kindstod und plötzlicher Kindstod . . . . . . 584
JÜRGEN LUXEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 28.8 Kindesmisshandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
24.1 Akutes Abdomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
24.2 Gastrointestinale Blutungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 29 NEPHROLOGISCHE UND UROLOGISCHE NOTFÄLLE
24.3 Hohlorganverschlüsse (Koliken) . . . . . . . . . . . . . . . 499 JÜRGEN LUXEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589
24.4 Entzündungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 29.1 Niereninsuffizienz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
24.5 Gefäßerkrankungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 29.2 Nieren- und Harnleiterkolik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
24.6 Metabolische Notfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 29.3 Harnverhalt (Ischurie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
29.4 Akutes Skrotum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597
25 TRAUMATOLOGISCHE NOTFÄLLE 29.5 Verletzungen der Niere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
BENJAMIN LORENZ, JÜRGEN LUXEM . . . . . . . . . . . . . 515
25.1 Verletzungen des Bewegungsapparats . . . . . . . . . . 516 30 AUGEN- UND HNO-NOTFÄLLE
25.2 Verletzungen der Wirbelsäule . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 JÜRGEN LUXEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
25.3 Schädel-Hirn-Trauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 30.1 Augennotfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
25.4 Verletzungen des Brustkorbs (Thoraxtrauma) . . . . 528 30.2 HNO-Notfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
25.5 Verletzungen des Bauchraums
(Abdominaltrauma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 31 PSYCHIATRISCHE NOTFÄLLE
25.6 Verletzungen des Beckens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 JÜRGEN LUXEM, DENNIS LENTZ (31.6) . . . . . . . . . . . 615
25.7 Polytrauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 31.1 Erstkontakt und Ersteinschätzung . . . . . . . . . . . . . . 616
25.8 Einklemmungstrauma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 31.2 Syndromorientierte Akutzustände . . . . . . . . . . . . . 617
XIII nhaltsverzeichnis
31.3 Hirnorganisches Psychosyndrom (HOPS) . . . . . . . . 620 G ZUSAMMENARBEIT IN GRUPPEN UND TEAMS
31.4 Depression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 38 TEAM UND TEAMENTWICKLUNG
31.5 Suizidalität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 ANDREAS FROMM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703
31.6 Zwangsmaßnahmen gegen Patienten und Unter- 38.1 Teamentwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704
bringung von psychisch Kranken . . . . . . . . . . . . . . . 624 38.2 Gestaltung der Zusammenarbeit . . . . . . . . . . . . . . . 705
38.3 Crew-Resource-Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706
32 TOXIKOLOGISCHE NOTFÄLLE 38.4 Entscheidungsfindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708
JÜRGEN LUXEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627 38.5 Gefühle, Spannungen und Konflikte . . . . . . . . . . . . 709
32.1 Allgemeine Toxikologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
32.2 Beurteilung und Behandlungsmaßnahmen . . . . . . 630 39 ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTEN
32.3 Spezielle Vergiftungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 TOBIAS SAMBALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711
39.1 Umgang mit anderen Berufen
des Gesundheitswesens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712
33 THERMISCHE NOTFÄLLE
JÜRGEN LUXEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 39.2 Zusammenarbeit mit Polizei, Feuerwehr und Luft-
rettung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714
33.1 Wärmeregulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640
39.3 Zusammenarbeit mit weiteren Fachdiensten . . . . . 716
33.2 Hitzeerkrankungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
33.3 Verbrennungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644
33.4 Kälteschäden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649 H QUALITÄTSSTANDARDS
33.5 Strom- und Blitzunfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 40 QUALITÄTSMANAGEMENT
TOBIAS SAMBALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723
40.1 Grundbegriffe des Qualitätsmanagements . . . . . . . 724
34 ERTRINKUNGS- UND TAUCHNOTFÄLLE
40.2 Qualitätsmanagementsysteme . . . . . . . . . . . . . . . . 726
JÜRGEN LUXEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
40.3 Qualitätsmanagement im Rettungsdienst . . . . . . . 728
34.1 Ertrinkungsunfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658
34.2 Tauchnotfälle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662
41 STANDARDISIERTE KURSKONZEPTE UND
KURSSYSTEME
F KOMMUNIKATION UND INTERAKTION FRANK FLAKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733
35 KOMMUNIKATION UND INTERAKTION MIT 41.1 Einheitliches Vorgehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734
PAT IE NT E N U N D W E IT E RE N EINSATZ
41.2 Kursstruktur Provider-(Anwender-)Kurs . . . . . . . . . 736
BETEILIGTEN
ALEXANDER STÖTEFALKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 41.3 Kursstruktur Instruktorenkurs . . . . . . . . . . . . . . . . . 736
35.1 Grundlagen der Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . 672 41.4 Vor- und Nachteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737
35.2 Interaktion mit Patienten und weiteren Einsatz-
beteiligten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674 ANHANG
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740
36 STRESS UND EINSATZFOLGEBELASTUNGEN FREMDWÖRTERVERZEICHNIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744
ALEXANDER STÖTEFALKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681 LITERATURVERZEICHNIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747
36.1 Stress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 ABBILDUNGSNACHWEIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
36.2 Einsatzfolgebelastungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 INTERNET-ADRESSEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752
36.3 Psychische Erste Hilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687 REGISTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753
37 STERBEN UND TOD IM RETTUNGSDIENST
ALEXANDER STÖTEFALKE (37.1 UND 37.2),
JÜRGEN LUXEM (37.3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691
37.1 Umgang mit sterbenden Personen . . . . . . . . . . . . . 692
37.2 Umgang mit trauernden Personen . . . . . . . . . . . . . . 692
37.3 Todesfeststellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694
XIIIBERUFSFELD
NOTFALLRET TUNG UND
KRANKENTRANSPORT
1 EINFÜHRUNG IN DAS BERUFSFELD RETTUNGSDIENST 3
2 ORGANISATION DES RETTUNGSDIENSTES 19
0005258273.INDD 1 2/17/2022 12:41:39 PM1
EINFÜHRUNG IN
DAS BERUFSFELD
RET TUNGSDIENST
Andreas Fromm (1.1–1.2), Jürgen Luxem (1.3, 1.5), Dennis Lentz (1.4)
1.1 TÄTIGKEITSFELDER IM 1.3.2
1.3.3
Probleme im Lernprozess/Lernhilfen
Prüfungen und Prüfungsangst
9
11
RETTUNGSDIENST 4
1.3.4 Fortbildung und Weiterbildung 13
1.1.1 Notfallrettung und Krankentransporte 4
1.1.2 Wachaufgaben 6
1.1.3 Weitere Einsatzbereiche 6 1.4 BERUFSRECHTLICHE REGELUNGEN 14
1.1.4 Arbeitsbedingungen im Rettungsdienst 6
1.5 ARBEITSSCHUTZ 14
1.2 ETHISCHE GRUNDLAGEN 7
1.5.1 Organisation von Arbeitsschutz 14
1.2.1 Moral und Ethik 7 1.5.2 Arbeitsmedizinische Vorsorge 15
1.2.2 Medizinethische Prinzipien 8 1.5.3 Schutzimpfungen 16
1.2.3 Patientenverfügungen 8 1.5.4 Gesetzliche Unfallversicherungsträger 16
1.3 GRUNDLAGEN DES LERNENS 8
1.3.1 Was ist Lernen? 8
0005258273.INDD 3 2/17/2022 12:41:39 PM1 E inführung in das B erufsfeld R ettungsdienst
FALLBEISPIEL
Sie kommen zum Dienstbeginn Ihres ersten Praktikumstags ob alles passe. Nachdem Sie sich umgezogen haben, bietet
auf eine Rettungswache, an der zwei Rettungswagen und ein er Ihnen einen Kaffee an und fasst ein wenig zusammen, was
Notarzteinsatzfahrzeug stationiert sind. Gerade als Sie sich nun auf Sie zukommt. Zunächst würden Sie gemeinsam das
den anwesenden Teams vorstellen möchten, wird ein Alarm Fahrzeug checken, danach würden ein paar Reinigungsaufga-
ausgelöst. RTW und NEF werden zu einer Person mit Bewusst- ben anstehen. Auch übergibt er Ihnen einen Melder mit der
seinsstörung gerufen. Die Kollegen nicken Ihnen freundlich Bitte, sich sofort zum Fahrzeug zu begeben, wenn der Alarm
zu, einer stellt sich im Vorbeigehen kurz vor. Sie merken ausgelöst wird. Er gibt Ihnen noch den Rat, auch weiterhin zu
aber, dass es Ihnen schwerfällt, all die Eindrücke auf einmal versuchen, sich bei jedem einzelnen Kollegen vorzustellen,
zu verarbeiten, sodass Sie sich schon kurz darauf nicht mehr möglichst kontinuierlich Fragen zu stellen und stets Lerneifer
an den Namen erinnern. an den Tag zu legen. Da die Zeit im Wachenpraktikum nur
Ein Kollege des anderen RTWs stellt sich Ihnen nochmal in begrenzt ist, müsse jeder Auszubildende möglichst viel
Ruhe vor und berichtet, dass Ihre Einsatzkleidung bereits in Eigenantrieb mitbringen, um sich anständig auf die Prüfung
Ihren Spind gelegt wurde. Sie sollten aber nochmal schauen, und das Berufsleben vorbereiten zu können.
LERNZIELE
• Die Begriffe Notfallrettung und Krankentransport unter- • Lösungswege für ethische Fragestellungen im Rettungs-
scheiden dienst aufzeigen
• Unterschiedliche Einsatzbereiche von Rettungssanitätern • Die Strukturen des Lernens erfassen
kennenlernen • Fortbildung von Weiterbildung unterscheiden
• Einen Überblick über verschiedene Einsatzarten im Ret- • Die zentrale Bedeutung von Wissen und Qualifikation ver-
tungsdienst gewinnen stehen
• Einen Eindruck von den Arbeitsbedingungen im Rettungs- • Die berufsrechtlichen Regelungen des Rettungsdienstes
dienst gewinnen kennen
• Ethische Fragestellungen im Rettungsdienst benennen • Die arbeitsmedizinische Vorsorge und ihre Organisation
• Die Begriffe Ethik und Moral erläutern kennen
• Die Prinzipien der Autonomie, des Nichtschadens, der Für- • Den Wert und Sinn von Schutzimpfungen verstehen
sorge, der Gerechtigkeit, der Achtung der Menschenwürde • Die Aufgaben der gesetzlichen Unfallversicherung kennen
und der Wahrhaftigkeit kennen
1.1 Tätigkeitsfelder im • Übergabe an das Krankenhaus und Dokumentation des
Einsatzes
Rettungsdienst • Herstellen der Einsatzbereitschaft
1.1.1 Notfallrettung und Krankentransporte Bei bestimmten Notfalleinsätzen entsendet die Rettungsleitstelle
zusätzlich auch einen Notarzt an die Einsatzstelle. Das ist immer
Rettungsdienste sind für die Notfallrettung und für Kranken- dann erforderlich, wenn eine akute Lebensgefahr vorliegt (z. B.
transporte zuständig. Diese Einsätze werden von einer Rettungs- akute Atemnot). Sollte sich der Zustand des Patienten an der
leitstelle angenommen und koordiniert. Einsatzstelle schlechter darstellen, als es die initiale Alarmierung
andeutete, können Rettungssanitäter immer auch einen Not-
Notfallrettung
In der Notfallrettung werden Notfallpatienten versorgt. Das sind
Patienten, die sich aufgrund einer Verletzung oder einer Erkran-
kung aktuell in einem lebensbedrohlichen Zustand befinden
oder deren Zustand sich innerhalb kürzester Zeit verschlechtern
kann.
Zu den Aufgaben des Rettungsdienstes während eines Notfall-
einsatzes gehören (➔ Abb. 1.1):
• Beurteilung der Einsatzstelle, Eigenschutz und Kommunika-
tion mit der Leitstelle
• Untersuchung, Beurteilung und Überwachung des Patienten-
zustands
• Durchführung von einfachen und erweiterten Behandlungs-
maßnahmen
• Betreuung und Beratung von Patienten
• Auswahl einer geeigneten Zielklinik und fachgerechter Trans-
Abb. 1.1 Rettungsdienstmitarbeiter im Einsatz: Anamnese, Diagnostik
port und daraus abgeleitete Behandlung an der Einsatzstelle [W929]
4
0005258273.INDD 4 2/17/2022 12:41:40 PM1 . 1 T ätigkeitsfelder im R ettungsdienst 1
arzt nachfordern. Notärzte werden meist „bodengebunden“ mit Transportart Erläuterung
einem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) oder einem Notarztwa-
Einweisung Transport von Patienten zu einer stationären
gen (NAW) an die Einsatzstelle gebracht. In bestimmten Fällen klinischen Behandlung, die von einem Arzt
kann der Notarzt aber auch „luftgebunden“ mit einem Rettungs- angeordnet worden ist
hubschrauber (RTH) an die Einsatzstelle gebracht werden. Je Entlassung Transport von Patienten in das häusliche Umfeld
nach Patientenzustand nimmt der Notarzt an der Einsatzstelle nach einer stationären Behandlung in einer
nur eine Behandlung vor oder er begleitet den Patienten bis ins Klinik
Krankenhaus. Konsilfahrt Transport von Patienten zu einer ambulanten
Der Begriff Notfalleinsatz lässt denken, dass hier immer um Untersuchung bei einem Facharzt während einer
„Leben und Tod“ geht. Tatsächlich befindet sich aber nur ein stationären Behandlung
kleiner Teil der Patienten in einem lebensbedrohlichen Zustand. Verlegung Transport von Patienten von einer Klinik in
Ein großer Teil der Notfalleinsätze des Rettungsdienstes entpup- eine andere Klinik während einer stationären
Behandlung
pen sich vor Ort als psychosoziale Notlagen, bei denen keine aku-
te Erkrankung oder Verletzung im Mittelpunkt steht, sondern Hospizfahrt Transport von Patienten ohne Heilungschancen
in eine Hospizeinrichtung
vielmehr die Hilflosigkeit des Anrufenden. Bei Einsätzen dieser
Art sind vor allem eine einfühlsame Betreuung und eine umfas- Tab. 1.1 Formen von Krankentransporten
sende Beratung des Patienten wichtig. Oftmals ist hier dann auch
kein Transport in ein Krankenhaus erforderlich. Darüber hinaus
nahmen durch. Jeder Rettungsdienst verfügt über einen Desin-
kommt es immer wieder zu Fehleinsätzen durch Telefonstreiche
fektor. Dabei handelt es sich um einen speziell weitergebildeten
oder wenn sich der Patient vor Eintreffen des Rettungsdienstes
Mitarbeiter, der das Hygienekonzept verfasst und die Einhaltung
bereits von der Einsatzstelle entfernt hat.
der Desinfektionsmaßnahmen kontrolliert. Rettungssanitäter
können, nach erfolgreicher Teilnahme an der Weiterbildung, für
Krankentransport
diese Aufgabe eingesetzt werden.
Bei einem Krankentransport werden Patienten transportiert, die In Deutschland wird zudem flächendeckend ein Luftret-
sich absehbar nicht in Lebensgefahr befinden, aber eine Betreu- tungssystem vorgehalten. Hier kommen Rettungshubschrau-
ung durch Fachpersonal benötigen (sog. Qualifizierter Kranken- ber (RTH) und Intensivtransporthubschrauber (ITH) zum
transport). Für die Durchführung eines Krankentransports gibt Einsatz. Die Besatzung dieser Einsatzmittel setzt sich aus Pilot,
es unterschiedliche Anlässe (➔ Tab. 1.1). Notarzt und Notfallsanitäter zusammen. Gründe für den Einsatz
Liegendtransporte, bei denen keine Betreuung durch Fach- eines Hubschraubers sind vor allem:
personal erforderlich ist, sind hingegen keine Krankentransporte • Schneller Transport über große Distanzen
und werden von Unternehmen der Fahrgastbeförderung durch- • Schonender Transport (z. B. bei Wirbelsäulenverletzungen)
geführt (sog. Nichtqualifizierter Krankentransport). • Schnelle Zuführung des Notarztes im ländlichen Raum
ACHTUNG MERKE
Auch während eines Krankentransports kann sich der
Zustand von Patienten plötzlich verschlechtern. Rettungssa- Die meisten Rettungs- und Intensivtrabsporthubschrauber
nitäter müssen während des gesamten Transports wachsam fliegen nur tagsüber, also von Sonnenaufgang bis Sonnen-
sein, um auf plötzliche Verschlechterungen reagieren zu untergang. Nachtflüge können in manchen Regionen nur
können. mit längerer Vorlaufzeit organisiert werden.
Eine Sonderform des Verlegungstransports ist der Intensiv- Erkrankt oder verletzt sich ein Patient im Ausland oder an
transport. Dabei handelt es sich um Transporte von Patienten, seinem Urlaubsort, kann es erforderlich werden, ihn in sei-
die auf einer Intensivstation überwacht und behandelt werden. ne Heimat zu verlegen. Diese Art von Transporten wird auch
Der häufigste Anlass für einen Intensivtransport ist die Verlegung als Rückholtransport bezeichnet. Rückholtransporte können
in eine Spezialklinik. Intensivtransporte werden in der Regel boden- oder luftgebunden erfolgen.
von einem (Not-)Arzt begleitet. Überwachung und Behandlung Einsatzstellen mit einer Vielzahl verletzter Menschen wer-
müssen auch während des Transports lückenlos fortgesetzt wer- den auch als Massenanfall von Verletzen (MANV) bezeichnet
den, weshalb für diese Transporte meist besonders ausgestattete (➔ 6.2). Hier kommt den zuerst eintreffenden Einsatzkräften
Fahrzeuge (Intensivtransportwagen) mit intensivmedizinisch eine besondere Bedeutung zu. So schnell wie möglich muss die
geschultem Rettungsdienstpersonal eingesetzt werden. Ret- Anzahl der verletzten Personen bestimmt werden. Durch das
tungssanitäter übernehmen hier die Aufgabe des Fahrers. Prinzip der Vorsichtung bestimmen Rettungsdienstmitarbeiter
Sowohl bei Notfalleinsätzen als auch bei Krankentranspor- den Schweregrad der Verletzungen. Das wird jeweils durch eine
ten können die Patienten ansteckende Erkrankungen haben. Farbe gekennzeichnet. Durch eine präzise Rückmeldung an die
In diesen Fällen werden die Einsätze zusätzlich als Infektions- Leitstelle kann die erforderliche Menge an Einsatzkräften alar-
transporte gekennzeichnet. Das Rettungsdienstpersonal legt miert werden. Die Einsatzleitung übernehmen in diesen Fällen
hier zusätzliche Schutzkleidung (z. B. Infektionsschutzoverall) der Leitende Notarzt (LNA) und der Organisatorische Leiter
an und führt nach dem Einsatz geeignete Desinfektionsmaß- Rettungsdienst (OrgL-Rett). Der OrgL-Rett ist ein erfahrener
5
0005258273.INDD 5 2/17/2022 12:41:40 PM1 E inführung in das B erufsfeld R ettungsdienst
Mitarbeiter des Rettungsdienstes mit einer entsprechenden Die Industrie sucht im Bereich der Medizinprodukte vielfach
Weiterbildung, der zusammen mit dem LNA die Maßnahmen Praktiker, welche im Vertrieb oder in der Beratung ihre Praxis-
bei solchen Großschadenslagen koordiniert. erfahrungen einbringen.
Bestimmte Einsatzstellen erfordern Fachleute für die Beurtei-
lung von Gefahren, die Eigensicherung und die Rettung des 1.1.4 Arbeitsbedingungen im Rettungsdienst
Patienten. Für die Berg-, Wasser- und Höhlenrettung gibt es
deshalb speziell ausgebildete Einheiten, die den Rettungsdienst Rettungssanitäter haben im Einsatzdienst keine im Vorfeld klar
unterstützen. Die Einsatzkräfte dieser Spezialeinheiten verfügen bestimmbare Arbeitsumgebung. Die Arbeit kann im Freien,
oftmals auch über eine medizinische Qualifikation, z. B. zum in Räumen oder im jeweiligen Rettungsmittel stattfinden.
Rettungssanitäter. Rettungssanitäter können somit in allen erdenklichen Umge-
bungen tätig werden: Autobahn, Sauna, Arztpraxis, Baggersee,
Luxusvilla, Pflegeheim, im öffentlichen Raum etc. (➔ Abb. 1.2).
1.1.2 Wachaufgaben Das ist gleichermaßen reizvoll und herausfordernd. Medizini-
Um den reibungslosen Dienstablauf an einer Rettungswache sche Notfälle ereignen sich in allen sozialen Schichten. Hier ist
sicherzustellen, erledigt das Rettungsdienstpersonal in der ein besonderes Fingerspitzengefühl im Umgang mit bestimm-
einsatzfreien Zeit anfallende Wachaufgaben. Je nach Größe ten Patientengruppen gefragt. Rettungssanitäter erhalten so Ein-
und Einsatzaufkommen eines Rettungsdienstes werden einige blicke in das Leben von Patienten, welche oft unvorbereitet
dieser Aufgaben nicht von den im Dienst befindlichen Besat- mit einer medizinischen Notfallsituation oder einer Krise kon-
zungen, sondern von eigens dafür freigestellten Mitarbeitern frontiert sind. Menschen in Notfallsituationen unter Zeitdruck
ausgeführt. und den Augen der Öffentlichkeit die erforderliche Hilfe zu leis-
ten, kann als sehr erfüllend empfunden werden.
Im Rettungsdienst fehlt die Vorhersagbarkeit der Ereignisse.
IM FOKUS
Rettungssanitäter wissen nicht, wann und wo sie zu welchem
Aufgaben im Wachalltag einer Rettungswache Einsatz alarmiert werden. Um erfolgreich im Rettungsdienst zu
• Regelmäßige Überprüfung, Pflege und Instandhaltung sein, müssen Rettungssanitäter lernen, mit dieser permanenten
von Fahrzeugen und Gerätschaften Ungewissheit umzugehen.
• Routinedesinfektion und Reinigung Ein Risiko der Arbeit im Rettungsdienst besteht in den typi-
• Dienstplanung und Annahme von Krankmeldungen schen Berufskrankheiten. Hierzu zählen Wirbelsäulenerkran-
• Materialbestellung und Lagerwirtschaft kungen durch schweres Heben und Tragen und die Ansteckung
• Praxisanleitung von Auszubildenden durch Infektionen. In Einsätzen können Rettungssanitäter auf
• Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen
vielfältige Gefahrensituationen treffen:
• Infektionskrankheiten (die erst nach dem Einsatz bekannt
Überall, wo Medizinprodukte vorgehalten und eingesetzt werden)
werden (z. B. Beatmungsgeräte), muss eine beauftrage Person • Gefährliche Verkehrssituationen
(MPG-Beauftragter) bestimmt werden. MPG-Beauftragte sind • Sich irrational verhaltende Patienten
insbesondere für die regelmäßige Wartung der Medizingeräte • Angriffe auf Rettungsfachpersonal
und die Einweisung der Kollegen in deren Benutzung zustän- • Wetterlagen aller Art
dig. Rettungssanitäter können, nach erfolgreicher Teilnahme • Feuer, gefährliche Stoffe, Explosionen, Strom
an der Weiterbildung, für diese Aufgabe eingesetzt werden.
1.1.3 Weitere Einsatzbereiche
Über die genannten Einsatzbereiche hinaus werden Rettungs-
sanitäter von privaten Unternehmen auch als Betriebssanitäter
bei Großbaustellen beschäftigt. Neben der Versorgung von Not-
fällen sind Rettungssanitäter hier oft auch für den allgemeinen
Gesundheitsschutz der Mitarbeiter zuständig.
Die Hilfsorganisationen betreiben Hausnotruf- und medizi-
nische Transportdienste. Rettungssanitäter sind hier als Dis-
ponenten in den entsprechenden Leitstellen oder als Fahrer und
Einsatzkraft gefragt. Hausnotrufdienste rücken aus, wenn hilfe-
bedürftige Menschen in ihrer Wohnung einen Alarm ausgelöst
haben (z. B. nach einem Sturz). Medizinische Transportdienste
befördern Blutkonserven, medizinisches Probenmaterial oder
Organe für eine Transplantation.
Krankenhäuser beschäftigen Rettungssanitäter in zahlreichen
Bereichen, wie den Zentralen Notaufnahmen (ZNA) oder dem
Patiententransportdienst. Abb. 1.2 Auch der Einsatz und die Arbeit im öffentlichen Raum, z.B. bei
der Versorgung von Obdachlosen, gehört zu den Aufgaben des Rettungs-
dienstes. [J787]
6
0005258273.INDD 6 2/17/2022 12:41:40 PM1 . 2 E thische G rundlagen 1
• Körperausscheidungen von Patienten – Hinzu kommen verschiedene organisatorische und
• Aggressive Desinfektionsmittel administrative Aufgaben an der Rettungswache.
Darüber hinaus kann die Arbeit im Schichtdienst das Auftreten Auch die Arbeitsbedingungen im Rettungsdienst sind
von familiären Problemen, Ess- oder Schlafstörungen und Alko- etwas Besonderes:
holismus begünstigen. Belastende Einsatzsituationen können • Die Arbeitsbedingungen im Rettungsdienst sind sehr
zu psychischen Problemen führen. speziell und werden teilweise als belastend und teil-
weise als erfüllend empfunden.
• Belastende Aspekte können sein:
MERKE – Keine klar umrissene Arbeitsumgebung
– Zeitdruck und Schichtarbeit
Wer lange glücklich und gesund im Rettungsdienst – Spezielle Gefährdungen (z. B. Infektionsgefahren)
arbeiten will, achtet auf ausgewogenen Ernährung und • Erfüllende Aspekte können sein:
sportlichen Ausgleich, um die (Rücken-)Muskulatur und – Sehr autonomes Arbeiten
die Kondition zu stärken und für mentale und emotionale – Einmalige Einblicke in fremde Lebenswelten
Entspannung zu sorgen. Nach belastenden Einsatz- – Gemeinschaftsgefühl und Teamarbeit
situationen gibt es immer Angebote zur professionellen
Aufarbeitung.
1.2 Ethische Grundlagen
Chancen zur persönlichen Weiterentwicklung bestehen für
Rettungssanitäter einerseits „horizontal“, also durch Qualifika-
1.2.1 Moral und Ethik
tion für die verschiedenen Arbeitsbereiche. Andererseits kann Die Begriffe Moral und Ethik sind eng miteinander ver-
auch eine „vertikale“ Weiterentwicklung angestrebt werden. knüpft. Die Moral beschreibt das System der Werte und
Hier sind vor allem die (verkürzte) Ausbildung zum Notfallsa- Normen, nach denen verschiedene Gruppen (z. B. Familien,
nitäter und das Angebot an speziellen Studiengängen in den Berufsgruppen, aber auch Gesellschaften) – handeln und
Bereichen (Gesundheits-)Management oder Medizinpädago- zusammenleben. Ethik ist hingegen eine übergeordnete phi-
gik zu nennen. losophische Disziplin und kann demnach als Wissenschaft
der Moral verstanden werden. Sie setzt sich systematisch und
theoretisch fundiert mit den moralischen Prinzipien einer
IM FOKUS Gruppe auseinander und stellt diese immer wieder auf den
Tätigkeitsfeld und Arbeitsbedingungen Prüfstand. Ethische Fragestellungen können jedoch nicht mit
• Tätigkeitsfelder sind konkrete fachliche Gebiete, in „richtig“ oder „falsch“ beatwortet werden. Wichtig ist die
denen Menschen arbeiten. Sie unterscheiden sich von genaue Begründung, die den Einzelnen zu seiner Entschei-
Berufsfeldern, die etwas allgemeiner gehalten sind. dung geführt hat.
• Einsatzbereiche bzw. Tätigkeitsfelder für Rettungssani-
täter sind:
– Notfallrettung und Krankentransport: DEFINITION
– Originärer Einsatzbereich im Rahmen der Berufs-
ausbildung Die Moral umfasst Werte und Normen, auf deren Grundla-
– Hausnotruf- und medizinischer Transportdienst: ge bestimmte Personengruppen ihr Handeln begründen.
– Tätigkeit als Disponent in den entsprechenden Ethik ist die Wissenschaft der Moral. Sie stellt die jeweili-
Leitstellen gen Werte und Normen auf den Prüfstand und sucht nach
– Transport von Blutkonserven, Transplantaten etc. gutem, gerechtem und menschenwürdigem Handeln.
– Großbetriebe:
– Als Betriebssanitäter (Weiterbildung i. d. R. not-
Rettungssanitäter sollten ihre Arbeit an den Prinzipien der
wendig)
– Krankenhäuser: medizinischen Ethik ausrichten. Das Prinzip der Autonomie
– z. B. in der Zentralen Notaufnahme oder im Patien- beschreibt die Freiheit des Patienten, sich für oder gegen eine
tentransportdienst Behandlung entscheiden zu können. Wenn Patienten sich gegen
– Medizintechnikindustrie: eine medizinisch erforderliche Behandlung oder einen Transport
– z. B. im Vertrieb oder für Beratungsaufgaben aussprechen, müssen sie über die Risiken dieser Entscheidung
• Jedes Tätigkeitsfeld hat verschiedene Arbeitsbedingun- hinreichend aufgeklärt werden. Das kann die Nachforderung
gen, Abläufe und ganz spezifische Vor- und Nachteile. eines Notarztes erforderlich machen. Rettungskräfte müssen
• Das Tätigkeitsfeld, in dem Rettungssanitäter am häufigs- es aber auch aushalten können, dass Patienten sich nach einer
ten arbeiten, sind Notfallrettung und Krankentransport.
umfangreichen Aufklärung gegen eine erforderliche Maßnahme
– Neben der Bearbeitung verschiedener Einsatzarten,
aussprechen.
etwa einem Entlassungstransport, einem Notfall-
einsatz oder einem Intensivtransport, müssen noch
weitere Aufgaben verrichtet werden.
– Die Einsatzmittel müssen geprüft, gepflegt und
einsatzbereit gehalten werden.
7
0005258273.INDD 7 2/17/2022 12:41:40 PM1 E inführung in das B erufsfeld R ettungsdienst
Auto- Nicht- Für- Gerechtig- Rettungs-
Patient
nomie schaden sorge keit sanitäter Abb. 1.3 Medizinethische Prinzipien als
handlungsleitende Grundlage in der Beziehung
zwischen Patient und Rettungssanitäter (nach
Beauchamp & Childress 2013. [P104][L231]
1.2.2 Medizinethische Prinzipien MERKE
➔ Abb. 1.3 Patientenverfügungen
• Das Prinzip des Nichtschadens beschreibt, dass eine • Eine Patientenverfügung drückt den Willen eines
Behandlung dem Patienten nutzen und keinen weiteren Scha- Patienten aus für den Fall, dass er diesen nicht mehr frei
den herbeiführen soll. äußern kann.
• Rettungssanitäter sollten ihre Arbeit zudem so ausrich- • Eine Vorsorgevollmacht regelt, wer den Patienten in
ten, dass der Wille, den Menschen helfen zu wollen, im bestimmten Aspekten der Lebensführung rechtlich ver-
Mittelpunkt steht. Diese Haltung beschreibt das Prinzip der treten soll.
Fürsorge. • Liegt keine Patientenverfügung vor, ist der mutmaßliche
• Zudem sollte das Prinzip der Gerechtigkeit berücksichtigt Wille entscheidend.
werden. Das bedeutet, dass alle Patienten gleichbehandelt
werden sollen, unabhängig von ihrer Herkunft, Sexualität,
Religion etc. Der enorme Zeitdruck in Notfallsituationen ist ein großes Prob-
• In Notfallsituationen kann es vorkommen, dass Patienten die lem bei der praktischen Umsetzung von Patientenverfügungen
Kontrolle über Teile ihres Körpers verlieren. Rettungssani- im Rettungsdienst. Die inhaltliche und formale Prüfung einer
täter sollten dem Prinzip der Menschenwürde folgen und Verfügung durch den Notarzt nimmt einige Zeit in Anspruch.
mit einem angemessenen Verhalten die Würde des Patienten Verzögerungen bei der Patientenversorgung können erhebliche
wahren. So werden entkleidete Patienten möglichst zugedeckt Auswirkungen haben. Deshalb gelten hier zunächst die folgen-
und nicht entblößt gelagert. den Grundsätze:
• Das Prinzip der Wahrhaftigkeit beschreibt, dass Rettungs- • Im Zweifel für das Leben
sanitäter mit ihren Patienten bedingungslos ehrlich und • Fragen werden später gestellt.
aufrichtig umgehen sollten. • Ein Irrtum im Hinblick auf das Leben ist erträglicher als ein
Irrtum im Hinblick auf den Tod.
MERKE
• Eingeleitete Maßnahmen können auch später noch, nach
kritischer Prüfung, wieder beendet werden.
Prinzipien-Modell der medizinischen Ethik
• Prinzip der Autonomie: Respekt gegenüber dem Willen MERKE
des Patienten
• Prinzip des Nichtschadens: Behandlung darf Patienten Rettungssanitäter können in Notfallsituationen zunächst
nicht weiter schaden lebensrettende Maßnahmen durchführen, auch wenn eine
• Prinzip der Fürsorge: Selbstverständnis, Menschen Patientenverfügung vorliegt. Dieses Vorgehen ist ethisch
helfen zu wollen und rechtlich legitimiert.
• Prinzip der Gerechtigkeit: gleiche Behandlung aller
Patienten
• Prinzip der Achtung der Menschenwürde: z. B. bei
Kontrollverlust über den Körper
• Prinzip der Wahrhaftigkeit: ehrliches und angemesse-
1.3 Grundlagen des Lernens
nes Auftreten 1.3.1 Was ist Lernen?
Unter den Themen, denen sich dieses Buch widmet, findet sich
an erster Stelle ein Kapitel über das Lernen. Die Rettungsdienst-
1.2.3 Patientenverfügungen ausbildung wird für Sie mit sich bringen, sehr viel Neues in rela-
tiv kurzer Zeit lernen zu müssen, und zwar so gründlich, dass
In einer Patientenverfügung haben Patienten die Möglich- Sie sich in Einsatzsituationen auf das Gelernte verlassen können.
keit, vorsorglich ihren Willen hinsichtlich bestimmter The- Dieses Kapitel soll Ihnen dabei helfen, indem Sie Grundlegendes
rapiemaßnahmen zu formulieren, falls sie selbst nicht mehr über das Lernen erfahren und einige Tipps zur Lernorganisation
entscheidungsfähig sind. Ebenso kann eine Vorsorgevollmacht erhalten.
für Vertrauenspersonen festgelegt werden. Ärzte sind verpflich-
tet, den Willen des Patienten bei der Entscheidung über eine
Behandlung zu berücksichtigen und zu respektieren.
8
0005258273.INDD 8 2/17/2022 12:41:40 PM1 . 3 G rundlagen des L ernens 1
Definition schaftlicher Erkenntnis ist es daher nicht sinnvoll, z. B. mehr als
Die Frage, was genau eigentlich unter dem Begriff „Lernen“ zu zehn Nummern oder Namen in einem Anlauf lernen zu wollen.
verstehen ist, lässt sich nicht leicht beantworten. Es kursieren
daher annähernd so viele verschiedene Begriffsdefinitionen wie P R A X I ST I P P
Lehrbücher. Eine sehr allgemein gehaltene und dadurch brauch-
bare Definition lautet: Wie man es schafft, sich 40 verschiedene Notfallmedika-
mente oder 15 Dinge, die für eine Intubation benötigt
werden, zu merken, erfahren Sie im Abschnitt „Lernhilfen“
DEFINITION (➔ 1.3.2).
Lernen ist eine Verhaltensänderung infolge zuvor gemach-
ter Erfahrungen. Die dauerhafte Gedächtnisebene ist das Langzeitgedächtnis.
Informationen, die hier gespeichert werden, bleiben für sehr lan-
ge Zeit – in vielen Fällen sogar ein Leben lang – vorhanden und
Diese Definition beschreibt allgemein, was bei jeder Art von Ler-
mit mehr oder weniger großem Aufwand abrufbar. Die Kapazität
nen passiert: Ein Mensch macht eine Erfahrung, das heißt eine
des Langzeitgedächtnisses ist nahezu unbegrenzt. Entscheidend
Wahrnehmung in einer bestimmten Situation (etwas Bestimm-
für ein dauerhaftes Behalten von Informationen ist der Übergang
tes hören, sehen, fühlen). Etwas gelernt wurde genau dann, wenn
aus dem Kurz- in das Langzeitgedächtnis, d. h., die Information
sich der Betreffende danach in bestimmten Situationen anders
muss über das Kurzzeitgedächtnis gelaufen und als wichtig einge-
verhält als vorher.
stuft worden sein. Ist die Information interessant, bekannt, wich-
Ein einfaches Beispiel kann dies erläutern: Sie sind nicht in
tig, durchschaubar, logisch, ästhetisch und motivierend? Je mehr
der Lage, das Beatmungsgerät aus der neuen Wandhalterung zu
dieser Fragen mit „Ja“ beantwortet werden, desto schneller und
lösen, da Sie den Mechanismus der Verriegelung nicht kennen.
dauerhafter geht die Information in das Langzeitgedächtnis über.
Nun sehen Sie einem kundigen Kollegen bei der Entnahme des
Dabei ist die Aufbereitung der Information für den Lern-
Geräts zu. Ab jetzt verhalten Sie sich anders: Sie führen die Hand-
prozess entscheidend. Die Information wird wieder vergessen
griffe so aus, wie Sie es soeben erfahren haben (und entnehmen
werden, wenn man sich nicht erneut an sie erinnert und sie
erfolgreich und sicher das Gerät). Sie haben etwas gelernt.
wiederholt. Deshalb besteht das Lernen hauptsächlich aus dem
Das Gedächtnis Wiederholen, denn so prägen sich die Dinge am besten ein und
werden nicht wieder vergessen.
Lernen kann nur funktionieren, wenn Informationen im Gehirn
gespeichert werden können. Diese Funktion des Gehirns wird als Lernphasen
Gedächtnis bezeichnet und verfügt über drei Gedächtnisebenen:
Ein Lernprozess benötigt zwei Formen von Lerntätigkeiten, um
• Sensorisches Gedächtnis
erfolgreich und dauerhaft etwas im Gehirn des Lernenden zu
• Kurzzeitgedächtnis
bewirken: aufnehmende und ausdrückende Lerntätigkeiten. Es
• Langzeitgedächtnis
lassen sich daher zwei Phasen des Lernens unterscheiden (➔ Tab.
Über die Sinne (Sehen, Hören, Riechen, Tasten, Schmecken)
1.2), sozusagen das „Einatmen“ und das „Ausatmen“. Die beiden
nimmt der Mensch in jeder Sekunde bis zu mehrere Millionen
Phasen des aufnehmenden und ausdrückenden Lernens sollen
Bit an Information auf. Als Schutz vor Überforderung durch
sich immer wieder abwechseln, um einen optimalen Lernerfolg
diese Reizflut werden ganz gezielt unwichtige Informationen
zu garantieren.
vergessen und nur die wichtigen in das Gedächtnis aufgenom-
men.
Die erste Gedächtnisebene ist das sensorische Gedächtnis Aufnehmende Ausdrückende
mit einer Speicherdauer von maximal 20 Sek. Das sensorische Lerntätigkeiten Lerntätigkeiten
Gedächtnis ist für jede Sinneswahrnehmung spezifisch und wird Betrachten Anwenden
in eine visuelle Wahrnehmung (ikonisches Gedächtnis) und Beobachten Vortragen
eine auditive Wahrnehmung (echoisches Gedächtnis) unter- Lesen Diskutieren
teilt. Zuhören Erklären
Abzeichnen Rollen spielen
In diesen Speicher gelangen zunächst alle Informationen, die
Auswendiglernen Aufgaben lösen
der Mensch bewusst wahrnimmt. Wenige Sekunden nach der
Betrachtung können noch sehr viele Details wiedergegeben wer- Tab. 1.2 Lerntätigkeiten und Lernphasen
den. Nach mehreren Minuten sind nur noch solche Wahrneh-
mungen erinnerlich, die besonders aufgefallen sind und daher in
die nächste Gedächtnisebene übergegangen sind. 1.3.2 Probleme im Lernprozess/Lernhilfen
Das Kurzzeitgedächtnis ist der „Arbeitsspeicher“ des
menschlichen Gehirns. Hier werden bis zu einer Dauer von etwa Lernkanäle
20 Min. die neuen Informationen gespeichert, die für die aktuel- Psychologische Untersuchungen haben gezeigt, dass der Lern-
len Denkprozesse benötigt werden. Die Kapazität des Kurzzeit- erfolg stark davon abhängt, auf welchem Weg der Lernstoff
gedächtnisses ist ziemlich genau bekannt. Sie beträgt zwischen wahrgenommen wird. Die Ergebnisse sind in ➔ Abb. 1.4 dar-
fünf und neun Einzelinformationen („7 ± 2“). Nach wissen- gestellt.
9
0005258273.INDD 9 2/17/2022 12:41:40 PMSie können auch lesen