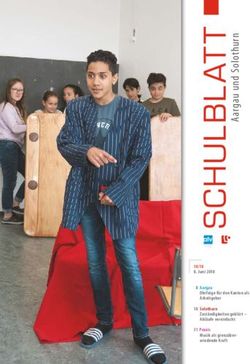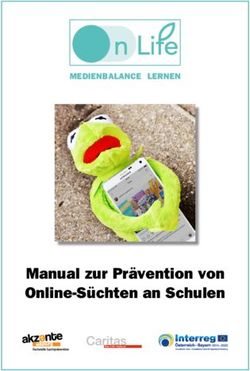Schwerpunktthema: Sprach- und Leseförderung - ISB
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
STAATSINSTITUT FÜR SCHULQUALITÄT
UND BILDUNGSFORSCHUNG
MÜNCHEN
Ausgabe 2019
Schwerpunktthema:
Sprach- und Leseförderung
Inhalt
Editorial .......................................... 3
Grundsatzartikel: Sprache im Fach ..... 4
Aus unserer Werkstatt .................... 1 9
Willkommen und Abschied ............. 31Editorial
Editorial
Liebe Leserinnen und Leser unserer ISB-Info,
der Titel unserer neuesten ISB-Info heißt Sprach- und Leseförderung. Zu Recht, da unsere
Kommunikation, unser Verstehen und Begreifen, über diese beiden Fähigkeiten abläuft:
Sprechen und Lesen. Wer dazu nicht in der Lage ist, weiß um die Folgen. Gerade des-
halb ist es immer wieder unser Anliegen, auch im Sinne der Inklusion, Hilfen und Unter-
stützungsangebote zu schaffen. Ebenso stellt die Sprache für Zugewanderte ein großes
Hindernis dar – wir wissen es selbst, wie es uns geht, wenn wir im Ausland sind und nichts
verstehen.
Auf die Schule bezogen, sprechen wir von der „Sprache im Fach“. Als erster Beitrag wird
ein umfassendes Projekt der KU Eichstätt-Ingolstadt und der LMU München dargestellt,
das vor allem auf eine vernetzte Lehrerbildung abzielt. Im zweiten Beitrag wird auf die
Sprachbildung am Beispiel des Wortspeichers abgehoben. Bereits in der Grundschule zeigt
es sich, dass die zunehmende sprachliche Heterogenität und Mehr- bzw. Vielsprachigkeit
im Klassenzimmer die Sprachbildung vor veränderte Aufgaben stellen. Ebenso trifft dies
auf „Berufssprache Deutsch“ in den beruflichen Schulen zu. Die beschriebenen Materia-
lien sollen dazu beitragen, dass junge Menschen beruflich gut integriert werden und somit
zu einem erfolgreichen Berufsabschluss gelangen. Dies beabsichtigt auch das große Projekt
BISS, Bildung durch Sprache und Schrift. Hierbei handelt es sich um Sprachförderung in
Bayern und im Bund.
Die Lesekompetenz ist in den Fokus der Aufmerksamkeit geraten, als die verschiedenen
Tests zeigten, dass unsere Schülerinnen und Schüler schlecht im Lesen abschneiden. Daher
wurden das Projekt #lesen.bayern.de ins Leben gerufen und ein Online-Portal samt Leitfa-
den und Fortbildungen konzipiert. Lesekompetenz ist eine Teilkompetenz der sprachlichen
Bildung. Sie zu beherrschen macht die Leistung im jeweiligen Fach aus. Ein Artikel geht auf
die Leseförderung an den Grundschulen mit FiLBy ein. Zur fachintegrierten Leseförderung
in Bayern ist jeweils ein Beitrag aus der Mittelschule und aus dem Gymnasium in unserer
ISB-Info zu finden.
Schließlich können Sie noch etwas zum bilingualen Unterricht erfahren. Das Erlernen von
zwei Sprachen im Unterricht wird zunehmend gefördert; hier werden Beispiele aus der
Grundschule und der Realschule beschrieben. Und die Leseförderung darf nicht ohne die
Digitalisierung gesehen werden. Unter den Bedingungen der Digitalität stellt sich die Ver-
besserung der Leseförderung noch eindrücklicher dar. Abgerundet wird unser Heft durch
einen Exkurs über ein Projekt im evangelischen Religionsunterricht.
Zu guter Letzt dürfen Sie sich wieder darauf freuen zu erfahren, wer ins ISB berufen wurde
und wer inzwischen an anderer Stelle im schulischen Kontext erfolgreich geworden ist. Ich
danke allen Autorinnen und Autoren für ihre interessanten Beiträge und allen, die dazu
beigetragen haben, dass es wieder eine neue ISB-Info gibt.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre
Dr. Karin E. Oechslein
Direktorin des ISB München, Mai 2019
Ausgabe 2019 3GRUNDSÄTZLICHES
„Man müsste, man sollte – man kann!“
„MAN MÜSSTE, MAN SOLLTE – MAN KANN!“
DAS PROJEKT „SPRACHE IM FACH“ STELLT SICH VOR
Projektgruppe der KU Eichstätt-Ingolstadt und der LMU München1
Von Sprache, Fach und Bildung – eine Doch was ist unter Bildungssprache zu verstehen? Eine Antwort
darauf zu finden, ist nicht einfach. Ausgehend von soziologi-
noch immer aktuelle Debatte schen, linguistischen und erziehungswissenschaftlichen Perspek-
tiven wurde in den vergangenen Jahren eine Reihe von Konzep-
Die internationalen Schulleistungsstudien, die seit der Jahrtau- tualisierungen und Definitionen von Bildungssprache erarbeitet.
sendwende in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden, Es setzt sich allmählich die Vorstellung durch, dass es sich hierbei
haben auf den Zusammenhang von Sprache, Herkunft und um ein Konstrukt handelt, das sich – eingedenk aller Vereinfa-
Bildung hingewiesen. Dass in Deutschland bis heute maßgeblich chungen – auf folgenden Ebenen näher beschreiben lässt:
soziale Herkunft und sozioökonomische Faktoren über den Er- auf lexikalischer Ebene (Einsatz von Funktionsverbgefügen,
folg im Bildungssystem entscheiden, ist eine weiterhin drängen- eines fach- bzw. inhaltsspezifischen Wortschatzes, von
de Problemstellung von Wissenschaft, Bildungsadministration Fremdwörtern),
und Gesellschaft. auf grammatischer Ebene (Verwendung von Nominalisierun-
gen, komplexer Nominal- und/oder Präpositionalphrasen,
Diesen Herausforderungen wird seit etlichen Jahren mit unter- von Komposita und Ableitungen, unpersönlicher Konstrukti-
schiedlichen Programmen und Forschungsinitiativen der Erzie- onen, von Präfixverben, von Konjunktivformen),
hungswissenschaften und Fachdidaktiken begegnet. Hervor-
auf syntaktischer Ebene (Partizipialkonstruktionen, Relativsät-
zuheben sind die Aktivitäten des an der Hamburger Universität
ze, geschachtelte Nebensätze, eher Satzgefüge als Satzrei-
angesiedelten Projektes FörMig (2004-2009), in dem die För-
hen) (Stahns 2016),
derung von Kindern mit Migrationsgeschichte im Vordergrund
stand. Grundannahme dieses Projektes bildet die Vorstellung, auf Diskursebene im Textaufbau und der Textorganisation
dass sowohl die Entwicklung theoretischer Grundlagen als auch schulspezifischer Textsorten (Beschreiben, Erklären, Verglei-
in der Praxis eine neue Kultur der Sprachbildung in Deutschland chen, Definieren und Argumentieren) (Feilke 2012, Hövel-
notwendig seien; da Sprache das Hauptmedium des Lehrens brinks 2014).
und Lernens darstelle, verdiene sie eine besondere Berücksich-
tigung. Intensiv wurden daher im Projekt über die Besonder- Bildungssprache setzt sich folglich aus unterschiedlichen sprach-
heiten von Bildungssprache nachgedacht sowie das Konzept lichen Registern zusammen, die genau zu unterscheiden sind.
einer durchgängigen Sprachbildung entwickelt: „Durchgängige Erst das Beherrschen in der expliziten Verbindung von Kultur-
Sprachbildung ist ein Konzept, das Kindern dazu verhelfen will, kontext, Unterrichtssituation, Diskurs in der Klassensituation
die Unterschiede zwischen Alltagssprache, dem alltäglichen und den sprachlichen Strukturen der Sprache des Unterrichts
Kommunizieren und dem, was bildungssprachlich verlangt ist, ermöglicht es Schüler(inne)n, am (fach)sprachlichen Diskurs
beherrschen zu lernen.“ (www.foermig.uni-hamburg.de/bil- teilzunehmen.
dungssprache/durchgaengige-sprachbildung.html)
Das Zusammenspiel von Bildungssprache und sprachsensiblem
Die Aktivitäten des Hamburger Projektes, die maßgeblich von Unterricht wurde und wird von Fachdidaktiken und der Bil-
Ingrid Gogolin vorangetrieben worden sind, wirkten inspirie- dungsadministration aufgegriffen. Für den Mathematikunterricht
rend auf weitere Forschungen. Insbesondere wurde der Begriff (Prediger 2013) sowie den Physikunterricht (Leisen 2013; Tajmel
der Bildungssprache „wiederentdeckt“ und weiterentwickelt, 2017) liegen einflussreiche Studien und darauf fußende unter-
wenn sprachliche Anforderungen im Unterricht – in Form richtliche Beispiele vor (Tajmel/Hägi-Mead 2017). Einhellig wird
schulischer Aufgaben und Texte – in den Blick genommen und darauf verwiesen, dass Sprache und Fach zusammenzudenken
von alltagssprachlichen Handlungen abgegrenzt werden (vgl. und die jeweiligen Anforderungen des Faches und damit einher-
Gogolin/Lange 2011, Feilke 2012, Morek/Heller 2012). Da nicht gehende Methoden der Erkenntnisse zu verbinden sind. Auch
selten die diesbezüglichen Kompetenzen von Schüler(inne)n mit im LehrplanPLUS wird das Konzept „Sprachsensibler Unterricht“
Migrationsgeschichte thematisiert wurden, kristallisierte sich in aufgeführt und es werden erste Hinweise zur Umsetzung im
Forschung und Lehre ein Schwerpunkt in der Erfassung bil- Unterricht sowie Hilfestellungen für Lehrkräfte gegeben (www.
dungssprachlicher Kompetenzen auf Schüler(innen)seite ebenso isb.bayern.de/schulartuebergreifendes/schule-und-gesellschaft/
heraus wie die Förderung bildungssprachlicher Kompetenzen im migration-interkulturelle-kompetenz/fluechtlinge/sprachfoerde-
Unterrichtsgeschehen (Stahns 2016). rung/sprachsensiblerunterricht/).
1 as Projektteam setzt sich wie folgt zusammen: Anja Ballis, Johanna Meixner (Projektleitung), Vesna Bjegac, Heribert Mika, Matthias Thiede (ab-
D
geordnete Lehrkräfte bzw. wissenschaftliche Mitarbeiterin), Melanie Heithorst, Marlene Zöhrer (wissenschaftliche Mitarbeiterinnen). Das Projekt
wird in Form von Abordnungen durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus (2016 bis 2019, evtl. bis 2021), durch Mittel der
Virtuellen Hochschule Bayern (vhb) (2016-2017), durch Drittmittel der Initiative Lehre@LMU der LMU München sowie durch Mittel des Zentrums
für Flucht und Migration der KU Eichstätt-Ingolstadt unterstützt.
4 Sprach- und LeseförderungEin Paradigmenwechsel – Der Blick auf dul geleistet werden kann. Vielmehr bedarf es eines stetigen
und nachhaltigen Angebotes, auf das Studierende aller Fächer
(angehende) Lehrkräfte zurückgreifen können und das seine Fortsetzung in weiteren
Phasen der Lehrerbildung findet.
Seit einigen Jahren macht sich ein Paradigmenwechsel bemerk-
bar. Es verschiebt sich das Augenmerk von einer Förderung von
Schüler(inne)n hin zur Ausbildung von Lehrkräften. Zunehmend Schaffen von Lerngelegenheiten –
wird die Forderung laut, dass alle (!) Lehrkräfte über Kompe- Entstehung und Struktur des Projektes
tenzen im Bereich der sprachlichen Bildung verfügen sollten. In
einer vom Mercator-Institut verantworteten Zusammenstellung Damit sind entscheidende Motive für die Entstehung des Pro-
der Situation der universitären Ausbildung von Lehrkräften mit jektes „Sprache im Fach“ an den Universitäten in Eichstätt-In-
dem Fokus Sprache zeigt sich deutschlandweit eine sehr unter- golstadt und München genannt. Eingedenk der curricularen
schiedliche Gemengelage: In einigen Bundesländern existieren Situation der Lehrerausbildung in Bayern, die sprachliche Bildung
verpflichtende Module zur Sprachförderung für alle Lehramtsstu- im Lehramtsstudium additiv auffasst und nicht verpflichtend
dierenden, in anderen Bundesländern – darunter auch Bayern – regelt, ist es erklärtes Ziel des Projektes, vielfältige Lerngelegen-
finden sich keine solchen Vorgaben (Baumann & Becker-Mrotzek heiten in der ersten Phase der Lehrerbildung zu schaffen. Dieses
2014). Angebot ist zwar im Fach Deutsch als Zweitsprache angesiedelt,
kann jedoch auch von Lehramtsstudierenden anderer Fächer
Für welche Qualifikation ist nun die Hochschule zuständig? besucht werden.
Welche sprachlichen Kompetenzen können im Rahmen eines
Hochschulstudiums bei angehenden Lehrkräften angebahnt Das Projekt gliedert sich in folgende, aufeinander bezogene
werden? Bislang liegen diesbezüglich einige Studien vor, die Bausteine (Abb. 1): Ausgangspunkt der Aktivitäten bildete eine
Studierende des Deutschen als Zweitsprache zu ihren Fertigkei- Bestandsaufnahme vor Ort. Welche Fächer bzw. Fachdidaktiken
ten und Fähigkeiten befragen (Köker et al. 2015); einige wenige befassen sich in Eichstätt-Ingolstadt und München mit Fragen
Studien reflektieren Sprachförderung und Sprachbildung im der Sprache? Welche Kooperationen sind möglich? Hilfreich
Zusammenhang mit Professionalisierung (Koch-Priewe 2018). erwies sich in diesem Zusammenhang, dass einige Fachdidak-
Folgt man diesem Pfad der Argumentation, so gelten explizit tiken in medial ausgestatteten Lernräumen, sog. Uni-Klassen,
geschaffene Lerngelegenheiten im Rahmen der Ausbildung als Seminare durchführen und dabei Sprache zum Gegenstand von
zentrale Faktoren für Kompetenzentwicklung (vgl. Kunter et al. Reflexionen wird. Die Expertise vor Ort wird angereichert mit
2011). In einer jüngst erschienenen Studie wird der DaZ-Kompe- Expert(innen)wissen anderer Universitäten, die Erfahrungen im
tenzzuwachs angehender Lehrkräfte erforscht, die in Berlin ein sprachsensiblen Fachunterricht haben.
verpflichtendes DaZ-Modul besucht haben. Die Ergebnisse sind
einigermaßen ernüchternd. Nur für Studierende einer Fremd- Im Anschluss an diese umfassende Bestandsaufnahme und unter
sprache sei ein signifikanter Kompetenzzuwachs feststellbar Berücksichtigung zentraler Studien wurden zwei Online-Se-
(Paetsch et al. 2019). Die Studie belegt damit, dass sprachliche minare entwickelt. Medial wurde diese Form gewählt, um das
Bildung als Aufgabe der Lehrerbildung nicht mit einem DaZ-Mo- Lehrangebot nachhaltig im Kanon der Lehrerbildung, z. T. auch
bayernweit, zu verankern.
Zusätzlich ist intendiert, den
Besuch für Studierende flexi-
bel zu gestalten, die Chance
auf Teilnahme und damit die
Auseinandersetzung mit dem
Thema zu erhöhen.
Zum einen wurde ein Kurs
„Durchgängige Sprachbil-
dung an Schulen in Bayern“
konzipiert. Dieser Kurs wurde
von der Virtuellen Hochschule
in Bayern (vhb) gefördert und
steht allen Lehramtsstudieren-
den in Bayern kostenfrei sowie
Gasthörer(inne)n gegen einen
geringen Unkostenbeitrag
zur Verfügung. Der Kurs wird
jedes Semester angeboten.
Das Lehrangebot berücksich-
tigt neben DaZ-didaktischen
Inhalten auch fachspezifische
Besonderheiten. Am Beispiel
Abb. 1: Projektbausteine „Sprache im Fach“ der Fächer Deutsch als Zweit-
Ausgabe 2019 5GRUNDSÄTZLICHES
„Man müsste, man sollte – man kann!“
sprache, Mathematik, Physik und Geschichte wird illustriert, wie denen Fächern gedreht (Grundschule: Deutsch und Mathematik;
Fragen des Faches und Fragen der Sprache verbunden werden Mittelschule: DaZ, Geschichte; Gymnasium: Biologie, Chemie,
können. Mit Geschichte wird ein Fach gewählt, das exempla- Mathematik; Berufliche Oberschule: Physik, Technik). Diese Vi-
risch für Fächer aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Bereich deos werden in einem Archiv gesammelt, wobei für Aufnahme,
steht. Mit Physik und Mathematik werden Fächer aus dem Archivierung und Tools der Erschließung die Unterrichtsmitschau
eher naturwissenschaftlichen Bereich berücksichtigt. Ziel des der LMU München verantwortlich zeichnet (https://mitschau.
Lehrangebots ist es, Wissen über die in der Schule relevanten edu.lmu.de/). In diesem Archiv befinden sich neben dem Filmma-
sprachlichen Register und didaktisch-methodische Ansätze zur terial Dokumentationen des Unterrichtskontextes sowie Inter-
fachbezogenen Sprachbildung zu vermitteln. Die Teilnehmen- views, die im Anschluss an gefilmte Stunden mit den Lehrkräften
den werden darüber hinaus dazu angeregt, dieses Wissen an geführt worden sind. Die Materialien werden für die Lehre an
(videobasierten) Fallbeispielen zu erproben und einer kritischen den beiden Universitäten aufbereitet und an die jeweiligen Semi-
Reflexion zu unterziehen. narkontexte angepasst. Wie Studierende mit Fremdvideos lernen
und welche sprachlichen Kompetenzen sie dabei erwerben kön-
Erklärtes Ziel des Kurses ist es, Lehramtsstudierende für das nen, wird eine weitere, wichtige Frage für Forschungsarbeiten in
Zusammenspiel von Sprache und Fach zu sensibilisieren. „Lan- Eichstätt-Ingolstadt und München sein.
guage Awareness“, der Schlüsselbegriff im Rahmen des Lehrens
und Lernens von Sprache, rückt so in den Fokus der Aufmerk- Schließlich ist auf die Projektwebseite zu verweisen. Diese dient
samkeit aller Didaktiken. Damit Studierende motiviert werden, einerseits der Bekanntmachung des Projektes sowie der Vernet-
sich dieser Aufgabe stellen, wird ein Storytelling-Ansatz gewählt, zung mit anderen Akteuren (z. B. FörMig, DazKom u. a.). Ande-
bei dem Teilnehmer(innen) des Kurses in unterschiedliche Rollen rerseits werden auf der Webseite wichtige Inhalte aufbereitet:
des schulischen Lebens schlüpfen und dabei gleichzeitig zentrale So wird nicht nur auf die für Studierende entwickelten Seminare
sprachliche und fachliche Inhalte zu verbinden lernen. verwiesen, die zum Teil auch von Lehrkräften genutzt werden
können. Vielmehr werden achtzehn
zentrale Begrifflichkeiten im Kontext
von Sprache und Fach definiert (All-
tagssprache, BICS & CALP, Bildungs-
sprache, durchgängige Sprachbildung,
Konkretisierungsraster, sprachsensibler
Fachunterricht u. a.). Diese Erklärungen
wurden von Expert(inn)en des jewei-
ligen Fachgebietes verfasst und sind
ab Juni 2019 auf der Webseite des
Projektes einsehbar (www.spracheim-
fach.de). Mit dieser „Serviceleistung“
sollen Studierende und interessierte
Lehrkräfte ermuntert werden, sich
niedrigschwellig und zuverlässig zu in-
formieren. Die Arbeit am Begriff ist als
„work in progress“ zu verstehen und
soll kontinuierlich erweitert werden.
Des Weiteren wird in die Webseite ein
Angebot zu mehrsprachiger Kinder-
Abb. 2: Erklärvideo zum Online-Kurs bei der Virtuellen Hochschule Bayern (https://spracheimfach.de/ und Jugendliteratur integriert, das
seminare/vhb/) von einem Team der LMU München
entwickelt worden ist. Das unter der Domain www.lesefenster.
Zum anderen wurde im Rahmen eines LMU-internen Förderpro- de verfügbare Angebot beinhaltet eine umfangreiche Sammlung
jektes ein Kurs entwickelt, der sich an DaZ-Studierende richtet von Buchbesprechungen mehrsprachiger Kinder- und Jugend-
und das Lernen mit Fremdvideos mit Bildungssprache kombi- literatur sowie von Texten, die sich mit den Themen Spracher-
niert. Der Kurs „Bildungssprachliche Praktiken im Unterrichtsge- werb und Integration beschäftigen. Neben der Thematik sind
spräch“ zielt darauf ab, dass Lehramtsstudierende die im Video dabei Ästhetik und/oder Aktualität zentrale Auswahlkriterien für
festgehaltenen Lehr-Lern-Situationen differenziert beschreiben, die Aufnahme in die Datenbank. Zudem werden Texte ausge-
aus der Sicht der verschiedenen Akteure zu deuten und mit wählt, die stellvertretend für ein Genre stehen. Die verfügbaren
Rückbezug auf fachdidaktische Konzepte zu analysieren lernen. Rezensionen stellen die Texte vor und verorten sie im Kontext
Davon ausgehend werden alternative methodisch-didaktische mehrsprachiger Kinder- und Jugendliteratur. Eine Filterfunkti-
Handlungsmöglichkeiten entwickelt (Goeze/Hetfleisch/Schrader on ermöglicht die schnelle und gezielte Suche (Thema, Alter,
2013). Jahrgangsstufe). Des Weiteren werden frei zugängliche mediale
Angebote zu den Büchern zusammengetragen und schließlich
Mit der Entwicklung des zweiten Onlinekurses wurde dem Beispiele für didaktische Möglichkeiten der unterrichtlichen
Projektteam zunehmend das Potenzial von Unterrichtsvideos Umsetzung gegeben.
für die Thematisierung von Sprache und Fach bewusst. Daher
werden nun Videos in verschiedenen Schularten und in verschie-
6 Sprach- und LeseförderungMit der Webseite schließt sich der Kreis. Wie an Abbildung 1 zu 2018 auf die Expertise von Mathematik-, Chemie- und Biolo-
sehen ist, ist das Projekt wieder an seinem Ausgangspunkt und gielehrkräften zurückgreifen. Mit dieser fachlichen Erweiterung
gleichzeitig neuen Startpunkt angelangt: Kontinuierlich gilt es zu geht eine weitere Veränderung im Projekt einher: Zunehmend
prüfen, inwiefern die Lerngelegenheiten an neue Forschungser- wird von Projektmitarbeiter(inne)n der Dialog mit Lehrkräften
gebnisse, an die Fähigkeiten der Studierenden und schulischen gesucht, die sich für Filmaufnahmen bereit erklären. Die von
Bedarfe angepasst werden müssen und welche Anstrengun- den Lehrkräften entwickelten Unterrichtsentwürfe werden be-
gen zu unternehmen sind, um die Reichweite des Projektes zu sprochen, diskutiert, überarbeitet und schließlich im Unterricht
erhöhen. erprobt. Gerade diese Gesprächssituationen erweisen sich als
zentral, wenn verschiedene Fachtraditionen sich dem Zusam-
Das in München und Eichstätt-Ingolstadt initiierte Projekt weist menspiel von Sprache, Inhalt und Unterricht widmen. Zentral für
damit zwei Besonderheiten auf: Zum einen werden sowohl das Projekt ist somit eine Inter- und Transdisziplinarität, die sich
Angebote für Studierende aller Fächer sowie des Faches Deutsch auf verschiedene Fachtraditionen sowie auf verschiedene Phasen
als Zweitsprache entwickelt. Dabei wird immer versucht, ein der Lehrerbildung stützt.
forschungsbasiertes und nachhaltiges Lehrangebot zu erarbei-
ten. Zum anderen werden die Angebote, sofern dies mit dem Es dürfte deutlich geworden sein, dass im Projekt die Rolle
Datenschatz vereinbar ist, digital aufbereitet, um Zugänglichkeit digitaler Lernangebote äußerst positiv aufgefasst wird. Dennoch
und Nachhaltigkeit sicherzustellen und damit auch die Relevanz sind sich die Projektmitarbeiter(innen) sehr wohl bewusst, dass
von Sprache und Fach zu betonen. damit eine Tendenz zum Instruktionslernen gegeben ist: Studie-
rende orientieren sich einseitig an Vorlagen, arbeiten Kriterien
und Checklisten ab, um den Zusammenhang von Sprache und
Fach zu erfassen. Demgegenüber ist an die Studien von Gallin
und Ruf zu erinnern, die von sog. Kernideen ausgehen, um die
eigene Standortgebundenheit sowie daran anschließende Lern-
wege dialogisch zu erfassen (Gallin/Ruf 1998). Letztlich wird es
auf diesen Dialog – mit Kolleg(inn)en und sich selbst, dem Fach
und seinen Traditionen sowie Schüler(inne)n und Vorstellungen
von (sprachlichem) Lernen – ankommen, dem sich die Lernen-
den in allen Phasen der Lehrerbildung zu stellen haben.
Zu guter Letzt – Ein Plädoyer
Während der Entwicklung des Projektes hat sich wiederholt
gezeigt, wie zentral Lehrkräfte für Vermittlungs- und Erschlie-
ßungsprozesse sind und wie wenig die Akteure der Lehrerbil-
dung in der Regel voneinander wissen. Diese Kluft kann durch
eine gemeinsame Bearbeitung sogenannter Querschnittskompe-
tenzen – wie Sprache, Digitalisierung, Projektunterricht – unge-
ahnte Energien und Synergien freisetzen. Dies schließt eine parti-
zipative Beteiligung von Schüler(inne)n an der Gestaltung von
Lehr- und Lernprozessen mit ein. Exemplarisch dafür können die
Bemühungen um Sprache im Fach an der KU Eichstätt-Ingolstadt
und der LMU München für eine vernetzte Lehrerbildung gelten.
An solchen Vernetzungen wird im Projektteam weitergearbei-
tet: Im Zentrum steht die Kunst des Fragens, des Erklärens, des
Deutens und des Veränderns. Es gilt zentrale Herausforderun-
gen, relevante Grundlagen und historische Traditionen gesell-
Abb. 3: Datenbank zu mehrsprachiger Kinder- und Jugendliteratur
schaftlichen Lebens im Verbund von Schule, Universität und
Kultusbürokratie zu explizieren und zu gestalten, die das Leben
„Blinde Flecken“ im Projekt – Was ist zu (angehender) Lehrkräfte und Schüler(innen) prägen.
tun? Eine solche Frage stellt aktuell das Zusammenspiel von Sprache
und Fach dar. Die bislang stark auf Verstehen unterrichtlicher
Im Projektverlauf wird den einzelnen Mitgliedern immer wieder Prozesse abzielende Ausrichtung sollte um die Facetten von
die eigene Standortgebundenheit deutlich. Die Mehrheit der Sprache und politischer Kultur sowie von Sprache und Kunst
Mitarbeiterinnen hat ihre wissenschaftliche Sozialisation im geis- erweitert werden. Sprach- und Fachlernen sind nicht als getrenn-
teswissenschaftlichen Bereich erhalten; damit spiegelt sich ein te Aufgaben des Unterrichts aufzufassen, vielmehr sieht man in
Blick auf Sprache, Denken und Handeln, der stark den Traditio- der Sprache ein Werkzeug des Denkens. Die Reflexion eigener,
nen der Germanistik verpflichtet ist. Gewisse Unzulänglichkeiten fachlicher und öffentlicher Sprachlichkeit ist damit Aufgabe und
und fehlende fachliche Expertise wurden immer dann empfun- Zielhorizont unterrichtlicher Prozesse. An dieser Stelle sollte der
den, wenn Inhalte anderer Fächer sprachlich erschlossen worden Hinweis nicht fehlen, dass viele Philosoph(inn)en über Sprache,
sind. Daher wurde das Team erweitert und kann seit September Denken und Erkenntnis reflektiert haben. Diesen Horizont,
Ausgabe 2019 7GRUNDSÄTZLICHES
„Man müsste, man sollte – man kann!“
wie er sich etwa in den sokratischen Dialogen zeigt, gilt es mit Hövelbrinks, B. (2014), Bildungssprachliche Kompetenz von
zu bedenken, um auch die produktive Dimension der Alltags- einsprachig und mehrsprachig aufwachsenden Kindern. Eine
sprache zu erfassen und nicht einseitig auf Bildungssprache zu vergleichende Studie in naturwissenschaftlicher Lernumgebung
fokussieren: „Alles Denken fängt mit der Alltagssprache an und des ersten Schuljahres, Weinheim: Beltz Juventa.
entfernt sich von ihr.“ (Arendt 2016) Koch-Priewe, B. (2018), Das DaZKom-Projekt – ein Überblick, in:
Ehmke, T., Hammer, S., Köker, A., Ohm, U. & Koch-Priewe, B.
Mit der Verbindung zur Kunst wird eine Erweiterung von (Hrsg.), Professionelle Kompetenzen angehender Lehrkräfte im
Perspektiven sowie ein Experimentieren in Möglichkeitsräumen Bereich Deutsch als Zweitsprache, Münster: Waxmann, 7–38.
erstrebt. Was ist, wenn sich Sprache dem Gegenstand entzieht? Kunter, M., Kleickmann, T., Klusmann, U., & Richter, D. (2011), Die
Was ist, wenn Unverständlichkeit als bewusstes Mittel der Kom- Entwicklung professioneller Kompetenz von Lehrkräften. In
munikation eingesetzt wird? Warum das Fach bzw. seine Gegen- Kunter, M., Baumert, J., Blum, W., Klusmann, U., Krauss, S. &
stände nicht mit den Augen der Kunst sehen (vgl. Baptist 2011)? Neubrand, M. (Hrsg.), Professionelle Kompetenz von Lehrkräf-
Es scheint lohnenswert, im Kontext von Sprache und Fach ein ten. Ergebnisse des Forschungsprogramms COACTIV, Münster:
dialektisches Zusammenspiel von Verstehen und Nicht-Verstehen Waxmann, 55–68.
zu reflektieren. Leisen, J. (2013), Handbuch Sprachförderung im Fach – Sprachsen-
sibler Fachunterricht in der Praxis, Stuttgart: Klett.
Wir wünschen uns, solchen Fragen und Themenfeldern in einer Morek, M. & Heller, V. (2012), Bildungssprache – Kommunikative,
Zukunftswerkstatt nachzugehen. Dort könnte der Ort sein, sich epistemische, soziale und interaktive Aspekte ihres Gebrauchs,
über Ziele und Visionen der Lehrerbildung zu verständigen, in: Zeitschrift für angewandte Linguistik (2012), 67–101, DOI
sich zentrale Themen und Herausforderungen von Unterricht 10.1515/zfal-2012-0011.
bewusst zu machen sowie auf gesellschaftliche Prozesse Einfluss Ohm, U. (2018), Das Modell von DaZ-Kompetenz bei angehenden
zu nehmen. Jeder Mensch sollte unabhängig von (sprachlicher) Lehrkräften, in: Ehmke, T., Hammer, S, Köker, A. Ohm, U. &
Herkunft, Aussehen und Geschlecht Chancen für eine Entfal- Koch-Priewe, B. (Hrsg.), Professionelle Kompetenzen angehen-
tung seiner Anlagen erhalten sowie bei der Ausprägung von der Lehrkräfte im Bereich Deutsch als Zweitsprache, Münster:
Fertigkeiten und Kompetenzen Unterstützung erfahren. Man Waxmann, 73–92.
kann die Welt verändern – und Sprache liefert die dafür nötigen Paetsch, J., Darsow, A., Wagner, F. S., Hammer, S. & Ehmke, T.
Mittel! (2019), Prädiktoren des Kompetenzzuwachses im Bereich
Deutsch als Zweitsprache bei Lehramtsstudierenden, in: Unter-
richtswissenschaft (2019) 47, 51–77, https://doi.org/10.1007/
Literatur s42010-019-00038-7.
Prediger, S. (2013), Sprachmittel für mathematische Verstehenspro-
Arendt, H. (2016), Denktagebuch 1950 bis 1973, hrsg. Ludz, U. & zesse – Einblicke in Probleme, Vorgehensweisen und Ergebnis-
Nordmann, I., München: Piper. se von Entwicklungsforschungsstudien, in: Pallack, A. (Hrsg.),
Ballis, A., Meixner, J. & Zierau, C. (2017), Sprache im Fach, in: DaZ Impulse für eine zeitgemäße Mathematiklehrer-Ausbildung.
1, 5–7. MNU-Dokumentation der 16. Fachleitertagung Mathematik,
Baptist, P. (2011), On Going for a Walk with an Artist and a Fa- Neuss: Seeberger, 26–36.
mous Mathematician Bayreuth, Bayreuth: Centre for Mathe- Stahns, R. (2016), Bildungssprachliche Merkmale von Texten und
matics and Science Education. Items. Zur Operationalisierung des Konstrukts „Bildungsspra-
Becker-Mrotzek, M. & Baumann, B. (2014), Sprachförderung und che“, in: Didaktik Deutsch 41, 44-53.
Deutsch als Zweitsprache an deutschen Schulen: Was leistet Tajmel, T. & Hägi-Mead, S. (2017), Sprachbewusste Unterrichtspla-
die Lehrerbildung?, Köln: Mercator-Institut, verfügbar unter nung – Prinzipien, Methoden und Beispiele für die Umsetzung,
file:///C:/Users/LokalAdmin/Documents/isb_artikel/baumann_ Reihe FörMig Material. Bd. 9, Münster: Waxmann.
becker_mrotzek_2014.pdf [10.03.2019]. Tajmel, T. (2017), Naturwissenschaftliche Bildung in der Migrations-
Becker-Mrotzek, M., Schramm, K., Thürmann, E. & Vollmer, H. J. gesellschaft. Grundzüge einer Reflexiven Didaktik und Ansätze
(Hrsg.) (2013), Sprache im Fach: Sprachlichkeit und fachliches für eine sprachbewusste Praxis, Wiesbaden: Springer.
Lernen, Waxmann Verlag.
Bjegac, V. (2017), „Tu ich so, als ob ich verstanden habe.“ Sprach-
sensibler Sozialkunde-Unterricht, in: DaZ 1, 22–28. Links
Feilke, H. (2012), Bildungssprachliche Kompetenzen – fördern und
entwickeln, in: Praxis Deutsch 233, 4–13. https://dzlm.de/files/modulhandbuch/files/SUF-Mathematik-Modul-
Gallin, P. & Ruf, U. (1998), Sprache und Mathematik in der Schule. katalog.pdf [10.03.2019].
Auf eigenen Wegen zur Fachkompetenz, Seelze: Kallmeyer. https://mitschau.edu.lmu.de/ [10.03.2019].
Goeze, A., Hetfleisch, P. & Schrader, J. (2013), Wirkungen des
www.foermig.uni-hamburg.de/bildungssprache/durchgaengi-
Lernens mit Videofällen bei Lehrkräften. Welche Rolle spielen
ge-sprachbildung.html [10.03.2019].
instruktionale Unterstützung, Personen- und Prozessmerkma-
le?, in: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 16, 79–113. www.isb.bayern.de/schulartuebergreifendes/schule-und-gesell-
Gogolin, I., & Lange, I. (2011), Bildungssprache und durchgängige schaft/migration-interkulturelle-kompetenz/fluechtlinge/sprach-
Sprachbildung, in: Fürstenau, S. & Gomolla, M. (Hrsg.), Migra- foerderung/sprachsensiblerunterricht/ [10.03.2019].
tion und schulischer Wandel: Mehrsprachigkeit, Wiesbaden: VS www.lesefenster.de [10.03.2019].
Verlag für Sozialwissenschaften, 107–127. www.spracheimfach.de [10.03.2019].
8 Sprach- und LeseförderungAUS UNSERER WERKSTATT
Sprachbildung am Beispiel des Wortspeichers
SPRACHBILDUNG AM BEISPIEL DES WORTSPEICHERS
SPRACHBEWUSSTHEIT BEI DER NUTZUNG VON ALLTAGS-, FACH- UND BILDUNGS-
SPRACHE IN DER GRUNDSCHULE
Sybille Maiwald, Abt. Grund-, Mittel- u. Förderschulen und Schule für Kranke
Sprachbildung ist Aufgabe aller Fächer und Schularten. weiterer Kinder mit der Erstsprache Deutsch nicht genauer for-
Eine effiziente Förderung der Sprachkompetenz bietet ein mulieren. Lediglich das Wort „bitte“ wurde von den Kindern an
strukturiertes Konzept für die bildungssprachlichen Her- verschiedene Stellen des unvollständigen Satzes gesetzt, um ihn
ausforderungen an und nimmt die Sprachkompetenz der verständlicher zu machen.
Schülerinnen und Schüler als Ausgangspunkt für die unter-
richtliche Planung. Die Arbeit mit einem Wortspeicher, der Abweichungen von der Standardsprache beim Sprechen lassen
die sprachliche Grundlage für jede Unterrichtseinheit sein sich zunehmend feststellen. Den oben angeführten Satz könnte
kann, ist eine Möglichkeit für die systematische Förderung man in das „Kiezdeutsch“ einordnen, eine Sprache, die als Varietät
des sprachbewussten und aktiven Sprachhandelns. Im des Deutschen oder als informelle, alltagssprachliche Form der
Folgenden werden die Idee und die unterrichtlichen sowie deutschen Sprache geführt wird. Diese umgangssprachliche Form
pädagogischen Möglichkeiten des Wortspeichers skizziert. des Deutschen wird von Kindern mit und ohne Migrationshinter-
grund verwendet. Nicht immer ist den Kindern beim Sprechen
Die zunehmende sprachliche Heterogenität und Mehr- bzw. klar, was die Standardsprache wäre bzw. wie sie ihre Aussagen all-
Vielsprachigkeit im Klassenzimmer stellt die Sprachbildung vor tagssprachlich verständlich formulieren können. Ein zunehmender
veränderte Aufgaben. Grundsätzlich müssen sich Lehrkräfte mit Anteil an Schülerinnen und Schülern deutscher wie nicht-deutscher
der Frage beschäftigen, über welche Sprachkompetenz Kinder und Erstsprache bringt auch die für schulische Bildungsprozesse voraus-
Jugendliche verfügen müssen, um eine den heutigen Anforde- gesetzten Sprachkompetenzen nicht mehr mit. Eine effiziente
rungen entsprechende Sprachhandlungskompetenz aufbauen sprachliche Förderung, die hier notwendig ist, baut auf verschiede-
zu können. Bekannt ist, dass die systematische Förderung der nen Prinzipien auf:
Sprach- und Kommunikationskompetenz ein wesentlicher Faktor 1. Anregen von Sprachhandlungen
für den Bildungserfolg sowie für die Teilhabe am gesellschaftlichen 2. Sprachbewusstes Lernen: Sensibilisierung für Sprache
Leben ist. Sie sollte Aufgabe aller Bildungsbemühungen in allen 3. Systematische Wortschatzarbeit: Systematischer Aufbau eines
Schularten sein. Eine durchgängige, fach- und sachgerechte sowie wohl überlegt zusammengestellten Wortspeichers
kontextbezogene Versprachlichung der Bildungsinhalte und der
Diese Prinzipien möchte die folgende Zusammenstellung ausführen.
zu erwerbenden Kompetenzen im Rahmen der Lerngespräche im
Unterricht bei Einbeziehung aller Lernpartnerinnen und Lernpart-
ner kann nur gelingen, wenn die heterogene Lerngemeinschaft Unterstützendes Sprachgerüst für aktives
eine Vereinbarung über einen gemeinsamen Wortspeicher trifft,
dessen Bedeutung und Verwendung geklärt ist und der für alle
Sprachhandeln
transparent ist.
Mit dem Wortspeicher wird einer Klasse ein „Schlüsselvokabular“2
aus den Bereichen Alltags-, Fach- und Bildungssprache angeboten.
Der Wortspeicher ist das Vokabular, das die Lehrkraft für jede Ergänzt wird das Sprachangebot durch geeignete Strukturen. Die-
Unterrichtseinheit bzw. für jeden Kontext gezielt zusammen- se Rede- bzw. Sprachmittel stehen allen Kindern in heterogenen
stellt (s. Abb. 1 und Abb. 2). Dieses Wortschatzangebot sollen Lerngruppen zur Verfügung, tragen zu einer konstruktiven dialo-
die Kinder aktiv nutzen und produktiv darüber verfügen. gischen Kultur in der Lern-, Gesprächs- und Arbeitsgemeinschaft
Es handelt sich um Wörter der Alltags-, Fach- und Bildungs- aus Kindern und Lehrkräften bei und bieten eine gemeinsame
sprache sowie um Strukturen, die dazu dienen, sich über den sprachliche Grundlage.
Kontext dialogisch auszutauschen und über den Kompetenz-
zuwachs zu reflektieren. Das Sprachhandeln der Schülerinnen und Schüler und das Be-
dürfnis der Kinder, sich mitzuteilen, kann durch eine eindeutige
sprachliche Ausgangsbasis gewährleistet werden. Den Wortspei-
„Kann ich Schere?“ – Was passiert mit der cher in der Alltags-, Fach- und Bildungssprache können die Kinder
Alltagssprache?1 nachhaltig für Lerngespräche nutzen. Die Versprachlichung trägt
zur Denkentwicklung und zur Entfaltung des Lernprozesses bei.
Die Frage „Kann ich Schere?“ stammt von einem Kind ohne
Migrationshintergrund. Sie ließ sich auch durch Unterstützung
1 Im Folgenden ist nur von „Kindern“ im Grundschulbereich die Rede, die Überlegungen sind aber auch auf andere Schularten anwendbar.
2 SIOP Planungsraster (WEGE- Konzept); s. Grundschule aktuell, Heft 137
Ausgabe 2019 9AUS UNSERER WERKSTATT
Sprachbildung am Beispiel des Wortspeichers
(…) So erweitern Schülerinnen und Schüler zunehmend ihre Orientierung des Wortspeichers an den
eigenen sprachlichen Verständnis- und Ausdrucksmöglichkei- Inhalten und kommunikativen Anfor-
ten in Bezug auf Wortschatz, Wortwahl und sprachliche Struk-
turen. Sie unterscheiden anhand konkreter Beispiele zwischen derungen des Unterrichts sowie an der
Alltags-, Bildungs- und Fachsprache (…)
(LehrplanPLUS, Fachprofil Deutsch GS)
Lernausgangslage der Kinder
Die für den Unterricht und das Schulleben benötigten sprachlichen
Der Wortspeicher stellt also ein grundlegendes und unterstützen- Mittel sind grundsätzlich an den Unterrichtsthemen und -inhalten
des Sprachgerüst für aktives Sprachhandeln dar. orientiert und im Besonderen am Lern- bzw. Sprachstand der Kin-
der. Es stellt sich die Frage: Welche Begriffe, welche Redewendun-
gen und welcher Satzbau sind den Kindern geläufig und welche
Gestaltung eines sprachbewussten sprachlichen Vorkenntnisse zum jeweiligen Sachthema liegen vor?
Unterrichts – geplanter und systematischer
Die Lernausgangslage lässt sich über informelle Verfahren erfassen.
Aufbau des Wortspeichers Dazu gehört die kontinuierliche Beobachtung im Rahmen der Un-
terrichtsgespräche. Auch schriftlich ist eine Standortbestimmung
Die Lehrkraft nimmt eine zentrale Rolle bei der Gestaltung eines
über den individuellen Lern- und Sprachstand der Kinder denkbar,
sprachbewussten Unterrichts und der Integration des sprachlichen
beispielsweise mit Hilfe eines Weißblatt-Tests (Beispiel-Frage in
Inputs in Kontexte und Sprachhandlungssituationen ein. Zu einer
HSU, Jg. 3/4: Was weißt du über Verbrennung?). Auf der Basis der
zeitgemäßen Unterrichtsvorbereitung gehört u. a. vor allem die
Sprachstandserfassung entwickelt die Lehrkraft einen klassenbezo-
Planung der sprachlichen Mittel. Die Zusammenstellung des Wort-
genen (und hin und wieder auch einen individuellen) Wortspeicher,
speichers für unterrichtliche Spracharrangements, die bewusstes
der sukzessive mit den Kindern bearbeitet wird. Die Förderung der
sprachliches Lernen im fachlichen Kontext möglich machen, dient
Kommunikation durch den Wortspeicher ist möglich, wenn die
als strukturierte Vorbereitung für eine systematische Sprachvermitt-
Redemittel im Rahmen des dialogischen Austausches (mündlich
lung.
und schriftlich) im Klassenzimmer zunächst verstanden und geklärt,
Die Lehrkraft ist mit ihrem Sprachverhalten und ihren Um- dann gefestigt und schließlich produktiv angewendet werden.
gangsformen zentrales Sprach- und Handlungsvorbild.
Der bewusste Erwerb und die Erweiterung von kommuni- Die sprachlichen Anforderungen des Unterrichtsgegenstands selbst
kativen Kompetenzen, die auch eine reflektierte Auseinan- leiten die Lehrkraft bei der Planung des Wortspeichers (s. Abb. 1:
dersetzung mit Sprache meinen, können von der Lehrkraft Zahlenmauern). Welche Redemittel wie Begriffe, Fachtermini
nachhaltig beeinflusst werden. und Satzbausteine brauchen die Kinder, um mit dem Lernge-
Im Rahmen ihrer Unterrichtsvorbereitungen plant die genstand sprachlich umzugehen? Bei der Zusammenstellung des
Lehrkraft systematisch den benötigten Wortspeicher auf Wortspeichers können die Schülerinnen und Schüler zunehmend
Wort- und Satzebene. Eine gezielte Sprachförderung, eine einbezogen werden, da sich ihre Sprachbewusstheit durch die
systematische Sprachvermittlung und der Aufbau von kontinuierliche und systematische Sprachförderung erhöht und sie
Sprachbewusstheit kann damit erreicht werden. Für den sachgerechte, den Lernprozess unterstützende Redemittel selbst
Unterricht können themenbezogen sprachliche Kompetenz- erkennen können.
erwartungen festgelegt werden.
Die sprachliche Unterrichtsplanung berücksichtigt auch die
Bedürfnisse und sprachlichen Vorerfahrungen mehr-
Unterstützung des Lernprozesses und
sprachig aufgewachsener Kinder. Der Lehrkraft sind die Schaffung einer bildungssprachlichen
Stolperstellen der deutschen Sprache bewusst, wie z. B. die
Artikelbildung, die Verwendung von Vor- und Nachsilben, Handlungskompetenz in allen Fächern
die Komposita, etc. durch Verwendung präziser Begrifflichkeiten
Der Wortspeicher wird wohl überlegt und gezielt aus-
gewählt. Idealerweise sind alle aktuell benötigten Rede- Der Wortspeicher wird durchgängig in wechselnden Arbeits- und
mittel auf Wortkarten (bzw. Wortstreifen, Sprechblasen) im Gesprächsformen genutzt und in verschiedenen Lernsituationen
Klassenzimmer sichtbar. umgewälzt. Damit die Kinder präzise im Ausdruck sein können
Wiederkehrende Satz- und Fragemuster (Aufrufmuster, z. B. und alle Lernpartner eine gemeinsame sprachliche Ausgangsebene
„Was meinst du dazu?“, sachgerechte und konstruktive Re- haben, ist es wichtig, eine bewusste Phase der Wahrnehmung und
flexionsmuster, z. B.: „Ich möchte mir heute besonders das des Verstehens der Redemittel zu schaffen. Erst wenn (weitge-
Wort … merken, weil…“) stehen auf Plakaten und Seiten- hend) alle Kinder den angebotenen Wortschatz verstanden haben,
wänden zur Verfügung. ist eine produktive Nutzung im Rahmen des kommunikativen
Zur Verankerung des Wortspeichers ist es wesentlich, dass Austausches möglich. Die Redemittel werden aktiv angewendet
ihn die Lehrkraft selbst wertschätzt, durchgängig anwen- und geübt.
det und verlässlich nutzt. Eine bewusste Gestaltung und
Nutzung der Lehrersprache im Sinne einer sprachsensiblen Angestrebt wird dabei ein sprachbewusster Unterricht in allen Fä-
Unterrichtsgesprächsführung ist ein weiterer Garant für eine chern. Das Nachdenken über Sprache und die bewusste Nutzung
gelingende Sprachförderung. von Redemitteln findet durchgängig im Unterricht statt.
10 Sprach- und LeseförderungUnterstützung des Kompetenzerwerbs Die farbige Strukturierung und Hervorhebung der Wortarten, des
Genus und des silbischen Prinzips unterstützen die Lernenden
durch strukturierte Darstellung des Wort- implizit und bieten die Grundlage für den Aufbau von Sprachbe-
Grundschul-Newsletter
Lehrplan PLUS
speichers wusstheit. Die Weiterentwicklung des grammatikalischen Wissens
Nr. 3/2018 werden unterstützt.
und der Rechtschreibkompetenz
Der Wortspeicher ist den Schülerinnen und Schülern durch Vi-
sualisierung (Wortkarten, Plakate) präsent und steht ihnen für die (…) Sprachliche Bildung ist ein durchgängiges Unterrichtsprin-
Dauer des Verstehens- und Erwerbsprozesses im Klassenzimmer zip im schulischen Alltag und betrifft alle Fächer.
zur Verfügung. (…) Wörter, Begriffe und Satzbau der Alltagssprache sowie
der Fachsprache
• Erst wenn weitestgehend alle Schülerinnen und Schüler den Wortschatz verstanden werden
haben, ist eine in allen Fächern reflektiert, systemati-
produktive
Unterrichtsbeispiel
Anwendung im Rahmen Mathematik: Aufgabenformat
des kommunikativen Austausches möglich. siert und praktiziert.
Zahlenmauern (LehrplanPLUS, Bildungs- und Erziehungsauftrag 1.3)
Sprachliche Vereinbarungen
Unterrichtsbeispiel, zu Zahlenmauern
Mathematik, gute Aufgaben:treffen
Zahlenmauern
Die mit dem Wortspeicher der
Unser Wortspeicher hilft dir beim Beschreiben und Erklären:
jeweiligen Unterrichtseinheit
die Zielzahl (im Schlussstein bzw. im Deckstein) angebotenen Redemittel
der Mittelstein
können von den Lernenden in
der Eckstein
die 1., 2., 3. Reihe einen Wortspeicher-Karteikas-
die Grundreihe ten eingeordnet werden. Auch
die Summe/addieren das Führen eines (individuellen)
Redemittel: Wortspeicherheftes wäre denk-
Wenn ich die Zahlen (um …) in der ... Reihe verändere, dann … bar. Wichtig ist ein flexibler,
Abb. 1: Wortspeicher Mathematik: Zahlenmauern produktiver und vielschichtiger
Unterrichtsbeispiele aus weiteren Fächern: Umgang mit dem aktuellen
Die Nutzung von Strukturierungshilfen und Visualisierungsstützen Wortspeicher, um allen Kindern in heterogenen Lerngruppen
Fach/Jgst. Unterrichtsthema Beispiel Wortspeicher sprachliche Könnenserfahrungen und die aktive Teilhabe an Lern-
ermöglicht allen Kindern der häufig sprachlich sehr heterogenen
Lerngruppen
Sport; einen strukturierten
Wir trainieren das Zugang zum Wortspeicher:
Alltagssprache: prozessen
der Fuß, dehnen, lockern, zudie
trainieren, ermöglichen.
Innenseite
Jgst. 3/4 zielgenaue Passen
die Verwendung von Wortartenfarben Bildungssprache: zielgenau, die Nicht
Station, das nur der aktuelle, sondern auch der bereits erarbeitete Wort-
Stationentraining
mit dem Innenrist Fachsprache: der Innenrist, der Spann, passen*
speicher muss im Unterrichtsgespräch immer wieder Anwendung
(s. u. Abb. 2: rot: Verb, blau: Nomen, grün: Adjektiv)
(Fußball) Redemittel (zur Reflexion): Beim Trainieren mit meiner
finden Partnerin/meinem
und sprachlich umgewälzt werden.
die Silbenschreibweise Partner hat mir geholfen, dass …
Auf diese Weise kann der Wortspeicher ein wesentlicher Beitrag zu
die Nomen
Musik;
mit Artikel im Nominativ
Was geschieht in Alltagssprache: die Halle, laut, leise, dunkel,
einerhell, tief, hoch
effektiven und systematischen Sprachförderung sein.
Jgst.(evtl.
3/4 im Singular
der Halleund im Plural)
des Berg- Fachsprache: die Besetzung, die Lautstärke, das Tempo*, der Sprechvers,
eine farbige Kennzeichnung
königs? – Wir lesen der Artikeldie
das Stück, nach Genus
Suite, der Komponist, das Werk*
Die systematische Auseinandersetzung mit sprachlichen Mit-
(blau: der;die Geschichte
grün: unddie)Bildungssprache: die Lesestrategie
das; rot:
hören die Musik teln durch das kontinuierliche Angebot eines wohl überlegten
Redemittel: Beim Hören des Stücks ist mir aufgefallen, dass …
Wortspeichers im Zusammenhang mit spezifischen Themen und
* Zu diesen Wörtern könnte mit den Kindern ein Gespräch über die Wortbedeutung in verschiedenen Kontexten geführt werden.
Unterrichtsbeispiele aus weiteren Fächern: Kontexten könnte auch in den weiterführenden Schulen eine
Möglichkeit sein, Sprachsen-
4.Fach/Jgst.
Der Wortspeicher ist im Klassenzimmer
Unterrichtsthema präsent und strukturiert gestaltet
Beispiel Wortspeicher sibilität und Sprachhandeln
• Der Wortspeicher
Sport; ist dendas
Wir trainieren Kindern durch Visualisierung
Alltagssprache: präsent
der Fuß, und lockern,
dehnen, steht ihnen für die Dauer
trainieren, des Verstehens-
die Innenseite zu unterstützen. Hier könnte
und Erwerbsprozesses
Jgst. 3/4 zielgenaue Passenim Klassenzimmer zur Verfügung.
Bildungssprache: zielgenau, die Station, das Stationentraining die Zusammenstellung des
mit dem Sprachmittel
• Aktuell benötigte Innenrist Fachsprache:
können der Innenrist,
beispielsweise der Spann,
auf Wortkarten passen*
(Wortstreifen, Sprechblasen) visualisiert Wortspeichers in Kooperation
(Fußball)
werden. Wiederkehrende Satz- Redemittel (zur Reflexion):
und Fragemuster Beimbspw.:
(Aufrufmuster, Trainieren
Wasmit meiner
meinst du Partnerin/meinem
dazu?; sachgerechte mit den Lernenden geschehen
und konstruktive Reflexionsmuster, Partner hatIch
bspw.: mirmöchte
geholfen,
mir dass
heute…besonders das Wort … merken, weil …) ste- oder zunehmend in die Hand
Musik;hen auf Plakaten und Seitenwänden
Was geschieht in zur Verfügung.
Alltagssprache: die Halle, laut, leise, dunkel, hell, tief, hoch der Jugendlichen gegeben
Jgst.
• 3/4 der Halle
Die Nutzung des Berg- Fachsprache:
von Strukturierungshilfen die Besetzung, die Lautstärke,
und Visualisierungsstützen das Tempo*,
(z. B. die farbige der Sprechvers,
Kennzeichnung von Wort- werden. Ein selbstbestimmtes,
arten oderkönigs? – Wir lesen dasvon
die Silbenschreibweise Stück, die Suite,
Wörtern) der Komponist,
ermöglicht das einen
allen Kindern Werk*Zugang zum Wortspeicher.
die Geschichte und Bildungssprache: die Lesestrategie aktives und sprachbewusstes
• Die Wörter können von den Kindern in eine Wortspeicher-Schatztruhe eingeordnet werden. Auch das Führen
hören die Musik Redemittel: Beim Hören des Stücks ist mir aufgefallen, dass … Sprachhandeln könnte dadurch
eines (individuellen) Wortspeicherheftes ist denkbar.
* Anmerkung: Zu diesen Wörtern könnte mit den Kindern ein Gespräch über die Wortbedeutung in verschie- nachhaltig aufgebaut werden.
• Ein produktiver und vielschichtiger Umgang mit dem aktuellen Wortspeicher ist zwingend, um allen Kindern
denen Kontexten
sprachliche geführt werden. zu ermöglichen.
Könnenserfahrungen
• 2:
Abb. ImBeispiele
Sinne eines
für nachhaltigen Kompetenzerwerbs
den Wortspeicher findet der bereits
in Unterrichtsvorbereitungen erarbeitete
aus Sport undWortspeicher
Musik im Unterricht im-
mer wieder Anwendung.
Quellen und Literaturhinweise: Sybille Maiwald
• Grundschule aktuell: Sprachbildung – Bildungssprache. Heft 128, Nov. 2014
• Grundschule aktuell: Sprache Bildung Sprachbildung. Heft 137, Feb. 2017 Deutsch als Zweitsprache
• https://pikas.dzlm.de/herzlich-willkommen (Mathematik) an der Grundschule
2
Ausgabe 2019 11AUS UNSERER WERKSTATT
„Berufssprache Deutsch“
„BERUFSSPRACHE DEUTSCH“
VON DER BERUFSINTEGRATION UND -VORBEREITUNG ZUM ERFOLGREICHEN
BERUFSSCHULABSCHLUSS
Martina Hoffmann, Abt. Berufliche Schulen
begegnen, erhöhen die Relevanz und folglich die Motivation,
die Aufgabe zu lösen. Die Schülerin oder der Schüler wird in
der Lernsituation direkt angesprochen und agiert in ihrer oder
seiner eigenen Rolle als Auszubildende oder Auszubildender. Das
Stellvertreterprinzip, z. B. verwirklicht in Aufforderungen wie „Sie
sind der Meister. Lösen Sie das Problem.“, ist zu vermeiden, da es
Im Rahmen der Implementierung des seit dem Schuljahr sich hierbei um keine realistische Aufgabe für Lehrlinge handelt.
2016/17 sukzessiv gültigen neuen Deutschlehrplans für Nur authentische Sprecher/-innen und Adressaten/-innen agieren
die Berufsschulen und Berufsfachschulen in Bayern wurde und kommunizieren in den Lernsituationen. Auf diese Weise ist
„Berufssprache Deutsch“ zum Unterrichtsprinzip erklärt. ein Berufs- und/oder Lebensweltbezug gegeben.
„Berufssprache Deutsch“ heißt, dass die Schülerinnen und
Schüler in der Entwicklung ihrer berufssprachlich-kommu-
nikativen Kompetenzen zielorientiert im fachlichen sowie
Handlungsorientierte Lernszenarien
allgemeinbildenden Unterricht gefördert werden, damit
Nachdem eine produktorientierte und problembasierte Lernsi-
die Integration in das Berufsleben erfolgreich gelingt.
tuation skizziert wurde, erfolgt eine Didaktisierung nach den
Prinzipien der Szenariendidaktik (vgl. Roche & Terrasi-Haufe
Um den Anforderungen des Unterrichtsprinzips gerecht zu wer-
2017: 78). Die einzelnen Phasen des Unterrichts werden mit
den, ist eine integrierte Lernzielbestimmung unabdingbar. Hierzu
authentischen Materialien, Medien, sprachsensiblen Methoden
werden sowohl die curricularen Grundlagen für die Ausbildungs-
zur Förderung der Lese-, Schreib-, Hör- und Sprechkompetenz,
richtung als auch der neue Deutschlehrplan für die Berufsschule
effizienten Strategien und Arbeitstechniken gefüllt. Dabei gibt
und Berufsfachschule in Bayern berücksichtigt. Die Verknüpfung
das Modell der vollständigen Handlung den progressiven Verlauf
von Fach- und Sprachkompetenz ist neben der handlungsorien-
vor. Zunächst orientieren und informieren sich die Schülerinnen
tierten und sprachbewussten Unterrichtgestaltung ein wichtiger
und Schüler, bevor sie planen, durchführen bzw. präsentieren.
Baustein des Unterrichtsprinzips „Berufssprache Deutsch“, das
Im Rahmen eines modernen, kompetenzorientierten Unterrichts
in der Berufsintegration und -vorbereitung beginnt und die
sind die Unterrichtselemente Bewerten und Reflexion unabding-
Schülerinnen und Schüler bis zum erfolgreichen Berufsschulab-
bar. Sie sind auch natürliche Phasen betrieblicher Abläufe und
schluss begleitet.
schließen die Lerneinheit ab.
Verknüpfung von Fach- und Sprachkom- Sprachbewusste Unterrichtsgestaltung
petenz
Neben der Verknüpfung von sprachlichen und fachlichen
Ausgangspunkt integrativer und handlungsorientierter Un- Inhalten in einem handlungsorientierten Lernszenario ist die
terrichtsmaterialien ist eine plausible, konkrete und relevante sprachbewusste Unterrichtsgestaltung ein wesentliches Element
Lernsituation (vgl. Roche & Terrasi-Haufe 2017). Plausibel soll des Unterrichtsprinzips „Berufssprache Deutsch“. Jede Unter-
diese einerseits bezüglich des (Fach-)Wortschatzes sein, ande- richtsphase wird hinsichtlich der sprachlichen Anforderung und
rerseits hinsichtlich des zu erstellenden Handlungsprodukts. Das dem Sprachniveau der Schülerinnen und Schüler didaktisch-me-
Produkt ist beispielsweise ein Gespräch zwischen zwei fachlich thodisch angepasst und folglich ein Förderschwerpunkt festge-
ebenbürtigen Partnern oder ein für die Experten-Laien-Kommu- legt. Hilfestellungen werden differenziert und niveauspezifisch
nikation typisches Gespräch. Auch Telefongespräche, schriftliche angeboten. Besonders die Prinzipien der Binnendifferenzierung,
Bestellungen, Erstellen von Checklisten, Lesen von Anleitungen z. B. hinsichtlich der Aufgabenstellung, der Art des Lernprodukts
und Protokollen, E-Mail-Korrespondenz oder Gespräche mit den oder des Lerntempos, und der Ansatz des kooperativen Lernens
unterschiedlichen Akteuren im beruflichen Alltag können mög- ermöglichen eine gezielte Förderung der Schülerinnen und Schü-
liche authentische Handlungsprodukte sein. Bereits an diesen ler. Diesen didaktisch-methodischen Instrumenten ist gemein,
Beispielen wird deutlich, dass die sprachlich-kommunikativen dass sie die Heterogenität als Potenzial nutzen. Mit Hilfe von
Herausforderungen in den unterschiedlichen Ausbildungsberufen Methoden, Strategien und Arbeitstechniken aus dem Bereich
mannigfaltig sind. Die formulierte Handlungssituation erfordert Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache werden die heterogenen
sprachliches Handeln und Lernen, wodurch die Schülerinnen und Lernausgangsvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler
Schüler erkennen, dass Sprache notwendig ist. Die Förderung stärker berücksichtigt und folglich ist eine individuelle Förderung
der Lese-, Schreib-, Hör- und Sprechkompetenz ist immer mit leichter möglich. Dies geschieht bespielweise durch Portfolioar-
einer beruflichen Handlungsnotwendigkeit verbunden. Konkrete beit, strukturierte Lese- und Schreibfahrpläne, textoptimierte
Herausforderungen, die den Auszubildenden im Berufsalltag (Fach-)Texte und die Methode Scaffolding. Die sprachliche
12 Sprach- und LeseförderungSie können auch lesen