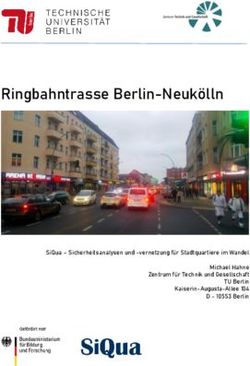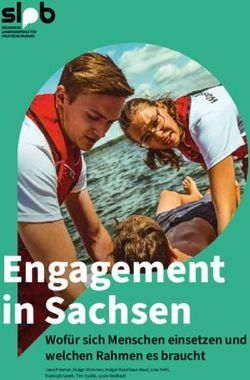WELTRISIKOBERICHT 2019 - FOKUS: WASSERVERSORGUNG - WELTHUNGERHILFE
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Impressum Herausgeber WeltRisikoBericht 2019 Bündnis Entwicklung Hilft und Ruhr-Universität Bochum – Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht (IFHV) Konzeption, Realisierung und Redaktion Peter Mucke, Bündnis Entwicklung Hilft, Projektleitung Lotte Kirch, Bündnis Entwicklung Hilft, Redaktionsleitung Julia Walter, MediaCompany Wissenschaftliche Leitung Dr. Katrin Radtke, IFHV Autor*innen St John Day, Externer WASH-Berater Timothy Forster, Oxfam Jutta Himmelsbach, Misereor Lisa Korte, Oxfam Peter Mucke, Bündnis Entwicklung Hilft Dr. Katrin Radtke, IFHV Prof. Dr. Pierre Thielbörger, IFHV Daniel Weller, IFHV Unter Mitarbeit von Leopold Karmann, Bündnis Entwicklung Hilft Sabine Ludwig, DAHW Christina Margenfeld, Brot für die Welt Stephan Simon, Welthungerhilfe Grafische Gestaltung und Infografik Naldo Gruden, MediaCompany Druck Druckerei Conrad, Berlin, gedruckt auf 100 % Recycling-Papier ISBN 978-3-946785-07-1 Der WeltRisikoBericht wird seit 2011 jährlich vom Bündnis Entwicklung Hilft publiziert. Verantwortlich: Peter Mucke 2 WeltRisikoBericht 2019
Vorwort
Wie in den letzten Jahren haben uns auch 2019 rechtliche Fragen verstärkt die politische Advo-
wieder eine Reihe von Krisen und Katastrophen cacy-Komponente des WeltRisikoBerichts und
infolge extremer Naturereignisse beschäftigt. soll insbesondere zivilgesellschaftliche Akteure
Das erste Halbjahr war insbesondere geprägt dabei unterstützen, ihre Rechte und die ihrer
von Wirbelsturm Idai, der Verwüstungen in Gemeinschaften einzufordern.
Mosambik, Malawi und Simbabwe anrichtete,
aber auch von erneuten Hitzerekorden in Euro- Der WeltRisikoBericht wird seit 2011 jährlich
pa. Hier verstärkten die Spätfolgen der Dürre- vom Bündnis Entwicklung Hilft herausgegeben.
welle des letzten Sommers die Auswirkungen Seit 2017 ist das Institut für Friedenssicherungs
auf Natur und Landwirtschaft. Zugleich hat die recht und Humanitäres Völkerrecht (IFHV) der
Gesellschaft auch durch das Engagement von Ruhr-Universität Bochum für die wissenschaft
Bewegungen wie Fridays for Future und Scien- liche Leitung und Berechnung des im Bericht
tists for Future eine deutliche Politisierung enthaltenen WeltRisikoIndex zu ständig. Als
in Umwelt- und Klimaschutzfragen erfahren. Mitglied des Network on Humanitarian Action
Mehr denn je ist in der öffentlichen Wahrneh- (NOHA) stellt das IFHV die internationale Ver-
mung angekommen, dass die Auswirkungen ankerung des Index in der Wissenschaft sicher.
von Klimawandel und daraus resultierenden Aufbauend auf dem Austausch zwischen Wissen-
Wetterextremen das Leben der Menschen schaft und Praxis verfolgen wir gemeinsam das
weltweit bestimmen und langfristig verändern Ziel, den Nutzwert des WeltRisikoBerichts als
werden. Für uns alle gilt es, besonders diejeni- Instrument für Entscheidungsträger*innen in
gen zu unterstützen, die schon jetzt unter den Politik und Gesellschaft zu erhalten und zu
Folgen des Klimawandels und dem schleichen- steigern.
den Verlust ihrer Lebensgrundlagen leiden,
und wirksame Vorsorge zu treffen.
Wie sehr sich Prävention, Bewältigung und
Anpassung von Land zu Land unterscheiden,
verdeutlicht der vorliegende WeltRisikoBe- Wolf-Christian Ramm
richt. Er bietet mit dem WeltRisikoIndex eine Vorstandsvorsitzender
Analyse von Katastrophenrisiken weltweit und Bündnis Entwicklung Hilft
gibt an, welche Länder den größten Bedarf
haben, Maßnahmen zur Bewältigung von und
Anpassung an extreme Naturereignisse zu stär-
ken. Mit dem diesjährigen Fokus auf Wasser-
versorgung beleuchtet der WeltRisikoBericht
wieder ein zentrales Thema im Kontext von
Katastrophen aus praktischer wie auch wissen- Prof. Dr. Pierre Thielbörger
schaftlicher Perspektive. Die Ausrichtung auf Geschäftsführender Direktor IFHV
Bündnis Entwicklung Hilft bildet sich aus den Hilfswerken Brot für Das Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völker-
die Welt, Christoffel-Blindenmission, DAHW, Kindernothilfe, medico recht der Ruhr-Universität Bochum ist eine der führenden Einrichtungen
international, Misereor, Plan International, terre des hommes und in Europa in der Forschung und Lehre zu humanitären Krisen. Aufbauend
Welthungerhilfe sowie den assoziierten Mitgliedern German Doctors auf einer langen Tradition der wissenschaftlichen Auseinandersetzung
und Oxfam. In Katastrophen- und Krisengebieten leisten die Bündnis- mit humanitärem Völkerrecht und den Menschenrechten verbindet das
Mitglieder sowohl akute Nothilfe als auch langfristige Unterstützung, um Institut heute interdisziplinäre Forschung aus den Fachrichtungen der
Not nachhaltig zu überwinden und neuen Krisen vorzubeugen. Rechts-, Sozial-, Geo- und Gesundheitswissenschaft.
WeltRisikoBericht 2019 3Weiterführende Informationen Der WeltRisikoBericht in der gedruckten Version hat einen Umfang, der die schnelle Lesbarkeit gewährleistet. Die Texte des Berichts werden durch Karten, Grafiken und Bilder ergänzt und damit veranschaulicht. Weiterführende Informationen, wissenschaftliche Angaben zur Methodik und Tabellen sind unter www.WeltRisikoBericht.de eingestellt. Dort stehen auch die Berichte 2011 bis 2018 als Download zur Verfügung. Ein interaktiver Reader zu den WeltRisikoBerichten ist unter www.WeltRisikoBericht.de/#epaper abrufbar. „Sind Katastrophen vermeidbar?“ – Unterrichtsmaterialien zum WeltRisikoIndex Die vorherrschende Sicht auf die Länder des globalen Südens ist oftmals durch Katastrophen und Konflikte bestimmt. Aktuelle humanitäre Krisen wie Hungersnöte, Erdbeben und Überschwemmungen sind wichtige Themen, an die schulischer Unterricht anknüpfen kann. Der WeltRisikoIndex ist ein guter Ansatzpunkt, dabei auch die soziale Situation und die Umweltbedingungen in den betroffenen Ländern zu behandeln. Die Unterrichtsmaterialien enthalten kurz gefasste thema- tische Darstellungen und ansprechende Arbeitsblätter, die die einzelnen Dimensionen des WeltRisikoIndex behandeln – von der Gefährdung über Anfälligkeit und Bewältigungskapazitäten bis hin zu Anpassungskapazitäten. Diese können in Form von Gruppen- oder Einzelarbeit in den Unterricht integriert werden. Die gedruckte Fassung des Unterrichtsmaterials kann kostenlos bestellt werden: kontakt@entwicklung-hilft.de Das Online-PDF des Unterrichtsmaterials steht zum Download bereit: www.WeltRisikoBericht.de/ unterrichtsmaterial WorldRiskReport Der englischsprachige WorldRiskReport ist unter www.WorldRiskReport.org verfügbar. 4 WeltRisikoBericht 2019
Inhalt
Zentrale Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 6
1. Wasser weltweit: Mangel versus Überfluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 9
Peter Mucke
2. Fokus: Wasserversorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 17
2.1 „Water Security“ als Teil internationalen Rechts
und internationaler Politik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 17
Pierre Thielbörger
2.2 Wasserversorgung in der Krise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 26
Jutta Himmelsbach
2.3 Nachhaltige Wasserversorgung bei
anhaltenden humanitären Krisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 34
Lisa Korte, Tim Forster, St John Day
3. Der WeltRisikoIndex 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 43
Katrin Radtke, Daniel Weller
4. Fazit und Handlungsempfehlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 53
Bündnis Entwicklung Hilft, IFHV
Anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 55
Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 62
WeltRisikoBericht 2019 5Abbildung 1: WeltRisikoIndex 2019
Zentrale Ergebnisse
WeltRisikoIndex 2019
++ Die drei Länder mit dem höchsten Katastro- wurde beispielsweise für Island (Rang 174) und
phenrisiko weltweit sind die Inselstaaten Vanu- Malta (Rang 179) berechnet.
atu (Indexwert: 56,71), Antigua und Barbuda
(Indexwert: 30,80) und Tonga (Indexwert: ++ Das Land mit dem niedrigsten Katastrophen
29,39). Inselstaaten gehören kontinentübergrei- risiko weltweit ist Katar (Indexwert: 0,31).
fend überdurchschnittlich oft zu den Ländern
mit einem hohen oder sehr hohen Katastro- ++ Der WeltRisikoIndex 2019 gibt das Katastrophen
phenrisiko. Dies ist oft auf ihre hohe bzw. sehr risiko für 180 Länder der Welt an. Damit umfasst
hohe Gefährdung gegenüber extremen Naturer- der Index acht Länder mehr als im Vorjahr:
eignissen zurückzuführen. Antigua und Barbuda (Rang 2), Demokratische
Republik Kongo (Rang 56), Föderierte Staaten
++ Insgesamt befinden sich die Hotspot-Regionen von Mikronesien (Rang 72), Montenegro
des Katastrophenrisikos auch 2019 in Ozeanien, (Rang 88), St. Lucia (Rang 123), São Tomé und
Südostasien, Mittelamerika sowie in West- und Príncipe (Rang 162), Malediven (Rang 169) sowie
Zentralafrika. St. Vincent und die Grenadinen (Rang 178).
++ In der Gesamtbetrachtung der Kontinente liegt ++ Erstmals seit 2012 war eine Aktualisierung der
die höchste gesellschaftliche Verwundbarkeit in Daten zur Gefährdung gegenüber extremen
Afrika vor, gefolgt von Asien und Amerika. Naturereignissen möglich. Alle Angaben in der
Expositionskomponente des WeltRisikoIndex
++ Europa ist der Kontinent mit dem niedrigsten stammen nun aus einem Bevölkerungsdaten-
Katastrophenrisiko weltweit. Deutschland weist satz (LandScan 2017).
mit einem Indexwert von 2,43 ein sehr geringes
Katastrophenrisiko auf und liegt auf Rang 163
im WeltRisikoIndex. Ein noch geringeres Risiko
6 WeltRisikoBericht 2019Fokus: Wasserversorgung
Rang Land Risiko
++ Wassersicherheit herzustellen bedeutet zwei- 1. Vanuatu 56,71 Abbildung 2:
erlei: zum einen Menschen einen Zugang zu Auszug aus dem
2. Antigua und Barbuda 30,80 WeltRisikoIndex
ausreichender Wasserversorgung zu garantie-
3. Tonga 29,39 2019
ren (Sicherheit durch Wasser), zum anderen
4. Salomonen 29,36
Menschen vor den Gefährdungen durch Wasser
5. Guyana 22,87
zu schützen (Sicherheit vor Wasser).
6. Papua-Neuguinea 22,18
++ Hauptprobleme der Wasserversorgung sind die 7. Brunei Darussalam 21,68
ungleiche Verteilung nach Regionen und die 8. Guatemala 20,69
Ungleichheit innerhalb von Gesellschaften. Nicht 9. Philippinen 20,69
selten ist Wasser für die Ärmsten am teuersten. 10. Bangladesch 18,78
11. Kap Verde 18,02
++ Die Auswirkungen des Klimawandels verschär- 12. Fidschi 17,83
fen wasserbedingte Problemlagen nicht nur in 13. Costa Rica 17,37
trockenen Gebieten, sondern weltweit. Extreme 14. Dschibuti 16,46
Naturereignisse wie Dürren am Horn von Afrika, 15. Timor-Leste 16,39
Zyklone mit Überschwemmungen im südlichen ... ... ...
Afrika oder in Asien bringen über Jahrzehnte 163. Deutschland 2,43
etablierte Abläufe in der Wasserversorgung an
... ... ...
ihre Grenzen.
166. Norwegen 2,34
167. Litauen 2,29
++ Im Falle extremer Naturereignisse und gewalt-
168. Schweden 2,20
samer Konflikte kann die Gewährleistung einer
sicheren Wasserversorgung je nach Situation 169. Malediven 2,08
noch weitaus schwieriger werden als in krisen- 170. Schweiz 2,05
freien Zeiten. 171. Estland 2,04
172. Finnland 1,94
++ Wenn es an Wasser mangelt und nur die Grund- 173. Ägypten 1,84
bedürfnisse zum Überleben gedeckt werden 174. Island 1,71
können, bleiben wichtige Entwicklungsprozesse 175. Barbados 1,35
auf der Strecke. Wassermangel wirkt sich nicht 176. Saudi-Arabien 1,04
nur auf Landwirtschaft und Gesundheitsversor- 177. Grenada 1,01
gung aus. Wenn Kinder zum Wasserholen statt 178. St. Vincent und d. Grenadinen 0,80
in die Schule geschickt werden, beeinträchtigt 179. Malta 0,54
Wassermangel auch die Bildungssituation. 180. Katar 0,31
++ Die internationale Gemeinschaft versagt drama-
tisch bei der Gewährleistung des Rechts auf professioneller und Gemeinschaftsbasis, die
Sanitärversorgung. Dies ist zu einem großen in unterschiedlichen Kontexten angewendet
Teil durch das Unbehagen bedingt, Themen werden könnten.
wie Toiletten und Sanitäranlagen auf die poli-
tische Agenda zu setzen und dafür Mittel zu ++ Gerade bei der nachhaltigen Wasserversorgung
mobilisieren. in dicht besiedelten Gebieten wie Flüchtlings-
camps und Städten besteht großes Optimie-
++ Geber von humanitären Hilfsgeldern sind häufig rungspotenzial. Geber und humanitäre Orga-
zögerlich, robuste Infrastrukturen zur Wasser- nisationen sollten Voraussetzungen für eine
versorgung zu finanzieren und setzen tenden- erfolgreiche Übergabe von Technologien an
ziell zu lange auf eine mobile Versorgung durch lokale Akteure frühzeitig identifizieren und
Tankwagen (Water Trucking). Dabei existie- dem Aufbau notwendiger Kapazitäten mehr
ren erprobte langfristige Betriebsmodelle auf Aufmerksamkeit widmen.
WeltRisikoBericht 2019 71 asser weltweit:
W
Mangel versus Überfluss
Der Zugang zu ausreichend sauberem Wasser, einer sicheren Abwasserent-
Peter Mucke sorgung und Sanitäranlagen ist weltweit sehr unterschiedlich verteilt. Die
Geschäftsführer, Bündnis
Entwicklung Hilft
internationale Staatengemeinschaft hat mit den Sustainable Development
Goals (SDGs) Ziele für eine verbesserte Versorgung verabschiedet, von der
alle Menschen profitieren sollen. Nicht zuletzt für die Katastrophenvorsorge
sind Fortschritte in diesem Bereich von großer Bedeutung. Nach extremen
Naturereignissen muss auch bei zerstörter Infrastruktur die Wasserversor-
gung schnell wiederhergestellt werden, um Überleben zu sichern und die
Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern.
Der menschliche Körper besteht zum großen Anders als Hunger bleibt Durst unbarmherzig
Teil aus Wasser, bei Erwachsenen sind es circa erhalten, nur starke Schmerzen oder Atemnot
60 Prozent, bei Säuglingen gar 75 Prozent des können ihn vergessen machen.
Körpergewichts. Ständig gibt der Körper Wasser
ab, durch Verdunstung auf der Haut, durch die Pro Person und Tag werden 7,5 bis 15 Liter
Harnproduktion und durch die Wasserabgabe Wasser als Mindestmenge benötigt, wobei
der Lunge mit der Atemluft – durchschnittlich für den Überlebensbedarf – also Trinken und
2,4 Liter pro Tag (Kurtz 2014). Bei schwitzen- Essen – 2,5 bis 3 Liter, für Hygiene 2 bis 6 Liter
den Menschen ist der Wasserverlust deutlich und für Kochen 3 bis 6 Liter gerechnet werden
höher. (Sphere Association 2018). Der spezifische
Bedarf ist abhängig vom Klima, von kulturel-
Mangelt es an Trinkwasser, steigert sich der len und sozialen Normen sowie individuellen
Durst nach und nach ins Unerträgliche. Die Bedürfnissen in der Regel höher. In Deutsch-
Körpertemperatur erhöht sich, das Herz beginnt land liegt der durchschnittliche, haushaltsbe-
schneller zu schlagen. Steigt der Wasserverlust zogene Pro-Kopf-Verbrauch bei 127 Liter pro
auf zehn Prozent des Körpergewichts an, begin- Tag (BDEW 2019), dort ist Wasser im Über-
nen Verwirrungszustände und Wahnvorstel- fluss vorhanden. Die Kostbarkeit von sauberem
lungen. Ohne feste Nahrung kann ein Mensch Wasser wird vor allem jenen Menschen bewusst,
wochenlang überleben, ohne Wasser sind es die in Gebieten mit ausgedehnter Trockenheit
selbst unter günstigen klimatischen Bedingun- leben, ohne angemessene Wasserversorgung
gen nur wenige Tage. und ohne Abwasserbeseitigung.
Das Recht auf Wasser
Wasser ist auf der Erde in nahezu unbegrenzter fast zwei Prozent sind als Eiskappen der Pole
Menge vorhanden. Circa 71 Prozent der Erdober- festgefroren und ein weiterer Anteil befindet
fläche sind damit bedeckt, das gesamte Wasser- sich als Wasserdampf oder Wolken in der Atmo-
volumen beträgt rund 1,4 Milliarden Kubik sphäre. Nur 0,3 Prozent des Gesamtvorrats an
kilometer. Doch für den menschlichen Bedarf ist Süßwasser, rund 100.000 Kubikkilometer, sind
davon nur ein ganz begrenzter Teil nutzbar. Gut relativ leicht verfügbar (BPB 2017). Und auch
96,5 Prozent macht das salzige Meerwasser aus, diese Ressource ist sehr unterschiedlich verteilt.
WeltRisikoBericht 2019 9Ungleiche Verteilung Das Menschenrecht auf Wasser
Hauptproblem bei der Wasserversorgung sind Mit der Resolution 64/292 haben die Verein-
die ungleiche Verteilung nach Regionen und ten Nationen im Jahr 2010 das Menschenrecht
die Ungleichheit innerhalb der Gesellschaften. auf Wasser beschlossen: Die Generalversamm-
Nicht selten ist Wasser gerade für die Ärms- lung „erkennt das Recht auf einwandfreies und
ten am teuersten (siehe Kapitel 2.2). In 22 sauberes Trinkwasser und Sanitärversorgung
Ländern herrscht akut Wasserstress, das heißt als ein Menschenrecht an, das unverzichtbar
die verbrauchten Wasservorräte werden nicht für den vollen Genuss des Lebens und aller
im notwendigen Maße durch Regen oder Rück- Menschenrechte ist“. Sie hat dabei auch die
führung von gereinigtem Wasser regeneriert Staaten und die internationalen Organisatio-
(UN 2018). Auch die Nutzung von unterirdi- nen aufgefordert, „im Wege der internationa-
schen Vorkommen ist ohne ihre Erneuerung len Hilfe und Zusammenarbeit Finanzmittel
keine tragfähige Alternative. Derzeit sind schät- bereitzustellen, Kapazitäten aufzubauen und
zungsweise 3,6 Milliarden Menschen in Gebie- Technologien weiterzugeben, insbesondere
ten zuhause, die mindestens einen Monat pro für die Entwicklungsländer, um die Anstren-
Jahr Wasserknappheit haben. Und diese Bevöl- gungen zur Bereitstellung von einwandfreiem,
kerung könnte bis 2050 auf etwa 4,8 bis 5,7 sauberem, zugänglichem und erschwinglichem
Milliarden wachsen (WWAP 2019, 14). Trinkwasser und zur Sanitärversorgung für alle
zu verstärken“ (UN-Doc. A/Res/64/292). Bis
Die weltweite Nachfrage nach Wasser steigt heute ist die Interpretation des Menschenrechts
seit 1980 pro Jahr um etwa ein Prozent, Prog- auf Wasser strittig (siehe hierzu Kapitel 2.1).
nosen der Vereinten Nationen gehen von noch
höheren Zuwächsen in den kommenden Jahren Die Vereinten Nationen fordern für die Wasser-
aus (WWAP 2019, 13). Beispielsweise hat sich versorgung weltweit die Sicherstellung der
die Größe der weltweit bewässerten Fläche in Wasserverfügbarkeit, Wasserqualität und
den vergangenen 50 Jahren verdoppelt. Und Wasserzugänglichkeit (physisch und wirt-
die Erneuerung der Wasser-Ressourcen durch schaftlich). Die Wasserversorgung muss sicher
Führung des Wassers in einem Kreislauf liegt in und erreichbar sein, auch für Menschen mit
weiter Ferne: 80 Prozent des weltweiten Abwas- Behinderungen und für Ältere. Das Wasser
sers werden unbehandelt bzw. nicht ausrei- muss zu angemessenen Kosten erwerbbar
chend aufbereitet in die Umwelt (in Flüsse, Seen sein und kulturellen Ansprüchen genügen
oder Meere) abgegeben (WWAP 2017, 2). (CESCR 2002).
Trinkwasser- und Sanitärversorgung
Zwar war mit der Millenniums-Erklärung der Sanitärversorgung so ausgeweitet, dass sie bis
Vereinten Nationen schon im Jahr 2000 inter- 2030 allen Menschen zugutekommen sollen –
national vereinbart worden, bis zum Jahr 2015 gemäß der Festschreibung als Menschenrecht
sowohl den Anteil der Menschen, die einwand- auf Wasser.
freies Trinkwasser nicht erreichen oder es
sich nicht leisten können, als auch den Anteil Aktuelle Situation
der Menschen, die keinen Zugang zu grund-
legenden sanitären Einrichtungen haben, zu Im Juni 2019 veröffentlichten UNICEF und WHO
halbieren (UN-Doc. A/Res/55/2). Doch erst die aktuellen Zahlen zur Wasserversorgung
mit den 2015 vereinbarten Zielen für eine nach- weltweit (UNICEF / WHO 2019). Demnach
haltige Entwicklung (Sustainable Develop- fehlt 785 Millionen Menschen weltweit die
ment Goals SDGs, siehe Schaukasten rechts) Grundversorgung mit Trinkwasser. Das heißt,
wurden die international vereinbarten Anstren- sie können innerhalb einer Entfernung von
gungen für eine verbesserte Wasser- und insgesamt 30 Gehminuten keine geschützte
10 WeltRisikoBericht 2019Trinkwasser quelle erreichen. 2,2 Milliar- Ziele nachhaltiger Entwicklung
den Menschen haben keine sichere Wasser-
versorgung, also kein Trinkwasser auf dem SDG 6 „Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von
Grundstück, das jederzeit und frei von Konta- Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten“ beinhaltet:
minierungen verfügbar ist. Zwei Milliarden
Menschen weltweit haben keine Grundversor- 6.1 Bis 2030 den allgemeinen und gerechten Zugang zu ein-
gung mit Sanitäranlagen. Sie verfügen über wandfreiem und bezahlbarem Trinkwasser für alle erreichen
keine Toilette, die nicht mit anderen Haushal-
ten geteilt werden muss. Weiteren 2,2 Milliar- 6.2 Bis 2030 den Zugang zu einer angemessenen und gerech-
den fehlt eine sichere Sanitärversorgung mit ten Sanitärversorgung und Hygiene für alle erreichen und
hygienischen Toiletten, deren Abwasser sicher der Notdurftverrichtung im Freien ein Ende setzen, unter
behandelt und entsorgt wird. Dagegen steht 3,4 besonderer Beachtung der Bedürfnisse von Frauen und
Milliarden Menschen eine sichere Sanitärver- Mädchen und von Menschen in prekären Situationen
sorgung zur Verfügung. Die fehlende Grund-
versorgung betrifft bei Sanitäranlagen zu 70 6.3 Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Ver
Prozent und bei Trinkwasser zu 80 Prozent den schmutzung, Beendigung des Einbringens und Minimie-
ländlichen Raum. rung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe,
Halbierung des Anteils unbehandelten Abwassers und
Auch die globalen Trends für Hygiene zeigen, eine beträchtliche Steigerung der Wiederaufbereitung und
dass weiterhin großer Handlungsbedarf besteht: gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern
Drei Milliarden Menschen weltweit haben keine
oder nur eingeschränkte Möglichkeiten, sich die 6.4 Bis 2030 die Effizienz der Wassernutzung in allen Sektoren
Hände im oder am Haus mit Seife zu waschen. wesentlich steigern und eine nachhaltige Entnahme und
Jedes Jahr sterben 297.000 Kinder unter fünf Bereitstellung von Süßwasser gewährleisten, um der
Jahren an Durchfallerkrankungen, die durch Wasserknappheit zu begegnen und die Zahl der unter
mangelnde Wasser-, Sanitär- und Hygienever- Wasserknappheit leidenden Menschen erheblich zu
sorgung verursacht sind (UN 2019; siehe auch verringern
Schaukasten „Krank durch Wasser“, Seite 31).
6.5 Bis 2030 auf allen Ebenen eine integrierte Bewirtschaf-
Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass tung der Wasserressourcen umsetzen, gegebenenfalls auch
von 2000 bis 2017 bereits viel erreicht wurde mittels grenzüberschreitender Zusammenarbeit
(UNICEF / WHO 2019): Der Anteil der Bevöl-
kerung mit Zugang zu einer sicheren Trink- 6.6 Bis 2020 wasserverbundene Ökosysteme schützen und
wasserversorgung stieg von 61 auf 71 Prozent, wiederherstellen, darunter Berge, Wälder, Feuchtgebiete,
1,8 Milliarden Menschen erhielten mindestens Flüsse, Grundwasserleiter und Seen
Zugang zu einer Grundversorgung. Die Zahl
der Menschen ohne Grundversorgung sank 6.A Bis 2030 die internationale Zusammenarbeit und die Unter-
damit auf 785 Millionen und die Anzahl der stützung der Entwicklungsländer beim Kapazitätsaufbau für
Menschen, die auf ungereinigtes Oberflächen- Aktivitäten und Programme im Bereich der Wasser- und
wasser zurückgreifen müssen, von 256 Milli- Sanitärversorgung ausbauen, einschließlich der Wasser-
onen auf 144 Millionen. Diese Fortschritte sammlung und -speicherung, Entsalzung, effizienten
wurden vor allem im ländlichen Raum erzielt. Wassernutzung, Abwasserbehandlung, Wiederaufberei-
Der Zugang zu einer gesicherten Sanitärversor- tungs- und Wiederverwendungstechnologien
gung stieg von 28 auf 45 Prozent. Die Zahl der
Menschen, die im Freien defäkieren müssen, 6.B Die Mitwirkung lokaler Gemeinwesen an der Verbesserung
sank von 1,3 Milliarden auf 673 Millionen und der Wasserbewirtschaftung und der Sanitärversorgung
hat sich damit nahezu halbiert. unterstützen und verstärken
Das Zwischenfazit im Jahr 2019 zeigt somit (Zitiert gemäß UN General Assembly 2015)
eine zweigeteilte Einschätzung: Vieles wurde
bereits auf den Weg gebracht, vieles bleibt noch
zu tun. Auch für die Zukunft stellen die hohe
WeltRisikoBericht 2019 11Ungleichheit der Einkommen, das Bevölke- der Pro-Kopf-Wasserverbrauch im Erhebungs-
rungswachstum und die rapide Vergrößerung zeitraum 2013 – 2017 von 47,83 m³ pro Jahr in
der städtischen Ballungszentren die großen der Elfenbeinküste bis 1.710 m³ in Usbekistan.
Herausforderungen für die Wasser- und die
Sanitärversorgung dar. Bei der Interpretation der Daten ist jedoch
Vorsicht geboten. Denn der Pro-Kopf-
Pro-Kopf-Verbrauch und virtuelles Wasser Verbrauch ist keine Messgröße, die linear inter-
pretiert werden kann. Zwar gilt im Allgemei-
Der Wasserverbrauch pro Kopf wird als eine nen, dass der Wasserverbrauch in Ländern mit
Möglichkeit genutzt, die Wasserversorgung geringerem Entwicklungsstand gemäß Human
international zu vergleichen. Die Menge an Development Index (HDI) niedrig ist und in
sauberem Wasser, die pro Person verbraucht Ländern mit hohem Entwicklungsstand gemäß
wird, umfasst dabei weit mehr als nur die HDI in der Regel hoch. Doch es gibt Gegenbei-
Nutzung zum Trinken, Kochen und Waschen. spiele: So hat Großbritannien (HDI-Rang: 14)
Für die Herstellung von Konsumgütern wie einen Wasserverbrauch von 127,2 m³ pro Kopf
Baumwolle, Kaffee, Fleisch oder Textili- und Indonesien (HDI-Rang: 116) von 843,2 m³
en werden in Landwirtschaft und Industrie pro Kopf (FAO 2019; UNDP 2018).
große Mengen an Frischwasser benötigt, das
nur in geringem Maße wieder zurückgewon- Ein hoher Pro-Kopf-Wasserverbrauch eines
nen wird. Die Menge an Wasser, die für den Landes kann ein Indikator für gute Trinkwasser-
gesamten Herstellungsprozess von Produkten versorgung, umfangreiche Hygiene-Möglich-
verwendet wird, bezeichnet man als „virtuel- keiten, ertragreiche Landwirtschaft und umfas-
les Wasser“. Auch dies wird beim Pro-Kopf- sende Herstellung von Produkten sein. Er kann
Wasserverbrauch eines Landes mit eingerech- aber ebenso ein Zeichen für Verschwendung
net (siehe Abbildung 3 unten). Basierend auf und für die Übernutzung der Ressource Wasser
den Daten aus AQUASTAT, einer Datenbank sein. Ein niedriger Wasserverbrauch pro Kopf
der UN-Landwirtschaftsorganisation FAO mit ist zwar in der Regel eine Problemanzeige, kann
Informationen zu Wasserressourcen und aber auch durch Wassersparmaßnahmen in
-nutzung von über 180 Ländern, erstreckt sich Haushalten, effiziente Bewässerungssysteme
659,7
602,5
308,5
251,1
81,1
Australien Kolumbien Deutschland Indien Kenia
Abbildung 3: Ländervergleich des Pro-Kopf-Wasserverbrauchs (direkter und indirekter Verbrauch, alle Angaben in m3 / Jahr)
Datenquelle: FAO AQUASTAT 2019
12 WeltRisikoBericht 2019oder geschlossene Wasserkreisläufe bei der ++ Findet eine Erneuerung der Wasserreserven
industriellen Produktion verursacht sein. statt?
Bei der Beurteilung der Wassersituation eines ++ Ist die Wassernutzung für alle
Landes (siehe auch Klappkarte „Wasser ver Bewohner*innen gleichberechtigt
sorgung: Handlungsbedarf in gefährdeten gewährleistet?
Ländern“) sind daher neben dem Pro- Kopf-
Verbrauch auch andere wichtige Aspekte zu ++ Wird das genutzte Wasser sauber in den
berücksichtigen: Kreislauf zurückgeführt?
Wasserversorgung in Katastrophen und Krisen
Im Falle extremer Naturereignisse und gewalt- Menschen, die durch Fluten bedroht sind, von
samer Konflikte kann die Gewährleistung einer derzeit 1,2 Milliarden auf 1,6 Milliarden im Jahr
sicheren Wasserversorgung je nach Situation 2050 ansteigen wird.
noch weitaus schwieriger werden als in krisen-
freien Zeiten, zum Beispiel: Risikobewertung
++ Wasser-Quellen wie Stauseen oder Brunnen Die Relevanz des diesjährigen Fokus „Wasser-
werden verunreinigt oder zerstört. versorgung“ des WeltRisikoBerichts zeigt sich
auch beim WeltRisikoIndex: Insgesamt drei
++ Wasser-Speichersysteme oder Verteilungs- der 27 Indikatoren haben hierzu direkten Bezug
netzwerke für Trinkwasser wie Rohrsysteme (siehe Kapitel 3). Für die Indikatoren „Anteil
- also die Infrastruktur - werden beeinträch- der Bevölkerung ohne Zugang zu Trinkwasser-
tigt oder zerstört. Grundversorgung“ und „Anteil der Bevölkerung
ohne Zugang zu sanitärer Grundversorgung“,
++ Abwassertransport, Kläranlagen und die der Komponente Anfälligkeit zugeordnet
Pumpsysteme fallen aus, weil sie geschädigt sind, gilt grundsätzlich: Je weniger Menschen
werden oder die Energieversorgung gestört einer Gesellschaft Zugang zu einer Grundver-
wird. sorgung mit Trinkwasser und sanitären Anla-
gen haben, desto anfälliger ist sie gegenüber
++ Die Schäden an der Infrastruktur können extremen Naturereignissen. Auch wie sorg-
unter anderem dazu führen, dass ein sam mit dem verfügbaren Wasser umgegan-
ungleicher Zugang zu Wasser oder eine gen wird, ist mitentscheidend darüber, wie gut
ungleiche Verteilung für verschiedene eine Bevölkerung gegenüber Naturgefahren
Bevölkerungsgruppen entstehen. gewappnet ist. Dies wird im WeltRisikoIndex
mit dem Indikator „Wasserressourcen“ bzw.
++ Aufgrund der Schäden leiden die Wasser- Anteil des Abwassers, das zumindest einer
qualität und der Standard der Sanitärver- ersten Reinigung unterzogen wird berücksich-
sorgung, es treten vermehrt wasserinduzier- tigt. Er ist in der Komponente Anpassungska-
te Krankheiten auf. pazitäten aufgenommen.
Dabei steht in vielen Fällen die Katastrophe Maßnahmen im Katastrophenfall
in direktem oder indirektem Zusammen-
hang mit Wasser. Von 1995 bis 2015 gingen In Katastrophensituationen ist die Wasserver-
über 90 Prozent der Katastrophen auf Über- sorgung oftmals eine große Herausforderung
schwemmungen, Wirbelstürme, Hitzewel- (siehe auch Klappkarte „Wie extreme Naturer-
len oder andere wetterbedingte Er eig
nisse eignisse die Wasserversorgung gefährden“). Die
zurück (CRED / UNISDR 2015, 5). Prognosen Überlebenden müssen schnell Zugang zu saube-
der OECD gehen davon aus, dass die Zahl der rem Wasser erhalten, eine Verunreinigung der
WeltRisikoBericht 2019 13Wasserquellen muss unterbunden und vorhan- Wasser in saubere Gefäße abfüllen und auf dem
dene Infrastruktur für die Wasser- und Sanitär- Weg nach Hause Verunreinigungen vermieden
versorgung instand gesetzt werden. werden. Regelmäßig wird die Trinkwasserqua-
lität durch Analysen überwacht.
Basis der Maßnahmen sollte eine genaue Analy-
se der vorhandenen Wasserzugänge und der Eine einfach zu transportierende Trinkwasser-
Qualität des verfügbaren Wassers sein. Je nach aufbereitungsanlage für die mobile Notfallver-
Situation im Katastrophengebiet können dann sorgung ist der Wasserrucksack PAUL (Portable
zum Beispiel eine oder mehrere der folgen- Aqua Unit for Lifesaving), den beispielweise die
den kurzfristigen Maßnahmen zum Einsatz Bündnis-Mitglieder Christoffel-Blindenmission
kommen: und terre des hommes einsetzen. Kernelement
des Wasserrucksacks ist eine Filtermembran,
++ Wassertransport mit Tankfahrzeugen die Partikel, Bakterien und Viren weitestgehend
(Water Trucking) zurückhält. Die Anlage ist etwa 20 Kilogramm
schwer und zeichnet sich durch einen einfa-
++ Aufbau von Wasserspeichern (Rapid Instal- chen mechanischen Aufbau, einfache Handha-
lation Tanks) bung und einen Betrieb ohne externe Energie
und Chemikalien aus. Der von der Universität
++ Reparatur bzw. Aufbau von Rohrsystemen Kassel entwickelte Wasserrucksack kann bis
zur Wasserverteilung und für Zapfstellen zu 2.500 Liter Wasser pro Tag reinigen. Ende
2018 waren weltweit bereits 3.000 Geräte im
++ Reinigung und Desinfizierung von größeren Einsatz (Frechen 2019).
Wassermengen (zentral und dezentral
direkt in den Haushalten) Da von Katastrophen aufgrund extremer
Naturereignisse in besonderem Maße Insel-
++ Übergangsweise Nutzung von staaten und Länder mit ausgedehnten
Grundwasservorräten. Küstenregionen betroffen sind (siehe Kapi-
tel 3), kommt der Weiterentwicklung mobi-
Vielfach werden einfache Technologien für ler Meerwasser-Entsalzungsanlagen beson-
die kurzfristige Wasserversorgung genutzt. dere Bedeutung zu. Zahlreiche Anlagen zur
Beispielsweise setzt die Welthungerhilfe mobi- Entsalzung, die auf unterschiedlichen Tech-
le Aufbereitungsanlagen ein, die in Not hilfe- nologien basieren, werden im Rahmen von
Situationen innerhalb weniger Stunden nahe Projekten der Entwicklungszusammenarbeit
einer Wasserquelle (Fluss, See) installiert in verschiedenen Ländern eingesetzt, zum
werden können (Welthungerhilfe 2019). Teil in kleinem Maßstab auf Haushaltsebene
Damit kann die Wasserversorgung mit einer (Boden / Subban 2018).
Kapazität von über 60 m³ pro Tag gesichert
werden. Das Wasser wird in einen kreisförmi- Mit dem Fortbestehen einer humanitären
gen „Zwiebeltank“ gepumpt und dort geklärt. Krise sollten möglichst längerfristige Lösun-
Die Sedimente lagern sich auf dem Boden des gen zur Wasserversorgung etabliert werden
Tanks ab. Das Wasser wird dann in zwei flexi- und die mobilen Aufbereitungsanlagen und
ble Tanks gepumpt, mit Chlor behandelt und andere kurzfristige Versorgungsmaßnahmen
dadurch desinfiziert. Bereits nach 30 Minuten ablösen (siehe Kapitel 2.3). In Kapitel 4 des
ist das Wasser trinkbar. Über eine Vielzahl von Berichts werden weitere Handlungsempfeh-
Wasserhähnen, die an die Tanks angeschlos- lungen formuliert, wie sich Fortschritte in der
sen sind, versorgen sich über 2.800 Menschen Wasser- und Sanitärversorgung erzielen lassen
pro Tag auf diesem Wege mit Trinkwasser. Es und Menschen so widerstandsfähiger gegen
wird darauf geachtet, dass die Menschen das Katastrophen werden können.
14 WeltRisikoBericht 2019Das Konzept des WeltRisikoBerichts
Risikobegriff und Ansatz tativer Herangehensweise, das Hinter Im WeltRisikoIndex können – wie in jedem
gründe und Zusammenhänge beleuchtet Index – nur Indikatoren berücksichtigt
Die Risikobewertung im WeltRisikoBericht – in diesem Jahr zum Thema „Wasser- werden, für die nachvollziehbare, quanti-
beruht auf dem grundsätzlichen Verständ- versorgung“. fizierbare Daten verfügbar sind. Beispiels-
nis, dass für die Entstehung einer Kata- weise ist die direkte Nachbarschaftshilfe
strophe nicht allein entscheidend ist, wie Die Berechnung des Katastrophenrisikos im Katastrophenfall zwar nicht messbar,
hart die Gewalten der Natur die Menschen erfolgt für 180 Staaten weltweit und aber dennoch sehr wichtig. Außerdem
treffen, sondern auch, wie Gesellschaften basiert auf vier Komponenten: kann es Abweichungen in der Datenqua-
auf extreme Naturereignisse reagieren lität zwischen verschiedenen Ländern
können. Je nach Entwicklungsstand ist ++ Gefährdung / Exposition gegenüber Erd- geben, wenn die Datenerhebung nur
die Bevölkerung verletzlicher gegenüber beben, Wirbelstürmen, Überschwem- durch nationale Autoritäten und nicht
Naturereignissen als bei einer besseren mungen, Dürren und Meeresspiegel- durch eine unabhängige internationale
Ausgangslage hinsichtlich Anfälligkeit, anstieg Institution erfolgt.
Bewältigungs- und Anpassungskapazitä-
ten (Bündnis Entwicklung Hilft 2011). ++ Anfälligkeit in Abhängigkeit von Infra- Ziel des Berichts
struktur, Ernährung und ökonomischen
Risikobewertung Rahmenbedingungen Die Darstellung des Katastrophenrisikos
mithilfe des Index und seiner vier Kompo-
Der WeltRisikoBericht beinhaltet den Welt- ++ Bewältigungskapazitäten in Abhän- nenten macht die weltweiten Hotspots des
RisikoIndex, der seit 2018 vom Institut für gigkeit von Regierungsführung, medi Katastrophenrisikos und die Handlungs-
Friedenssicherungsrecht und Humanitäres zinischer Versorgung, sozialer und felder für die erforderliche Risikoreduzie-
Völkerrecht (IFHV) der Ruhr-Universität materieller Absicherung rung auf quantitativer Basis sichtbar. Auf
Bochum berechnet wird. Entwickelt wurde dieser Grundlage, ergänzt durch die quali-
der Index vom Bündnis Entwicklung Hilft ++ Anpassungskapazitäten bezogen auf tativen Analysen, können Handlungsemp-
und der United Nations University Bonn. kommende Naturereignisse, auf den fehlungen für nationale und internatio-
Neben dem Datenteil enthält der Bericht Klimawandel und auf andere Heraus- nale, staatliche und zivilgesellschaftliche
immer auch ein Fokuskapitel mit quali- forderungen. Akteure formuliert werden.
Naturgefahren-Bereich Gesellschaftlicher Bereich
Überschwemmungen
Vulnerabilität
Summe aus den drei
Meeresspiegelanstieg Gefährdung Komponenten
Exposition gegenüber
Naturgefahren
Wirbelstürme Bewältigung
Anfälligkeit Kapazitäten zur
Wahrscheinlichkeit, im Verringerung negativer
Ereignisfall Schaden zu Auswirkungen im
erleiden Ereignisfall
Dürren
Anpassung
Erdbeben WeltRisikoIndex Kapazitäten für
langfristige Anpassung
Produkt aus Gefährdung und Vulnerabilität
und Wandel
Abbildung 4: Der WeltRisikoIndex und seine Komponenten
WeltRisikoBericht 2019 152 Wasserversorgung
2.1 „Water Security“ als Teil internationalen
Rechts und internationaler Politik
„Wassersicherheit“ muss auf zwei Weisen verstanden werden: einerseits als
Pierre Thielbörger „Sicherheit durch Wasser“ im Sinne eines Zugangs für Individuen zu saube-
Professor für öffentliches Recht
und Völkerrecht, IFHV, rem Wasser als Lebensgrundlage, andererseits als „Sicherheit vor Wasser“
Ruhr-Universität Bochum im Sinne der Abwesenheit von wasserspezifischen Gefahren. „Sicherheit
durch Wasser“ beinhaltet eine menschenrechtliche Herangehensweise als
ein Mittel, um gewisse Mindeststandards von Wasserzugang zu garantieren.
Im Mittelpunkt von „Sicherheit vor Wasser“ steht Wasser als Gefahrenquel-
le. Erstens beobachten wir steigende Meeresspiegel sowie wasserbezogene
extreme Naturereignisse wie Überflutungen und Tsunamis, die in Zahl und
Intensität zunehmen. Zweitens prognostizieren viele Expert*innen schon
heute, dass zukünftige Kriege um Wasser geführt werden. Zum Abschluss
wird der Fokus auf aktuelle und zukünftige Herausforderungen an Wasser-
sicherheit gelegt, darunter private Investitionen im Wassersektor, die Folgen
des Klimawandels und die weltweite Sanitärkrise.
Wasser ist ein lebenswichtiges Element – auch immer (also auch im Ausnahmezustand wie
und gerade in Ausnahmesituationen wie Kata- bei Katastrophen) zu garantieren. Sicherheit
strophen. „Water Security“ ist dennoch ein wurde traditionell als ein (zwischen-)staatli-
umstrittenes normatives Konzept ohne einheit- ches Konzept verstanden, jedoch haben sich die
liche Definition und Interpretation (Allouche et Begriffe von „environmental security“ (Tuch-
al. 2011). Denn Wasser kann einen Menschen man Mathews 1989) und „human security“
retten, ihn aber auch töten. Der Begriff muss (World Summit for Social Development 1995)
daher mindestens in doppelter Weise verstan- mittlerweile etabliert und den Sicherheitsbe-
den werden: einerseits als „Sicherheit durch griff erweitert. Dieser Teil von „Water Securi-
Wasser“ im Sinne des Zugangs für Individuen ty“ ist eng verbunden mit dem Menschenrecht
zu Wasser als Lebensgrundlage, andererseits auf Wasser – einem noch immer umstrit-
als „Sicherheit vor Wasser“ im Sinne der Abwe- tenen Menschenrecht (siehe u. a. Thielbör-
senheit von wasserspezifischen Gefahren, die ger 2014; Winkler 2012; Laskowski 2010),
sowohl natürlich als auch menschengemacht dessen normative Grundlage und Tragweite
sein können. Detailliert ausgearbeitet ist diese bis heute viele Fragen offenlässt (Chirwa 2019;
umfassende Betrachtung von Wassersicherheit Thielbörger 2019a).
in Thielbörger (2019b).
Im Mittelpunkt von „Sicherheit vor Wasser“
„Sicherheit durch Wasser“ beinhaltet eine steht Wasser als Gefahrenquelle. Dies umfasst
menschenrechtliche Herangehensweise, um einerseits den Schutz vor einem Zuviel an Was-
Mindeststandards von Wasserzugang für Ver- ser, also insbesondere vor Katastrophen infol-
sorgung, Hygiene, Sanitäranlagen und weite- ge wasserbedingter extremer Naturereignisse.
re grundlegende Zwecke für Individuen Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass
WeltRisikoBericht 2019 17Wassersysteme besonders vom Klimawandel wie steigender globaler Temperaturen und
betroffen sind, vor allem durch steigende zunehmend auftretender extremer Naturereig-
Meeresspiegel und Überflutungen und Tsuna- nisse ausdrücklich als Herausforderung für die
mis, die in Zahl und Intensität zunehmen Zukunft hervorgehoben (UN 2015, 61).
werden (IPCC 2018). Andererseits wurde auch
die Möglichkeit von Kriegen um Wasser seit Im Jahr 2002 veröffentlichte der Ausschuss für
Jahren vielfach diskutiert. Viele Expert*innen wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
prognostizieren schon heute, dass aufgrund der Vereinten Nationen (CESCR) die allgemei-
seiner besonderen politischen und wirtschaft- ne Bemerkung Nr. 15 zum Thema „Das Recht
lichen Bedeutung zukünftig Kriege um Wasser auf Wasser“ (CESCR 2002). Darin beschreibt
geführt werden (Wolf 1999; Rahaman 2012). der Ausschuss den normativen Inhalt des
Rechts auf Wasser und betont, dass es, obwohl
Zwar wurden sowohl im Bereich „Sicherheit es nicht ausdrücklich im Menschenrechtspakt
durch Wasser“ als auch im Bereich „Sicherheit über die wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
vor Wasser“ in den letzten Jahren große Fort- rellen Rechte (Sozialpakt) genannt wird, vom
schritte erzielt. Gleichzeitig bestehen aber auch Recht auf einen angemessenen Lebensstan-
noch enorme Herausforderungen, auf die die dard abzuleiten ist (Abs. 3). Es sei außerdem
Weltgemeinschaft zeitnah reagieren muss, um eng mit dem Recht auf den höchsten erreich-
eine wassersichere Welt für zukünftige Genera- baren Gesundheitsstandard und dem Recht
tionen noch möglich erscheinen zu lassen. auf Leben verbunden (Abs. 11). Die allgemeine
Bemerkung Nr. 15 ist zwar nicht rechtsverbind-
Rechtlicher Rahmen der Sicherheit durch Wasser lich, darf aber in ihrer Bedeutung für das Recht
auf Wasser keinesfalls unterschätzt werden
Bereits 1977 stellte der Aktionsplan der Wasser- (Thielbörger 2014, 67), da sie den normativen
konferenz der Vereinten Nationen in Mar del Inhalt des Rechts auf Wasser erstmals ausführ-
Plata fest, dass Wasser als Menschenrecht zu lich entwickelt hat und von Anfang an, mit nur
gelten habe (S. 63). 1979 wurde dieses Recht wenigen Ausnahmen (Tully 2005), auf breite
in Art. 14(2)(h) des Übereinkommens zur Zustimmung gestoßen ist.
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung
der Frau (UN-Doc. A/RES/34/180) anerkannt Im Juli 2010 verabschiedete die UN-General-
und daraufhin zehn Jahre später auch in Art. versammlung eine Erklärung, in der sie Zugang
24(2) der Kinderrechtskonvention (UN-Doc. zu Wasser und Sanitäranlagen zum Menschen-
A/RES/44/25) übernommen. Das Recht auf recht erklärte (UN-Doc. A/Res/64/292).
Wasser wurde dabei erstmals rechtlich verbind- Während einige Staaten der Resolution mit
lich verankert, wenn auch nur für bestimmte erheblicher Zurückhaltung begegneten (Thiel-
Gruppen. börger 2014, 79 – 80), wurde bereits wenige
Monate später, im Oktober 2010, eine ähnliche
Im Jahr 2000 verpflichteten sich die Staaten, Erklärung im Menschenrechtsrat (UN-Doc. A/
die Millenniums-Entwicklungsziele (MDGs) zu HRC/Res/15/9) einstimmig angenommen.
erreichen. Im Ziel 7c wird gefordert, dass bis
2015 der Anteil der Bevölkerung ohne nachhalti- 15 Jahre nach der Verabschiedung der Millen
gen Zugang zu sauberem Trinkwasser und sani- niums-Erklärung, die die MDGs enthält,
tärer Grundversorgung halbiert werden solle beschloss die UN-Generalversammlung die
(UN-Doc. A/Res/55/2, Abs. 19). Und tatsächlich Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs).
wurden im Folgenden erhebliche Fortschritte SDG 6 fordert die universelle Verfügbarkeit
erzielt: Im Jahr 2015 hatten 147 von 193 Ländern und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser
das MDG 7c erreicht. Damit hatten 91 Prozent und Sanitäranlagen. Der jüngste Bericht hierzu
der Weltbevölkerung Zugang zu verbesserten von 2018 stimmt aber nur verhalten optimis-
Trinkwasserquellen, gegenüber 76 Prozent im tisch, dass die einzelnen Unterziele des SDG 6
Jahr 1990 (alle Zahlen: UN 2015, 7, 52). Im erreicht werden können (UN Water 2018). Nur
MDG-Bericht 2015 wird dennoch Wasserun- 20 Prozent der Länder, in denen 2015 mindes-
sicherheit aufgrund akuter Umweltprobleme tens fünf Prozent der Bevölkerung keinen
18 WeltRisikoBericht 2019Zugang zur Grundversorgung mit Trinkwasser Rechtlicher Rahmen der Sicherheit vor
hatten, seien auf einem guten Weg bis 2030 Wasser
eine universelle Grundversorgung mit Wasser
zu erreichen (UN Water 2018, 39). Sofortige Schutz vor Wasser hat insbesondere drei
Maßnahmen seien nötig, wenn die Ziele der normative Facetten: a) die allgemeine staatliche
Agenda 2030 noch erreicht werden sollen (UN Verpflichtung, Katastrophen infolge extremer
Water 2018, 178). Naturereignisse möglichst zu verhindern und
Folgen abzumildern; b) die (sehr umstritte-
Wie bei allen sozioökonomischen Rechten ne) Verpflichtung, dem Klimawandel durch
sind die Staaten verpflichtet, das Menschen- staatliches Handeln entgegenzutreten (und
recht auf Wasser zu respektieren, zu schützen die Wahrscheinlichkeit klimawandelbeding-
und zu erfüllen (CESCR 2002, Abs. 20). Dies ter Katastrophen nicht zu erhöhen); und c)
gilt grundsätzlich immer, also auch in Ausnah- Wasserknappheit oder wasserbedingte Kata-
mesituationen, wie bei Katastrophen infolge strophen nicht in militärische Auseinanderset-
extremer Naturereignisse (zum Wasserbedarf zungen abgleiten zu lassen.
in Katastrophensituationen siehe Abbildung
5, Seite 20). Allerdings ist bei sozioökono- a) Schutz vor den Effekten von Katastrophen
mischen Rechten zu beachten, dass Staaten infolge extremer Naturereignisse
nach Art. 2 des Sozialpakts nur im Rahmen
ihrer Möglichkeiten die Paktrechte umsetzen Auf internationaler Ebene finden sich hierzu vor
müssen. Anders als bei bürgerlich-politischen allem politische Willenserklärungen, die aber
Rechten gilt die Verpflichtung, abgesehen von keine rechtliche Bindungswirkung entfalten,
einer stets bestehenden Minimalverpflichtung, wie insbesondere das Sendai-Framework for
also nur relativ zur Kapazität des betreffenden Disaster Risk Reduction 2015 – 2030 (UN-Doc.
Staates. Diese dürfte im Fall von Katastrophen A/Res/69/283) von den Vereinten Nationen.
oft sehr eingeschränkt sein, was die rechtliche Einzig aus allgemeinen Prinzipien, wie dem im
Verpflichtung erheblich abschwächt. Gewohnheitsrecht seit dem Trail Smelter Fall
anerkannten „no-harm“-Prinzip, ergibt sich
Das Menschenrecht auf Wasser verleiht jedem die Verpflichtung eines Staates, keine Umwelt-
Menschen einen Anspruch auf „ausreichendes, schäden auf dem Staatsgebiet anderer Staaten
sicheres, physisch zugängliches und erschwing- anzurichten. In besagtem Fall ging es um ein
liches Wasser für den persönlichen und häusli- Waldsterben auf US-amerikanischem Boden,
chen Gebrauch“ (CESCR 2002, Abs. 2). Daraus verursacht durch erhöhte Schadstoffemissio-
ergeben sich die drei Hauptanforderungen der nen einer Bleischmelze auf der kanadischen
Wasserverfügbarkeit, der Wasserqualität und Seite der Grenze, die in Form von Rauch-
der Wasserzugänglichkeit. Letzteres umfasst schwaden auf der US-amerikanischen Seite
sowohl die physische als auch die wirtschaftli- zu Umweltschäden und vergehenden Ernten
che Zugänglichkeit. Diese Facetten des Rechts führten. Häufig bleibt dieses Prinzip aber ein
auf Wasser haben ihren Ursprung in jeweils zahnloser Tiger, denn insbesondere der Nach-
verschiedenen Kernrechten. Wenn Wasser nicht weis der direkten Kausalität ist oft schwer zu
als Trinkwasser und für andere grundlegende erbringen.
Zwecke zur Verfügung steht, steht das Recht
auf Leben (Artikel 2 des internationalen Paktes Rechtlich ergiebiger sind Grund- und
über bürgerliche und politische Rechte, Zivil- Menschenrechte. Diese entfalten nicht nur
pakt) selbst auf dem Spiel. Wenn Wasser nicht Abwehrrechte gegen staatliche Eingriffe.
die erforderliche Mindestqualität aufweist, Der Staat muss auch vor Gefahren schüt-
gefährdet es das Recht auf Gesundheit (Arti- zen, die er nicht selbst verursacht (wie etwa
kel 12 Sozialpakt). Und wenn sich das Wasser extreme Naturereignisse). Zu dieser staat-
außerhalb einer verhältnismäßigen physischen lichen Schutzverpflichtung vor wasserbe-
oder finanziellen Reichweite befindet, gefährdet dingten Katastrophen hat insbesondere der
es die Erfüllung des Rechts auf einen angemes- Europäische Gerichtshof für Menschenrech-
senen Lebensstandard (Artikel 11 Sozialpakt). te (EGMR) in Auslegung der Europäischen
WeltRisikoBericht 2019 19Wasserbedarf in Katastrophensituationen
Lebensnotwendige Hygiene
Wasseraufnahme Die Mindestmenge ist ab-
Die Mindestmenge ist hängig von Geschlecht,
abhängig von Klima, körperlicher Verfassung
Alter und individueller und kulturellen Normen.
Physiologie.
2,5 – 3 Liter 2 – 6 Liter
Abbildung 5: Wasserbedarf in Katastrophensituationen pro Person pro Tag, unterteilt nach Verwendungszweck
Datenquelle: Sphere Association 2018
Menschenrechtskonvention (EMRK) bereits um dem Klimawandel global entgegenzutre-
ausdrücklich geurteilt. Es kommt bei dieser ten. Nach dem Austritt entscheidender Staa-
Schutzpflicht immer entscheidend auf die ten wurde das Abkommen aber nicht mehr als
Frage an, inwiefern die Verhinderung von adäquat zur Lösung des Problems angesehen.
Gefahren und die Minimierung von Schäden So kam es 2015 zum Pariser Klimaabkommen.
möglich und dem Staat zumutbar war. Im Fall Die Verpflichtungen aus diesem Abkommen
Budayeva vs. Russland (EGMR 15339/02) sind aber nicht-rechtlicher Natur und überlas-
etwa erkannte das Gericht eine Verletzung sen den Staaten größtenteils selbst die Entschei-
von Art. 2 EMRK, nachdem durch eine dung, welche (praktisch meist unambitionier-
Schlammlawine in Tyrnauz acht Menschen ten) Klimaziele sie sich stecken.
gestorben waren. Der Staat hatte Landpla-
nung und Katastrophenschutzmaßnahmen Aus dem europäischen und nationalen Recht
im Tyrnauz Gebiet unterlassen, obwohl die ergeben sich konkretere rechtliche Ansätze.
Anfälligkeit des Gebiets für Schlammlawinen Besonders bekannt geworden ist die Entschei-
bekannt war. Im Fall Kolyandenko vs. Russ- dung des Bezirksgerichts Den Haag von Juni
land (EMGR 17423/05) befanden die Straß- 2015 über die Klage der Umwelt-NGO „Urgen-
burger Richter*innen eine Verletzung von da“, um eine Reduktion der niederländischen
Art. 2 und 8 EMRK, da die Stadt Wladiwos- Treibhausgasemissionen zu erzwingen. Darin
tock den Kanal des Flusses Pionerskaya über wurde der niederländische Staat zu einer
lange Zeit nicht gewartet und Maßnahmen Verringerung der Emissionen um 25 Prozent
versäumt hatte, um Flutgefahren zu verhin- bis 2020 verpflichtet. Dies sei nach Art. 21 der
dern und Schäden zu minimieren. niederländischen Verfassung geboten (Schutz
natürlicher Lebensgrundlagen) und ergäbe sich
b) Verpflichtungen mit Blick auf den zudem aus den oben erwähnten Artikeln 2 und 8
Klimawandel EMRK, die in der niederländischen Rechtsord-
nung zwar nach Auffassung des Bezirksgerichts
Zunächst hatte das Kyoto-Protokoll 1997 viel- nicht direkt angewendet werden können, aber
versprechende rechtliche Ansätze entwickelt, die Auslegung maßgeblichen niederländischen
20 WeltRisikoBericht 2019Wasserbedarf gesamt
7,5 Liter sind das absolute Minimum
des individuellen Wasserbedarfs.
Darauf sollte die Versorgung nur in
Situationen extremer Wasserarmut
beschränkt werden. 15 Liter reichen
aus, um den akut notwendigen
Bedarf zu decken. Bei anhaltenden
Notsituationen sollte die Wasser-
7,5 – 15 Liter
Wasser zum Kochen menge möglichst schnell weiter
Die Mindestmenge ist ab- angehoben werden. Menschen mit
hängig von sozialen und bestimmten Behinderungen oder
kulturellen Normen sowie Erkrankungen (z. B. AIDS) haben
der Art der Nahrungsmittel. einen erhöhten Mindestbedarf.
3 – 6 Liter
Zivilrechts beeinflussen. Die Niederlande unwahrscheinlichere Form von gewalttätigen
wurden insbesondere deswegen verurteilt, weil Wasserkonflikten sind. Wasserkonflikte finden
sie ihren Schutzpflichten gegenüber aktuellen eher innerhalb eines Staates statt (Homer-
und zukünftigen Generationen niederländischer Dixon 1999, 12 – 27).
Staatsbürger*innen nicht ausreichend nachge-
kommen sind. Zwar wird im Urteil kein direkter Einige Studien legen den Schluss nahe, dass
Bezugspunkt zu Wassersicherheit hergestellt, sich verschärfende Wasserknappheit direkt
die Entscheidung muss aber vor dem Hinter- auf die Häufigkeit von Bürgerkriegen auswir-
grund der klimawandelbedingten Flutgefahren ke (Hauge / Ellingson 1998, 299 – 317). Ande-
gesehen werden, von denen die tief gelege- re Forscher*innen kommen zu dem Schluss,
nen Niederlande besonders betroffen wären. dass Ressourcenknappheit (wie Wasser-
Das Urteil wurde mittlerweile von der zweiten knappheit) keinen Einfluss auf Staatsversa-
Instanz bestätigt, wobei das Berufungsgericht gen und Bürgerkrieg habe (Esty et al. 1999),
im Unterschied zur Vorinstanz insbesondere oder dass Niederschlagsmuster und Wasser-
auch direkte Verpflichtungen aus der Europäi- knappheit keinen signifikanten Einfluss auf
schen Menschenrechtskonvention (Art. 2 und interne Konflikte wie Bürgerkriege hätten
Art. 8 EMRK) betont hat. Aktuell wird der Fall (Theisen / Brandsegg 2007). Wieder andere
vor dem niederländischen obersten Gerichtshof Autor*innen behaupten sogar den umgekehr-
verhandelt. ten Effekt, dass etwa Bevölkerungsdichte in
Kombination mit dem Reichtum an erneu-
c) Wasserknappheit als Treiber für bewaffnete erbaren Ressourcen (einschließlich Wasser)
Konflikte das Risiko eines Bürgerkriegs sogar erhöhen
und nicht verringern könne (De Soysa 2002,
Der Begriff „Wasserkriege“ wurde in der Litera- 395 – 416). Die gegenwärtigen Befunde sind
tur und in den Medien gleichermaßen geprägt also uneinheitlich und teilweise sogar wider-
(Rahaman 2012; Leithead 2019), ist aber durch- sprüchlich. Der Schluss liegt nahe, dass Wasser
aus irreführend. Empirische Studien zeigen, die Gefahr eines Konflikts schüren kann, dass
dass zwischenstaatliche Wasserkonflikte die aber gleichzeitig Wasserknappheit auch zu
WeltRisikoBericht 2019 21Sie können auch lesen