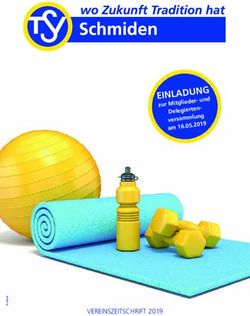Aufbau einer Nord-Süd SchulPartnerschaft - Die Millenniums-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen in der Kommunalen Entwicklungszusammenarbeit ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Aufbau einer
Nord-Süd
SchulPartnerschaft
Die Millenniums-Entwicklungsziele
der Vereinten Nationen in der
Kommunalen EntwicklungszusammenarbeitHerausgeber Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Kreuzberg - San Rafael del Sur, Nicaragua e.V. Büro Naunynstr. 27 10997 Berlin Telefon & Fax 030/ 6110 7370 e-mail info@staepa-berlin.de homepage www.staepa-berlin.de Postanschrift Postfach 11 03 32 10833 Berlin Diese Arbeitsmappe wurde gefördert von der InWent gGmbh & Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen Dezember 2006
Inhalt
Die Millenniums-Entwicklungsziele - The Der Beitrag kommunaler Entwicklungszu-
Millennium Development Goals – MDGs sammenarbeit zum Erreichen der Millen-
Einleitung ................................................. 2 niums-Entwicklungsziele (Millennium De-
velopment Goals MDG) - Konkrete Beispiele
Ziel 1: Beseitigung der extremen Armut und aus der Projektarbeit des Vereins zur Förderung
des Hungers ............................................. 3 der Städtepartnerschaft Kreuzberg-San Rafael
Ziel 2: Verwirklichung der allgemeinen Pri- del Sur e.V.
marschulbildung ...................................... 4 MDG 1 .................................................. 18
Ziel 3: Förderung der Gleichstellung der Ge- MDG 1 ................................................... 21
schlechter und Stärkung der Rolle der Frauen
.................................................................. 5 MDG 2 ................................................... 22
Ziel 4: Senkung der Kindersterblichkeit ..... 6 MDG 3 ................................................... 24
Ziel 5: Verbesserung der Gesundheit von MDG 4 & 5 ........................................... 25
Müttern .................................................... 7 MDG 6 ................................................... 26
Ziel 6: Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria MDG 7 ................................................... 28
und anderen Krankheiten ......................... 8 MDG 8 ................................................... 28
Ziel 7: Sicherung der ökologischen Nachhal-
tigkeit ..................................................... 10
Ziel 8: Aufbau einer weltweiten Entwicklungs- Schulpartnerschaften mit dem Süden
partnerschaft .......................................... 12 Ein Leitfaden .......................................... 29
Das Kennenlernen - Vorschlag für die 5. Klas-
Die Bedeutung der Kommunen in der Ent- se ........................................................... 35
wicklungszusammenarbeit ................. 14 Das Kennenlernen - Vorschlag für die 9. Klas-
se ........................................................... 38
Millenniumserklärung des deutschen
Städtetages ....................................... 17
Städtepartnerschaft und Kommunale Ent- Anhang
wicklungszusammenarbeit .................... 20
Hintergrundinformationen zur Städtepart-
nerschaft Kreuzberg - San Rafael del Sur,
Nicaragua
1. Nicaragua ........................................... 46
2. Geschichte Nicaraguas ....................... 48
3. Die Partnerregion San Rafael del Sur . 52
4. Der Verein zur Förderung der Städtepart-
nerschaft ................................................. 54
5. Trinkwasser ......................................... 58
6. Gesundheit ......................................... 61
7. Bildung ............................................... 64
8. Integrierte Armutsbekämpfung ........... 68
9. P.I.S.A. - Das aktuelle Projekt zur Inte-
grierten Armutsbekämpfung ................... 72
1Die Millenniums-Entwicklungsziele
The Millennium Development Goals – MDGs
Einleitung einmal mehr als Orientierungsrahmen für Strategien,
Programme und für die bessere Koordination der in-
Das neue Jahrhundert begann mit einem beispiel- ternationalen Zusammenarbeit.
losen Bekenntnis zu Solidarität und Entschlossenheit
im Kampf gegen die Armut in der Welt. Im Jahr 2000 Um die Millenniums-Entwicklungsziele zu erreichen,
wurde die Millenniums-Erklärung der Vereinten Na- sind grundlegende Reformen und enorme Anstren-
tionen von der bisher größten Zusammenkunft von gungen in den Entwicklungsländern wie auch auf
Staatschefs verabschiedet. Sie verpflichtete die rei- internationaler Ebene gefordert. Schließlich geht
chen wie die armen Länder alles daran zu setzen, es um ein gemeinsames Bemühen, die Globalisie-
um die Armut zu beseitigen, die menschliche Wür- rung gerecht, sozial und ökologisch zu gestalten. So
de und die Gleichberechtigung zu fördern und Frie- müssen beispielsweise die bestehenden internati-
den, Demokratie und ökologische Nachhaltigkeit onalen Finanz- und Handelssysteme (HIPC-Initia-
zu verwirklichen. Die Führer der Welt versprachen, tive und Doha-Runde der WTO) neu ausgerichtet,
mit vereinten Kräften bis zum Jahr 2015 oder schon die Finanzierung der Entwicklungszusammenarbeit
früher konkrete Zielvorgaben für die Förderung der (Monterrey – Erklärung) verbessert und die nachhal-
Entwicklung und die Verminderung der Armut zu tige Entwicklung (Aktionsplan von Johannesburg)
erreichen. Die aus der Millenniums-Erklärung her- sichergestellt werden.
vorgegangenen Millenniums-Entwicklungsziele aus Armut ist ein multidimensionales Problem. Es erfor-
dem Jahr 2001 verpflichten die Länder dazu, ver- dert Aktivitäten in vielen Bereichen, wie etwa Ernäh-
stärkt gegen unzureichende Einkommen, weit ver- rung, Gesundheit, Bildung, Infrastruktur, die Schaf-
breiteten Hunger, die Ungleichheit zwischen Mann fung von Einkommen, politische und wirtschaftliche
und Frau, Umweltschäden und Mängel bei der Bil- Partizipation. Nur mit umfassenden, ganzheitlichen
dung, der Gesundheitsversorgung und dem Zugang Strategien über die Grenzen der einzelnen Sektoren,
zu sauberem Wasser vorzugehen. Sie enthalten auch Regionen und sozialen Gruppen hinweg kann den
Maßnahmen für den Schuldenabbau, die Erhöhung verschiedenen Dimensionen dieses Problems be-
der Entwicklungshilfe sowie die Ausweitung des gegnet werden. Nachhaltige Ergebnisse sind nur
Handels und des Technologietransfers in die armen zu erzielen, wenn systematische und abgestimmte
Länder. Maßnahmen gesetzt werden, die von multidiszipli-
Anlass dazu gaben die zum Teil enttäuschenden Er- nären Teams mit einem breiten Spektrum an Fach-
gebnisse einer Überprüfung der Programme in den kompetenz erarbeitet werden.
späten 90er Jahren. Dabei zeigten sich – wenn über- Die Millenniums-Entwicklungsziele werden oft da-
haupt – nur geringe Erfolge bei der Bekämpfung von für kritisiert, dass sie nur einen schmalen Ausschnitt
Hunger- und Mangelernährung, der Schaffung von des Aktionsradius der Entwicklungszusammenarbeit
Einkommen und eines Angebots an sozialen Dienst- repräsentieren, unrealistisch seien oder sich auf zu
leistungen wie auch bei der stärkeren wirtschaft- eng gefasste Indikatoren beziehen. Andererseits bie-
lichen und gesellschaftlichen Teilhabe der armen Be- ten sie die Möglichkeit, Prioritäten zu setzen und sich
völkerung. In den vergangenen Jahren sammelten an einem verbindlichen Referenzsystem auszurich-
Partnerländer, Weltbank und UN-Organisationen ten. Eine stärkere Zielgruppenorientierung und eine
verschiedenste Daten, führten Erhebungen durch Analyse der realen Probleme armer Bevölkerungs-
und werteten sie aus, um das Phänomen „Armut“ gruppen stellen bleibende Herausforderungen dar.
besser zu verstehen.
Auf Basis dieser Erkenntnisse setzen die Millen-
niums- Entwicklungsziele der Vereinten Nationen
konkrete Schwerpunkte, um die extreme Armut zu
reduzieren. Die meisten dieser Ziele sind nicht neu.
Sie sind unter anderem in den Aktionsplänen der
verschiedenen Weltkonferenzen enthalten. In die-
sem Sinn dienen die Millenniums-Entwicklungsziele
2Die Millenniums-Entwicklungsziele
The Millennium Development Goals – MDGs
Ziel 1: eingeführt, die heute allgemein anerkannt ist. Da-
nach sind alle Menschen arm, die weniger als einen
Beseitigung der ex- US-Dollar pro Tag zur Verfügung haben. Mehr als
tremen Armut und eine Milliarde Menschen auf der Welt müssen von
weniger als einem Dollar pro Tag leben. Weitere 2,7
des Hungers Milliarden haben weniger als zwei Dollar pro Tag
zum Überleben.
Zielvorgabe 1:
Eine der wohl radikalsten Formen der Armut ist der
Zwischen 1990 und 2015 den Anteil der Hunger. Weltweit hungern über 850 Millionen Men-
Menschen halbieren, deren Einkommen schen. Sie haben keine Chance, den notwendigen
weniger als 1 Dollar pro Tag beträgt. täglichen Energiebedarf von mindestens 1.800 kcal
zu decken. Darunter sind 300 Millionen Kinder, die
Indikatoren:
Tag für Tag hungrig zu Bett gehen. Alle 3,6 Sekun-
1. Anteil der Bevölkerung mit weniger als 1 Dollar den verhungert ein Mensch; die große Mehrzahl
pro Tag sind Kinder unter 5 Jahren.
2. Armutslückenverhältnis (Armutsinzidenz x Ar- Die Fortschritte bei der Bekämpfung des Hungers
mutstiefe) werden am Anteil der Bevölkerung gemessen, dem
weniger als dieses Minimum der existenziell notwen-
3. Anteil des ärmsten Fünftel am nationalen Ver- digen Nahrungsenergie zur Verfügung steht. Ein
brauch weiterer Indikator ist die Rate der Kinder unter fünf
Jahren, die Untergewicht haben
Zielvorgabe 2:
Hunger und Armut beeinflussen sich wechselseitig.
Zwischen 1990 und 2015 den Anteil der Arme Menschen haben keine Einkommens- und kei-
Menschen halbieren, die Hunger leiden. ne Produktionsmöglichkeiten, um sich ausreichend
Indikatoren: zu versorgen. Unzureichend ernährten Menschen
fehlt es an der Fähigkeit und der Kraft, um der Ar-
4. Prävalenz des Untergewichts bei Kindern unter mutsfalle zu entkommen und ihr Leben umfassend
fünf Jahren selbst zu gestalten.
5. Anteil der Bevölkerung unter dem Mindestniveau Nahrungsmittel gibt es genug auf der Welt, doch sie
des Nahrungsenergieverbrauchs sind extrem ungleich verteilt. Die natürlichen Res-
sourcen wären ausreichend, um auch bei wachsen-
der Bevölkerung Nahrung für alle zu produzieren.
Die Beseitigung von extremer Armut und Hunger
ist das erste der acht Millenniums-Entwicklungsziele Hunger und Unterernährung haben nicht unbedingt
und ebenso das umfassendste. Fortschritte bei der mit einem allgemeinen Mangel zu tun. Vielmehr fehlt
Erreichung dieses Ziels tragen auch zur Annäherung armen Bevölkerungsgruppen der Zugang zu Nah-
an weitere Millenniums-Entwicklungsziele bei, die rungsmitteln in ausreichender Quantität und Quali-
sich auf unterschiedliche Ausprägungen von Armut tät, um ein aktives und gesundes Leben zu führen.
beziehen.
Hunger und Unterernährung schwächen Körper und
Armut ist schwer zu definieren. Armut bedeutet nicht Immunsystem. Schlechte Gesundheitsversorgung,
nur geringes Einkommen, sondern auch geringe schmutziges Wasser, keine sanitären Einrichtungen
Beteiligungsmöglichkeiten am wirtschaftlichen und sowie mangelnde Information und Ausbildung ver-
politischen Leben, Gefährdung durch Risiken, Miss- schärfen diese Situation: Wer arm ist, wird eher
achtung der Menschenwürde und der Menschen- krank und stirbt früher.
rechte sowie fehlender Zugang zu lebenswichtigen
Ressourcen. Nur um einen gemeinsamen Maßstab Bildung wird allgemein als wesentliche Vorausset-
zu haben, hat die Weltbank die Ein-Dollar-Definition zung für Entwicklung betrachtet. Doch es gibt laut
3Die Millenniums-Entwicklungsziele
The Millennium Development Goals – MDGs
UNICEF weltweit fast eine Milliarde Analphabeten Ziel 2:
unter den Erwachsenen und 121 Millionen Kinder,
davon 65 Millionen Mädchen, haben keinen Zu- Verwirklichung der
gang zu Bildung. Zusätzlich werden 150 Millionen allgemeinen Pri-
die Primarschule wahrscheinlich nicht abschließen.
Im Durchschnitt werden in den Entwicklungsländern marschulbildung
zwar etwa 80 Prozent der Kinder im schulpflichtigen
Alter eingeschult, doch die Abbrecherquoten sind Zielvorgabe 3:
hoch und die regionalen Unterschiede sehr groß. Bis zum Jahr 2015 sicherstellen, dass
Insbesondere den Mädchen und Frauen bleibt so Kinder in der ganzen Welt, Jungen wie
der Zugang zu Bildung häufig verwehrt.
Mädchen, eine Primarschulbildung voll-
ständig abschließen können
Indikatoren:
1. Nettoeinschulungsquote im Primarschulbereich
2. Anteil der Erstklässler, die das fünfte Schuljahr er-
reichen
3. Alphabetisierungsquote bei den 15- 24-Jährigen
Um Abhilfe zu schaffen hat die UNO die Beseitigung
des Bildungsdefizits in den Entwicklungsländern zu
einer Priorität erklärt. Das zweite Millenniumsziel be-
inhaltet die Sicherstellung des Primarschulbesuchs
aller Kinder, sowohl Jungen als auch Mädchen, bis
2015. Der Schulbesuch ist in vielen armen Ländern
der Welt teuer: Für viele Familien sind Schulgebühren
und Kosten für Schuluniformen unerschwinglich.
Gerade in Ländern, in denen sehr große Anteile
der Bevölkerung als arm einzustufen sind, wäre ein
kostenloser Zugang zu Bildung äußerst notwendig,
damit alle Kinder zumindest die Grundschule besu-
chen können. Internationale Geldgeber wie die Welt-
bank knüpfen jedoch an Kredite für Länder in Asien,
Lateinamerika und Afrika die Bedingung, dass die
öffentlichen Ausgaben des Landes (für Bildung wie
auch Gesundheit etc) stark gekürzt bzw. gestrichen
werden. Damit sinken die Chancen für Kinder aus
armen sozialen Schichten, eine Grundbildung zu be-
kommen, gravierend. Auch behinderte Kinder sind
größtenteils von Bildungsmöglichkeiten ausgeschlos-
sen. Bildung ist jedoch die Grundvoraussetzung für
Menschen, ihre soziale, kulturelle, gesellschaftliche
und wirtschaftliche Situation zu verstehen. Sie er-
möglicht es ihnen, selbst Einfluss zu nehmen auf Er-
nährung und Gesundheit, auf Geburtenraten oder
Kindersterblichkeit und damit die eigene Lebenssi-
tuation zu verbessern. Deshalb müssen alle Kinder
4Die Millenniums-Entwicklungsziele
The Millennium Development Goals – MDGs
im schulpflichtigen Alter die Möglichkeit haben, zu- Ziel 3:
mindest eine Grundschule zu besuchen und Frauen
müssen die gleichen Bildungschancen eingeräumt Förderung der
werden wie Männern. Gleichstellung der
Geschlechter und
Stärkung der Rolle
der Frauen
Zielvorgabe 4:
Das Geschlechtergefälle in der Primar-
und Sekundarschulausbildung beseiti-
gen, vorzugsweise bis 2005 und auf allen
Bildungsebenen bis spätestens 2015
Indikatoren:
Oft haben Familien aber nicht nur kein Geld für 6. Verhältnis Mädchen/Jungen in der Primar-, Se-
Schulkosten, sondern sie sind sogar darauf ange- kundar- und Tertiärausbildung
wiesen, dass auch die Kinder arbeiten und Geld
verdienen, um das Überleben der Familie bestreiten 7. Verhältnis weibliche/männliche Alphabeten (15-
zu können. Diesbezüglich hat die Globalisierung der 24-Jährige)
letzten Jahrzehnte die Situation oft noch verschärft:
8. Anteil der Frauen an den nichtselbständigen Er-
Die Strategie der Konzerne, mit Verlagerung eines
werbstätigen im Nicht-Agrarsektor
Standortes zu drohen, verstärkt den Druck auf die
Arbeiter/innen ernorm und drückt ihre Löhne weiter 9. Sitzanteil der Frauen in nationalen Parlamenten
nach unten. Wenn das Einkommen der Erwachse-
nen aber nicht zum Überleben reicht, müssen auch
Kinder Geld verdienen. Eine Maßnahme zur Re- Extreme Armut ist weiblich, mehr Frauen als Männer
duzierung von Kinderarbeit und Ermöglichung des leben von der Hand in den Mund. Etwa eine halbe
Grundschulbesuches ist daher die Verbesserung der Milliarde Frauen in Entwicklungsländern haben kein
Einkommenssituation für die Erwachsenen. angemessenes Einkommen, keine medizinische Ver-
sorgung und Sicherheit. Mit verheerenden Folgen:
Neben der Grundbildung muss die Alphabetisierung Jährlich sterben z. B. mehr als eine halbe Million
von Jugendlichen und Erwachsenen gefördert wer- Frauen während der Schwangerschaft oder Geburt.
den. Zwar ist zwischen 1970 und 2000 die Rate der
Analphabeten weltweit von 37 auf 20% gesunken, Frauen in Entwicklungsländern arbeiten schwer, um
trotzdem gibt es immer noch rund 862 Millionen sich und ihre Familien zu versorgen und werden
Jugendliche und Erwachsene, die nicht lesen und dennoch gesellschaftlich, rechtlich und wirtschaft-
schreiben können. 98% der Analphabeten leben in lich benachteiligt. Gerade Frauen aber spielen für
Entwicklungsländern, davon sind 64% Frauen. Die die nachhaltige Entwicklung armer Länder eine ent-
Bevölkerung der ländlichen Regionen ist stärker vom scheidende Rolle. Genderfragen und die Gleichstel-
Analphabetismus betroffen als die der städtischen lung von Frauen und Männern sind daher wichtige
Gebiete. internationale Anliegen. UN-Generalsekretär Kofi
Annan betont, dass die Stärkung von Frauen zen-
Die Fortschritte zu diesen Zielen werden an den Ein- trales Ziel der internationalen Entwicklungszusam-
schulungsquoten, an dem Anteil der SchülerInnen, menarbeit sein müsse. Nur wenn die Bedürfnisse
die die fünfte Klasse der Grundschule abschließen und Prioritäten von Frauen berücksichtigt werden,
und an der Alphabetisierungsquote der Jugend- könnten die Millenniums-Entwicklungsziele erreicht
lichen von 15 bis 24 Jahren gemessen. werden:
5Die Millenniums-Entwicklungsziele
The Millennium Development Goals – MDGs
„Keine andere politische Maßnahme hat ein höheres Ziel 4:
Potenzial, die wirtschaftliche Produktivität zu steigern
oder die Kinder- und Müttersterblichkeit zu senken, Senkung der Kin-
oder kann mit so großer Sicherheit Ernährung und dersterblichkeit
Gesundheit fördern, einschließlich der Prävention von
HIV/AIDS. Keine andere Maßnahme hat sich wirksamer
erwiesen, die Chancen der kommenden Generationen Zielvorgabe
auf Bildung zu erhöhen.“ (Kofi Annan, März 2005 ) 5:
Zwischen 1990 und 2015 die Sterblich-
Wenn das Potenzial der Frauen nicht ausgeschöpft und keitsrate von Kindern unter fünf Jahren
die Geschlechtergerechtigkeit nicht verbessert wird, kön-
um zwei Drittel senken
nen die anderen Millenniumsziele nicht erreicht werden.
Obwohl Ausbildung das einzige offizielle Ziel ist („Be- Indikatoren:
seitigung der Geschlechterunterschiede bei der Primar-
und Sekundarschulbildung, möglichst bis 2005, und auf 10. Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren
allen Bildungsebenen bis 2015“), das zur Bewertung 11. Säuglingssterblichkeitsrate
des Fortschritts hinsichtlich des Ziels der Gleichberech-
tigung der Geschlechter herangezogen wird, haben sich 12. Anteil der Einjährigen, die gegen Masern geimpft
verschiedene weitere Indikatoren zur Beurteilung der wurden
Fortschritte etabliert:
· Das Verhältnis von Mädchen zu Jungen in der Grund-
schul-, weiterführenden Schul- und Hochschulausbil- Im südlichen Afrika sterben noch immer 17 Prozent der
dung Kinder vor dem sechsten Lebensjahr. Laut UNO-Ent-
wicklungsbericht werden zwar insgesamt Fortschritte bei
· Das Verhältnis alphabetisierter weiblicher und männ-
der Verringerung der Kindersterblichkeit verzeichnet.
licher 15–24 Jähriger.
Aber beim gegenwärtigen Tempo würde in Afrika süd-
· Der Anteil von Frauen an bezahlten Arbeitsplätzen au- lich der Sahara die angestrebte Senkung um zwei Drittel
ßerhalb der Landwirtschaft. erst in 150 Jahren erreicht werden.
· Der Anteil von Frauen in nationalen Parlamenten. Um das Millenniums-Entwicklungsziel 4 zu erreichen,
muss gegen die Hauptursachen der Kindersterblich-
Geschlechtergleichberechtigung in der Ausbildung hilft keit vorgegangen werden. Mangelernährung und un-
Frauen dabei, einen Arbeitsplatz außerhalb des eige- zureichende medizinische Versorgung ergänzen sich
nen Haushalts und politische Macht zu erlangen. Aber in vielen Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas
Geschlechtergleichberechtigung muss sich auch auf den zu einer tödlichen Spirale: Kinder ohne gesunde und
privaten Bereich erstrecken. ausreichende Ernährung werden leichter krank, Krank-
heiten greifen einen bereits geschwächten Körper be-
Geschlechterbeziehungen werden großenteils durch
sonders heftig an, und ohne Arzt und Medikamente
soziale und kulturelle Verhältnisse bestimmt. Patriarcha-
führen selbst harmlosere oder leicht behandelbare In-
lische Werte aus der Kindheit beeinflussen die Einstel-
fektionskrankheiten zum Tod. Jeden Tag sterben auf
lungen und Ansichten sowohl von Frauen als auch von
diese Weise etwa 32.000 Kinder an den Folgen von
Männern ihr ganzes Leben lang. Diese Werte manife-
Armut und Unterernährung. Das sind fast 11 Millionen
stieren sich oft in Gesetzen, die die Rechte und Ansprü-
Kinder pro Jahr.
che von Frauen beschränken – insbesondere wenn es
um Ehe, Scheidung, Vergewaltigung, Gewalt und Erb- Die Mangelernährung der Neugeborenen hängt in der
schaftsrecht geht. Regel mit dem schlechten Ernährungszustand der Müt-
ter zusammen. Einseitige oder unzureichende Ernäh-
Heute unterminiert die fehlende Gleichberechtigung
rung der Frauen wirkt sich auf die Reichhaltigkeit ihrer
das Potenzial der Frauen in Bildung und Gesundheit.
Milch während der Stillphase aus. Dadurch beginnen
Beim gegenwärtigen Fortschrittstempo wird die Gleich-
viele Kinder ihr Leben bereits mit einem deutlichen Ent-
heit der Geschlechter nicht vor 2025 erreicht werden.
6Die Millenniums-Entwicklungsziele
The Millennium Development Goals – MDGs
wicklungsrückstand. Später wird Mangelernährung Ziel 5:
oft auch durch Durchfallerkrankungen oder Darm-
parasiten hervorgerufen oder verschlimmert. Die Verbesserung der
Folgen betreffen den gesamten Organismus: die na- Gesundheit von
türliche Ausbildung des Immunsystems wird verhin-
dert, das Wachstum gehemmt und die Entwicklung Müttern
und Lernfähigkeit beeinträchtigt.
Zielvorgabe 6:
Die Hauptursachen für die Sterblichkeit von Kindern
unter fünf Jahren sind noch immer Atemwegsinfek- Zwischen 1990 und 2015 die Mütter-
tionen (18 Prozent) und Durchfallerkrankungen (15 sterblichkeitsrate um drei Viertel senken
Prozent). Malaria und Masern folgen mit 10 und 5 Indikatoren:
Prozent. In vielen Ländern steigt die Kindersterblich-
keit in den vergangenen Jahren deutlich an aufgrund 13. Müttersterblichkeitsrate
der AIDS-Pandemie. Obwohl ihr weltweit nicht mehr
als 4 Prozent der Kindersterblichkeit zuzurechnen ist, 14. Anteil der von medizinischem Fachpersonal be-
führt sie in einigen Regionen zu Kindersterblichkeits- gleiteten Geburten
raten, wie sie zuletzt vor 30 Jahren verzeichnet wer-
den mussten. Die Gesundheit von Frauen, einschließlich der se-
xuellen und reproduktiven Gesundheit ist ein Men-
Rund zwei Drittel der Todesfälle im Kindesalter
schenrecht. Dennoch sterben jedes Jahr immer
könnten durch angemessene, einfache medizinische
noch über 500.000 Frauen auf Grund von Kom-
Maßnahmen wie Impfungen und Reihenbehand-
plikationen während Schwangerschaft und Geburt.
lungen verhindert werden. Auch bei den häufigen
Dreißig Mal mehr Frauen leiden unter Verletzungen,
therapeutischen Routinefällen betragen die Kosten
Infektionen oder anderen Komplikationen, die mit
oft nur wenige Euro pro Patient. Aber besonders in
einer Schwangerschaft in Zusammenhang stehen.
den ärmsten Ländern erreichen die Gesundheits-
99 Prozent der Todesfälle treffen Frauen in Entwick-
dienste zu wenige Menschen, und selbst für kosten-
lungsländern. In einigen Entwicklungsländern tragen
günstige Arzneimittel fehlt vielen Familien das Geld.
Frauen ein Risiko von eins zu 16, bei der Geburt zu
Ein funktionierendes Gesundheitssystem, dass die
sterben. In Deutschland ist dieses Risiko geringer als
Zahl der Stellen, wo medizinische Hilfe geleistet wird,
eins zu 2.000.
in unterversorgten Gebieten erhöht, ist daher eine
entscheidende Voraussetzung, um gegen vermeid- Konkrete Ursachen für hohe Mütter- und Schwan-
bare Ursachen der Kindersterblichkeit vorzugehen. gerensterblichkeit sind der eingeschränkte Zugang
zu reproduktiven Dienstleistungen und damit ein-
hergehend der Mangel an Aufklärung, an Verhütung
und an medizinischer Betreuung für Schwangere.
Nur etwa die Hälfte aller Frauen entbindet mit Hilfe
eines Arztes oder einer Hebamme, in Afrika südlich
der Sahara sinkt der Anteil auf 39 Prozent und im
südlichen Asien auf 36 Prozent.
Schwangerschaftsabbrüche unter gesundheitsge-
fährdenden Bedingungen sind eine weitere Ursa-
chen. Jährlich lassen weltweit ca. 46 Millionen wer-
dende Eltern abtreiben, 18 Millionen davon wenden
sich an nicht qualifizierte Personen. Ungefähr 68.000
Frauen sterben dabei.
Weitere Ursachen hoher Schwangeren- und Müt-
tersterblichkeit liegen in der Diskriminierung und
7Die Millenniums-Entwicklungsziele
The Millennium Development Goals – MDGs
Unterdrückung von Frauen. Viele besitzen nur ein- Ziel 6:
geschränkte Möglichkeiten, über Sexualität, Fa-
milienplanung oder medizinische Versorgung zu Bekämpfung von
entscheiden. Ungewollte Schwangerschaften in Ver- HIV/AIDS, Malaria
bindung mit sexueller Gewalt sind ein Folgeproblem.
Verschärfend wirkt sich in solchen Gesellschaften die und anderen Krank-
AIDS-Epidemie aus. heiten
Ein weiterer Grund ist die allgemeine Armut, in de-
ren Folge viele Menschen keinen Zugang zu ärzt- Zielvorgabe 7:
licher Hilfe oder Arzneimitteln besitzen. Bis 2015 die Ausbreitung von HIV/AIDS
zum Stillstand bringen und allmählich
Um das Millenniumsentwicklungsziel 5 zu erreichen,
müssen die Entwicklungsländer den Zugang zu qua- umkehren
lifizierter Geburtshilfe, zur Notfallversorgung bei Ent- Indikatoren:
bindungen und zur Versorgung im Bereich reproduk-
tive Gesundheit ausweiten, indem sie diese Dienste 15. HIV-Prävalenz bei schwangeren Frauen (15- bis
in einem funktionierenden Gesundheitssystem zu- 24-Jährige)
sammenfassen. Dazu gehören auch Maßnahmen
zur Familienplanung und Persönlichkeitsbildung. 16. Anteil der Kondombenutzung innerhalb der kon-
Unabhängig von Geschlecht und Familienstand sol- trazeptiven Prävalenzrate
len Frauen und Männer über die Zahl ihrer Kinder a. Kondombenutzung beim letzten, risikoreichen
und die Geburtenabstände frei entscheiden können, Geschlechtsverkehr
unerwünschte Schwangerschaften und Schwan-
gerschaftsabbrüche vermeiden können. Allein den b. Prozentsatz der 15- 24-Jährigen mit umfassenden
Zugang zu Verhütungsmitteln zu erhöhen, kann die korrekten Kenntnissen über HIV/AIDS
Müttersterblichkeit wesentlich senken, indem einfach
17. Schulbesuchsquote von Waisen im Verhältnis zu
die Zahl der Schwangerschaften pro Frau reduziert
Nichtwaisen (10- 14-Jährige)
wird – und damit das Risiko der damit zusammen-
hängenden Komplikationen. Wenn der ungedeckte
Bedarf an Verhütungsmitteln gedeckt würde und Zielvorgabe 8: Bis 2015 die Ausbrei-
Frauen nur die Anzahl der Schwangerschaften in den tung von Malaria und anderen schweren
Abständen hätten, in denen sie es wollen, würde die Krankheiten zum Stillstand bringen und
Müttersterblichkeit um 20 bis 35 Prozent sinken. allmählich umkehren
Indikatoren:
18. Malariaprävalenz und Sterblichkeitsraten im Zu-
sammenhang mit Malaria
19. Anteil der Bevölkerung in malariagefährdeten
Gebieten, der wirksame Malariaverhütungs- und
–bekämpfungsmaßnahmen ergreift
20. Tuberkuloseprävalenz und Sterblichkeitsraten im
Zusammenhang mit Tuberkulose
21. Anteil der diagnostizierten und mit Hilfe der
direkten überwachten Kurzzeittherapie DOTS (Di-
rectly Observed Treatment Short Course) geheilten
Tuberkulosefälle
8Die Millenniums-Entwicklungsziele
The Millennium Development Goals – MDGs
HIV/AIDS, Malaria und andere schwere Krankheiten In Afrika südlich der Sahara sind in der Altersgrup-
fordern jährlich mehr als sechs Millionen Menschen- pe von 15 bis 24 Jahren Frauen dreimal häufiger
leben. Damit stellen sie neben kriegerischen Kon- von Neuinfektionen betroffen als Männer. Gründe
flikten und Naturkatastrophen eine der größten Be- für die hohen Infektionsraten bei jungen Frauen sind
drohungen der Menschheit dar. mangelndes Wissen über HIV/AIDS und seine Über-
tragung sowie der Anspruch von Männern, über
Seit über 20 Jahren verbreitet sich HIV/AIDS auf Frauen verfügen zu können. Frauen werden häufig
der Welt. Inzwischen tragen mehr als 40 Millionen durch Partner infiziert, deren Sexualverhalten sie
Menschen das HI-Virus in sich, mehr als 30 Milli- wenig oder gar nicht kontrollieren können. Sexuelle
onen sind bereits an AIDS gestorben, 14 Millionen Gewalt gegen Frauen erhöht die HIV-Rate.
Kinder verloren durch die Krankheit Mutter, Vater
oder beide Eltern, jede Minute infizieren sich acht Einen Impfstoff gegen HIV und AIDS gibt es bis-
bis zehn Menschen neu. Fast 95 Prozent der Betrof- her nicht. Zur Zeit können Menschen mit HIV nur
fenen leben in Entwicklungsländern, davon mehr als mit antiretroviralen Medikamenten (ARV) behan-
drei Viertel allein in Afrika südlich der Sahara. delt werden. Diese Medikamente können zwar die
Krankheit nicht heilen, sie unterdrücken jedoch die
HIV/AIDS führt nicht nur zu menschlichen Kata- Virusvermehrung und können das Auftreten oppor-
strophen, sondern ist inzwischen in vielen Ländern tunistischer Infektionen erheblich verringern. ARV-
auch zu einem gravierenden Entwicklungsproblem Medikamente kosten in den Industrieländern pro
geworden, das alle Lebensbereiche berührt. In ei- Patient zwischen 10.000 und 15.000 US-Dollar im
nigen Ländern ist etwa ein Drittel der Erwachsenen Jahr. Bedingt durch internationalen Druck und Kon-
infiziert, so dass die Pandemie sich dort auf die gan- kurrenz durch Generika, hat die Pharmaindustrie
ze Gesellschaft auswirkt. die Preise für antiretrovirale Medikamente in afri-
Nach Schätzungen der Ernährungs- und Landwirt- kanischen Ländern um bis zu 90 Prozent gesenkt.
schaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) Damit sind sie jedoch für die meisten Aidskranken
wird AIDS bis zum Jahr 2020 ein Fünftel der land- immer noch zu teuer.
wirtschaftlichen Arbeitskräfte in Ostafrika und im Malaria und Tuberkulose gehören zu den Infektions-
südlichen Afrika fordern. Erkrankt oder stirbt ein krankheiten, die insbesondere in Entwicklungslän-
Erwachsener, verliert die Familie häufig die Per- dern eine der Haupttodesursachen bei Erwachse-
son, die für den Unterhalt sorgte; gleichzeitig wird nen darstellen.
das Familienbudget durch die Pflegekosten und die
Beerdigung stark belastet. Im Durchschnitt gibt ein Jedes Jahr infizieren sich 500 Millionen Menschen
betroffener Haushalt ein Drittel seines monatlichen – fast zehn Prozent der Weltbevölkerung – mit Ma-
Einkommens für die Pflege und medizinische Ver- laria, und über eine Million sterben daran. 90 Pro-
sorgung aidskranker Angehöriger aus. Viele Haus- zent dieser Todesfälle verzeichnet man in Afrika, am
halte verarmen und verschulden sich dadurch. häufigsten sind Kinder unter fünf Jahren betroffen.
Besonders gefährdet sind auch schwangere Frauen.
Ohne medikamentöse Behandlung mit antiretrovi- Die Infektion kann das Kind im Mutterleib töten,
ralen Medikamenten wird HIV/AIDS nach Schät- eine Frühgeburt verursachen oder bewirken, dass
zungen bis zum Jahr 2010 das Leben von 48 Mil- das Kind mit Blutarmut oder Untergewicht zur Welt
lionen Erwerbstätigen fordern. Bis zum Jahr 2015 kommt. Der wirksamste Schutz gegen Malaria be-
könnte diese Zahl auf 74 Millionen ansteigen. Im steht in der Prävention durch den Gebrauch von
südlichen Afrika stellen viele Betriebe infolge von Moskitonetzen, die mit Insektiziden behandelt sind.
HIV/AIDS schon einen Rückgang ihrer Umsätze fest. In immer mehr Ländern werden daher Schutznetze
Eine Reihe großer Unternehmen entwickeln daher bei Schwangerschafts-Vorsorgeuntersuchungen ver-
eigene Aids-Präventionsprogramme. teilt.
Weltweit sind rund die Hälfte der Menschen mit HIV Fünfzig Jahre nach der Einführung einer wirksamen
Frauen. Und rund um den Globus nimmt die Zahl Chemotherapie sterben noch immer fast zwei Millio-
der weiblichen HIV-Infizierten überproportional zu. nen Menschen pro Jahr an Tuberkulose. Dies macht
9Die Millenniums-Entwicklungsziele
The Millennium Development Goals – MDGs
die Tuberkulose neben AIDS zu der Infektionskrank- Ziel 7:
heit, an der weltweit die meisten Erwachsenen ster-
ben, und sie fordert eine zunehmende Zahl von Sicherung der öko-
Todesopfern. Von 1997 bis 1999 stieg die Zahl der logischen Nachhal-
neuen Tuberkulose-Fälle von 8,0 auf 8,4 Millionen.
Wenn dieser Trend anhält, wird die Tuberkulose bis tigkeit
über das Jahr 2015 hinaus zu den Haupttodesursa-
chen bei Erwachsenen zählen. Zielvorgabe 9:
Besondere Sorgen bereitet die Anfälligkeit von Men- Die Grundsätze der nachhaltigen Ent-
schen mit der Immunschwächekrankheit AIDS für wicklung in einzelstaatliche Politiken
Tuberkulose. 70 Prozent der Menschen, die mit TB und Programme einbauen und den Ver-
infiziert sind, haben auch AIDS. lust von Umweltressourcen umkehren
Es ist jedoch möglich, diesen Trend umzukehren. Indikatoren:
Die im Jahr 2000 gegründete Partnerschaftsinitiative 22. Anteil der Flächen mit Waldbedeckung
„Stop TB“ hat bemerkenswerte Fortschritte bei der
Formulierung eines Plans gemacht, die Ausbreitung 23. Verhältnis der geschützten Flächen zur Erhaltung
der Tuberkulose zum Stillstand zu bringen. Dieser der biologischen Vielfalt zu der Gesamtfläche
Plan umfasst auch den vollständigen finanziellen
Bedarf, um die internationalen Zielvorgaben zu er- 24. Energieverbrauch (Kilogramm Erdöläquivalent)
reichen. In diesem Rahmen wird dazu aufgerufen, pro 1 Dollar BIP (PPP)
die Kurzzeitbehandlung unter Direktbeobachtung 25. Kohlendioxidausstoß pro Kopf und Verbrauch
DOTS (directly observed therapy short-course) zu von ozonabbauenden Fluorchlorkohlenwasserstof-
verbreiten, anzupassen und zu verbessern. DOTS fen /ODP-Tonnen)
ist ein bemerkenswert wirkungsvolles Programm, in
dem die Gesundheitshelferinnen und –helfer wäh- 26. Anteil der feste Brennstoffe nutzenden Bevölke-
rend der Überwachung des Behandlungsablaufs ih- rung
ren Patienten eng verbunden sind.
Zielvorgabe 10:
Bis 2015 den Anteil der Menschen um
die Hälfte senken, die keinen nachhal-
tigen Zugang zu hygienischem Trinkwas-
ser haben
Indikatoren:
27. Anteil der städtischen und ländlichen Bevölke-
rung mit nachhaltigem Zugang zu einer verbesserten
Wasserquelle
28. Anteil der städtischen und ländlichen Bevölke-
rung mit Zugang zu verbesserter Sanitärversorgung
Zielvorgabe 11:
Bis 2020 eine erhebliche Verbesserung
der Lebensbedingungen von mindestens
100 Millionen Slumbewohnern herbei-
führen
10Die Millenniums-Entwicklungsziele
The Millennium Development Goals – MDGs
Indikatoren: mut leben, sind auf mangelnde Wasserversorgung
und Hygiene zurückzuführen. Rund 3,1 Millionen
29. Anteil der Haushalte mit sicheren Nutzungs- und Menschen sterben nach Angaben der Weltgesund-
Besitzrechten heitsorganisation WHO jedes Jahr an Krankheiten,
die durch verunreinigtes Wasser verursacht sind.
Ökologische Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Schlüs- Durchfallerkrankungen wie Ruhr, Typhus und Cho-
sel für eine bessere Zukunft. Es besteht ein enger lera gehören bei Kindern unter fünf Jahren zu den
Zusammenhang zwischen Umweltzerstörung und häufigsten Todesursachen. Krankheiten aus ver-
Armut. Wo die Armut groß ist, kommt es auch schmutztem Wasser sind Armutskrankheiten.
zu hohen Umweltschäden. Um an Feuerholz und Die Oberfläche der Erde besteht zwar zum größten
Ackerland zu kommen, betreiben arme Menschen Teil aus Wasser, jedoch sind nur 2,5 Prozent davon
Raubbau an ihrer Umwelt. Sauberes Wasser fehlt Süßwasser. Weltweit wird zudem wesentlich mehr
vielerorts. Müll und Abwasser landen in der unmit- Grundwasser verbraucht als durch Niederschläge
telbaren Umgebung oder im nächsten Fluss. Weil wieder aufgefüllt werden kann. 95 Prozent aller Ab-
sie keine andere Wahl haben, gefährden arme Men- wässer aus Industrie und Landwirtschaft fließen un-
schen häufig ihre eigene Lebensgrundlage – und die geklärt in Seen und Flüsse. Trinkbares Wasser wird
ihrer Nachkommen. immer knapper.
Waldökosysteme haben wesentlichen Einfluss auf
das Klima und auf die Wasserkreisläufe. Sie beher-
bergen viele Arten von Pflanzen und Tieren, womit
sie entscheidend zur biologischen Vielfalt auf der
Erde beitragen. Wälder sind zudem die größten
oberirdischen Kohlenstoffspeicher. Daher werden
mit der Vernichtung dieser Ökosysteme große Men-
gen an Kohlendioxid freigesetzt, was zum Abbau der
Ozonschicht beiträgt.
Der weltweit fortschreitende Verlust von Waldflä-
chen ist daher besorgniserregend. Ihr Flächenanteil
in den Entwicklungsländern ist von 28,1 Prozent im
Jahr 1990 auf 26,8 Prozent im Jahr 2000 gesunken.
Ursachen für den Rückgang gibt es viele: staatliche
Strukturschwächen, mangelnder politischer Wille,
Armut, unsichere Bodenrechte und Landnutzungs-
konflikte gehören dazu. Vor allem in den Tropen
wird viel Wald illegal abgeholzt. Verminderte Boden-
qualität, zurückgehende Ernteerträge sowie das Ab-
sinken des Grundwasserspiegels sind häufig Folgen,
die vor allem die Armen treffen.
Mehr als eine Milliarde Menschen in den Entwick-
lungsländern – also jeder Fünfte - hat keinen Zugang
zu sauberem Wasser. 2,4 Milliarden fehlt der Zugang
zu einer ausreichenden Sanitärversorgung. Am
stärksten betroffen sind die armen Bewohner länd-
licher Gebiete und in Elendssiedlungen. Dabei gibt
es preiswerte technische Lösungen wie geschützte
Schachtbrunnen oder einfache Grubenlatrinen.
Die meisten Krankheiten von Menschen, die in Ar-
11Die Millenniums-Entwicklungsziele
The Millennium Development Goals – MDGs
Ziel 8: 30. Öffentliche Netto-Entwicklungshilfe, insgesamt
und für die am wenigsten entwickelten Länder, als
Aufbau einer welt- prozentualer Anteil am Brutto-Nationaleinkommen
weiten Entwick- der Geber, die dem OECD-Ausschuss für Entwick-
lungshilfe (DAC) angehören
lungspartnerschaft
31. Anteil der gesamten bilateralen, sektoral auf-
schlüsselbaren öffentlichen Entwicklungshilfe der
Zielvorgabe 12:
OECD/DAC-Geber für die soziale Grundversorgung
Ein offenes, regelgestütztes, bere- (Grundbildung, Basisgesundheitsversorgung, Er-
chenbares und nicht diskriminie- nährung, sauberes Wasser und Sanitärversorgung)
rendes Handels- und Finanzsystem
weiterentwickeln(Dies umfasst ein 32. Anteil der ungebundenen bilateralen öffent-
Bekenntnis zu guter Regierungs- und lichen Entwicklungshilfe der OECD/DAC-Geber
Verwaltungsführung, Entwicklung und 33. Von Binnenländern empfangene öffentliche
Armutsminderung auf nationaler und Entwic lungshilfe als Anteil an ihrem Brutto-Natio-
internationaler Ebene) naleinkommen
34. Von kleinen Inselentwicklungsländern emp-
Zielvorgabe 13: fangene öffentliche Entwicklungshilfe als Anteil an
Den besonderen Bedürfnissen der am ihrem Brutto-Nationaleinkommen
wenigsten entwickelten Länder Rech-
Indikatoren (Marktzugang)
nung tragen (Dazu gehören: Zoll- und
quotenfreier Zugang für die Exportgüter 35. Anteil der zollfreien Gesamtimporte der entwi-
der am wenigsten entwickelten Länder, ckelten Länder (nach Wert und unter Ausschluss
erweiterte Schuldenerleichterungspro- von Waffen) aus den Entwicklungsländern und den
gramme für die hochverschuldeten ar- am wenigsten entwickelten Ländern
men Länder (HIPC) und Streichung der 36. Von den entwickelten Ländern erhobene
bilateralen öffentlichen Schulden sowie Durchschnittszölle für Agrarprodukte, Textilien und
die Gewährung großzügiger öffentliche Kleidung aus den Entwicklungsländern
Entwicklungshilfe für Länder, die sich zur
37. Geschätzte Agrarsubventionen in den OECD-
Armutsbekämpfung verpflichtet haben
Ländern als prozentualer Anteil an ihrem Brutto-In-
landsprodukt
Zielvorgabe 14:
Den besonderen Bedürfnissen der Bin- 38. Anteil der öffentlichen Entwicklungshilfe, die für
den Aufbau der Handelskapazität gewährt wird
nn- und kleinen Inselentwicklungsländer
Rechnung tragen Indikatoren: Schuldentragfähigkeit
39. Gesamtzahl der Länder, die den Entscheidungs-
Zielvorgabe 15: und Erfüllungszeitpunkt im Rahmen der Schulden-
Die Schuldenprobleme der Entwicklungs- initiative für die hochverschuldeten armen Länder
länder (HIPC) erreicht haben (kumulativ)
Durch Maßnahmen auf nationaler und internatio- 40. Mittelbindungen für Schuldenerleichterung im
naler Ebene umfassend angehen und so die Schul- Rahmen der HIPC-Schuldeninitiative
den langfristig tragbar werden lassen
41. Schuldendienst als Prozentwert der Güter- und
Indikatoren: (Öffentliche Entwicklungshilfe) Dienstleistungsausfuhren
12Die Millenniums-Entwicklungsziele
The Millennium Development Goals – MDGs
Zielvorgabe 16: den wird, der zu den gemeinsamen Zielen führt, der
In Zusammenarbeit mit den Entwick- Verbindlichkeit und Nachprüfbarkeit schafft.
lungsländern Strategien zur Beschaffung Die Industrieländer stehen daher in der Verantwor-
menschenwürdiger und produktiver Ar- tung, entwicklungsfördernde internationale Rah-
beit für junge Menschen erarbeiten und menbedingungen zu schaffen und die Entwicklungs-
umsetzen länder beim Erreichen der anderen sieben Ziele zu
unterstützen. Die Regierungen der armen Länder
Indikatoren: müssen zwar selbst die Initiative ergreifen, um die-
45. Arbeitslosenquote bei den 15- 24-Jährigen se Schritte zu unternehmen; sie dürfen dabei jedoch
nach Geschlecht und insgesamt nicht auf sich allein gestellt bleiben. Im Millenniums-
Entwicklungspakt wird dargelegt, dass die Entwick-
lungsländer große Zuflüsse an Gebermitteln benö-
Zielvorgabe 17: tigen werden, um wesentlich stärker als bisher in
In Zusammenarbeit mit den Pharmaun- Gesundheit, Bildung, Landwirtschaft, Wasserversor-
ternehmen unentbehrliche Arzneimittel gung, Sanitärversorgung und zentrale Infrastruktur
in den Entwicklungsländern verfügbar zu investieren. Sie können nicht warten, bis durch
machen wirtschaftliches Wachstum genügend Rücklagen
im Inland gebildet wurden und die Haushaltsein-
Indikatoren: kommen steigen. Es ist im Gegenteil so, dass diese
46. Anteil der Bevölkerung mit dauerhaftem Zu- Schlüsselinvestitionen die Grundlage für wirtschaft-
gang zu erschwinglichen unentbehrlichen Arznei- liches Wachstum schaffen. Im Mai 2002 beschlossen
mitteln die Mitgliedstaaten der EU einen Stufenplan, der bis
2015 eine Erhöhung der Entwicklungsleistungen auf
0,7% des Bruttonationaleinkommens vorsieht.
Zielvorgabe 18:
In Zusammenarbeit mit dem Privatsektor Subventionen und Zölle der Industrieländer be-
dafür sorgen, dass die Vorteile der neuen schränken noch immer die Handelsmöglichkeiten
der ärmsten Länder und vernichten dort Arbeitsplät-
Technologien, insbesondere der Informa-
ze und Produktionsstätten.
tions- und Kommunikationstechnologien,
genutzt werden können Zudem ist ihr Handlungsspielraum durch die en-
ormen Auslandsschulden eingeengt, die sie von
Indikatoren: früheren Regierungen übernommen haben. In der
47. Telefonanschlüsse (Fest- und Mobilfunknetz) je sogenannten HIPC-Initiative wurden den ärmsten
100 Personen Ländern daher bereits in großem Ausmaß ihre Aus-
landsschulden bei Weltbank, Internationaler Wäh-
48. Computer- und Internetzugang rungsfond und Staaten erlassen. Die Zahlungen die-
ser Länder für den Schuldendienst haben sich so um
a. Genutzte Personalcomputer je 100 Personen rund zwei Drittel verringert. Die Einsparungen sollen
b. Internetnutzer je 100 Personen genutzt werden, um im sozialen Bereich der begün-
stigten Länder wie Bildung und Gesundheit inve-
stiert zu werden. So können die Länder aus eigener
Eine nachhaltige Verwirklichung der Millenniums- Kraft stärker zur Verwirklichung der Millenniumsziele
entwicklungsziele wird nur durch den Aufbau einer beitragen. Dass die Schuldenentlastung tatsächlich
weltweiten Partnerschaft zwischen Industrie- und zur Bekämpfung der Armut beiträgt, zeigt sich da-
Entwicklungsländern möglich. ran, dass die armutsbezogenen Ausgaben in den
HIPC-Ländern deutlich ansteigen. Diese Entschul-
Entwicklungspartnerschaft in einer zunehmend glo-
dungskampagne muss jedoch deutlich beschleunigt
balisierten Welt bedeutet letztlich nichts anderes, als
und erweitert werden, wenn die Millenniumsent-
dass alle Länder ihren Beitrag leisten, um die gemein-
wicklungsziele erreicht werden sollen.
same Zukunft zu erreichen und dass ein Weg gefun-
13Die Bedeutung der Kommunen in der
Entwicklungszusammenarbeit
Die Bedeutung der Kommunen Die zunehmende Bedeutung der lokalen Ebene und
der Kommunen in der Entwicklungszusammenarbeit
in der Entwicklungszusammen- zeigt sich auch in der im Jahr 2004 erfolgten Bildung
arbeit des Weltverbands der Kommunen (UCLG = United
Cities & Local Governments), der sich ausdrücklich
Die lokale Ebene hat in den letzten Jahren und als Partner der internationalen Entwicklungszusam-
Jahrzehnten in der internationalen entwick-lungspo- menarbeit zur Verfügung stellt. Maßgeblich für diese
litischen Diskussion mehr und mehr an Bedeutung Entwicklung war die Frage, wie Entwicklungszusam-
gewonnen. Immer mehr Kommunalverwaltungen menarbeit effektiver und effizienter gestaltet werden
gehen internationale Partnerschaften ein und enga- könnte.
gieren sich in Projekten der Entwicklungszusammen-
arbeit (EZ). Gemeinsam mit anderen kommunalen
Strategiewechsel in der Entwicklungszu-
Partnern entstehen dabei durch Synergie geprägte
und auf Erfahrung basierende Lösungen für spezi- sammenarbeit
fische lokale Probleme. In den 70er und 80er Jahren prägten „westliche“
Auf dem Weltgipfel für Nachhaltige Entwicklung in Vorstellungen und Modelle von Entwicklung die
Johannesburg 2002 versammelten sich auch Ver- EZ. Doch oft zeigten diese Modelle keine nachhal-
treterInnen von Kommunen aus der ganzen Welt, tige oder sogar eine negative Wirkung. Sie liefen
um auf ihre wichtige Rolle als Schnittstelle zwischen zu häufig ins Leere. Man erkannte, dass in der EZ
Regierungen und Menschen bei der Erreichung der zu wenig auf die örtlichen, kulturellen, politischen,
internationalen Entwicklungsziele hinzuweisen. In wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen
ihrem Aufruf von Johannesburg bekräftigten die eingegangen wurde. Auch wurde die Bevölkerung
Kommunen ihr Bekenntnis zur Agenda 21 und zu vor Ort zu wenig in die Prozesse mit eingebunden.
den Millenniumszielen und versprachen, die Be- Diese Erkenntnis führte Anfang der 90er Jahre zu
mühungen der Kommunen zu erhöhen. Gleichzei- einem langsamen, teilweise noch heute andau-
tig forderten sie die nationalen Regierungen und erndem Strategiewechsel in der Entwicklungszusam-
internationalen Organisationen auf, Rahmenbe- menarbeit. Der Begriff „Nachhaltige Entwicklung“,
dingungen zu setzten, damit die Kommunen ihrer der spätestens 1992 in Rio in der internationalen
Rolle auch gerecht werden können. Als Aufgabe der Entwicklungszusammenarbeit verankert wurde, war
Bundesländer wurden entwicklungspolitische Infor- und ist dabei von zentraler Bedeutung. Nachhaltige
mations- und Bildungsarbeit und Durchführung von Entwicklung wird definiert als “Entwicklung, die
Projekten in Entwicklungsländern schon mehrmals die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu
seit 1988 durch entsprechende Beschlüsse der Mini- riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen
sterpräsidenten ausdrücklich bestätigt. Bedürfnisse nicht befriedigen können“. Gemeint ist
damit, dass die wirtschaftlichen, sozialen und öko-
logischen Dimensionen von Entwicklung als gleich-
rangig betrachtet, miteinander in Einklang gebracht
und gegeneinander ausbalanciert werden sollen.
Nachhaltige Entwicklung, dem sich im Idealfall alle
staatlichen und zivilgesellschaftlichen Aktivitäten un-
terordnen, wurde 1996 als Leitbild in der deutschen
Entwicklungspolitik verankert.
Vor diesem Hintergrund sind auch die entwicklungs-
politische Diskussion und die daraus resultierenden
Ansätze zu verstehen. Ein zentrales Element heutiger
Ansätze ist, dass sich die Partnerorganisationen und
Zielgruppen mit einem Vorhaben identifizieren und
Eigenverantwortung für die Entwicklungsinitiativen
und Veränderungsprozesse übernehmen. Vorha-
14Die Bedeutung der Kommunen in der
Entwicklungszusammenarbeit
Welchen Beitrag können die deutschen
Kommunen für die EZ leisten?
Ausgestattet mit weit reichenden Kompetenzen
hat die kommunale Ebene im föderalen Sys-tem
Deutschlands eine besondere Rolle. Die Kommu-
nen sind die Schnittstelle zwischen Regierung und
Bürgern. Auf der lokalen Ebene erfahren die Bürger
tagtäglich die Auswir-kungen lokaler und nationaler
Politik. Die Kommunen haben durch ihre Bürgernä-
he am meisten Erfahrung bei der Umsetzung von
nationaler Politik. Ob die Umsetzung von Politik ge-
lingt, liegt letztendlich bei ihnen.
Kommunale Selbstverwaltung, gelebte Demokratie
in Städten und Gemeinden und funktionierende
ben sollen so weit wie möglich von dem Entwick- Mechanismen des Interessenausgleichs sind wesent-
lungsland selbst geplant und durchgeführt werden. liche Bestandteile des föderalen Systems und der
Es wurde erkannt, dass Vorhaben umso wirksamer politischen Kultur in Deutschland. Es sind aber auch
sind, je mehr das in den Partnerländern vorhandene wesentliche Bestandteile der nationalen und inter-
Wissen und die lokalen Fähigkeiten genutzt werden. nationalen Entwicklungsstrategien. Die Kommunen
Gleichzeitig soll durch diese Vorgehensweise auch besitzen daher durch ihre Position wertvolle Kom-
vermieden werden, dass Ent-wicklungsprozesse im petenzen und Erfahrungen in den meisten Themen-
Widerspruch zu den sozialen und kulturellen Eigen- feldern, die für die kommunale EZ und für Kommu-
heiten des Partnerlandes stehen. Dies erhöht wie- nen in Entwicklungsländern relevant sind. Deswegen
derum die Akzeptanz eines Vorhabens in der Be- können sie einen wichtigen Beitrag für die nationale
völke-rung und ist eine wichtige Vorraussetzung für EZ und damit zur Bekämpfung der weltweiten Ar-
Nachhaltigkeit. Das Thema Partizipation, als Beteili- mut leisten. Zum einen durch die Funktion der Kom-
gung der Bevölkerung und der Betroffenen vor Ort, mune als Verwaltungsebene, zum anderen durch die
nimmt durch diese Vorgehenswei-se in der EZ eine Bürgernähe der Kommune und den damit verbun-
wichtige Rolle ein. denen Möglichkeiten einer entwicklungspolitischen
Bewusstseinsbildung. Durch ihre Bürgernähe haben
Dezentralisierungsprozesse, der Aufbau einer lei-
die Kommunen viel direktere Möglichkeiten, in der
stungsfähigen lokalen Selbstverwaltung und die
Bevölkerung ein Bewusstsein für politische Themen
damit verbundenen Verwaltungsreformen stehen
zu entwickeln, als z.B. die Bundesregierung. Dazu
heute oft im Mittelpunkt der nationalen und interna-
gehören auch entwicklungspolitische Themen. Lo-
tionalen EZ. Ihnen wird eine Schlüsselfunktion bei
kales Handeln hat direkte Auswirkungen auf die glo-
der Erreichung der internationalen Entwicklungs-
ziele zugeschrieben.
Lokale Regierungs- und Verwaltungseinheiten bieten
die Chance für höhere Flexibilität, Effi-zienz, Trans-
parenz und Bürgernähe. Damit können sie einen
wichtigen Beitrag zur Korruptionsbekämpfung und
einer dynamischen Wirtschaftsentwicklung leisten.
Erhöhte Par-tizipationsmöglichkeiten der Bevölke-
rung und damit auch der verschiedenen (ethnischen,
politischen, ökonomischen, sozialen und religiösen)
Interessengruppen stärken die Demo-kratieentwick-
lung eines Staates und können das gesellschaftliche
Konfliktpotential verringern.
15Die Bedeutung der Kommunen in der
Entwicklungszusammenarbeit
bale Ebene und die Globalisierung wirkt sich wie- Grundsätzlich ist eine Vielzahl von Formen des kom-
derum direkt auf die lokale Ebene aus. Im Kontext munalen Engagements in der EZ möglich. Das liegt
von zunehmender Globalisierung wird jeder einzel- daran, dass es den Kommunen freigestellt ist, ob und
ne in Zukunft immer mehr gefordert sein, in seinem wie sie sich engagieren möchten. Partnerschaften
Umfeld und durch sein Verhalten die globale Ent- mit Kommunen in Entwicklungs- oder Schwellen-
wicklung mitzugestalten. Ein entsprechendes Grund- ländern sind jedoch Ausgangspunkt für den Großteil
verständnis in der Bevölkerung zu verankern, ist im der EZ-Aktivitäten der Kommunen. Bei Städtepart-
Sinne von nachhaltiger Entwicklung von großer nerschaften mit entwicklungspolitischem Hinter-
Bedeutung. Gleichzeitig kann so das enorme Poten- grund wird auch vermehrt der Begriff „Kommunale
tial der Zivilgesellschaft für die Entwicklungszusam- Entwicklungspartnerschaften“ verwendet. Dabei
menarbeit mobilisiert werden. Die Möglichkeiten der kann es sich sowohl um historisch gewachsene Städ-
Kommunen für Bewusstseinsbildung sind zahlreich. tepartnerschaften handeln, die ihren Fokus im Lauf
Entwicklungspolitische Themen könnten stärker in der Zeit verstärkt auf entwicklungspolitische Kompo-
die Bildungsprogramme integriert werden. Kommu- nenten gerichtet haben, als auch um neue, direkt als
nen könnten Vorbildfunktion einnehmen und mit kommunale Entwicklungspartnerschaft konzipierte
gutem Beispiel vorangehen (z.B. fair gehandelten Kooperationen. Oft geschieht dies im Rahmen des
Kaffee in Krankenhäusern und Verwaltungen). Gute Eine-Welt-Gedankens der lokalen Agenda 21 und
Möglichkeiten für Bewusstseinsbildung bieten aber durch das entwick-lungspolitische Engagement der
auch kommunale Entwicklungspartnerschaften und an der Städtepartnerschaft beteiligten Zivilgesell-
der damit verbundene direkte Kontakt der Bevölke- schaft. Kommunale Entwicklungspartnerschaften
rung mit den Menschen in den Partnerkommunen. können als die ausgeprägteste Form kommunalen
EZ-Engagements betrachtet werden. Sie bieten den
Kommunen einen sehr variablen Handlungs- und
Gestaltungsspielraum. Kommunen haben die Mög-
lichkeit, Projekte eigenständig zu planen und durch-
zuführen oder die Zivilgesellschaft mit einzubinden.
Ebenso ist es aber denkbar, dass die Partnerschaft
nur die Rahmenbedingungen für ein verstärktes En-
gagement der Zivilgesellschaft oder für andere For-
men der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit
liefert und sich der Aufwand der Kommunalverwal-
tung auf ein Minimum reduziert. Entwicklungspart-
nerschaften werden vermehrt auch von kleinen und
mittleren Gemeinden und Städten aufgebaut. Oft
sind ja gerade in kleineren und ländlichen Kommu-
Entwicklungszusammenarbeit ist also nicht allein nen die Wirkungen globaler Entwicklung besonders
Aufgabe nationaler Politik. Die deutschen Städte fühlbar.
und Gemeinden können ihren Beitrag dazu leisten.
Dies wird seitens der Bundesre-gierung begrüßt
und in zunehmendem Maße auch unterstützt und
gefördert, etwa durch die Einrichtung der Service-
stelle Kommunen in der Einen Welt oder durch die
Stärkung der kommunalen Ebene auf internatio-
nalen Konferenzen. Kommunale Entwicklungspart-
nerschaften können integraler Bestandteil der deut-
schen EZ sein. Viele Kommunen in Deutschland sind
bereits entwicklungspolitisch aktiv, z.B. im Rahmen
ihrer lokalen Agenda 21 Prozesse (2.427 Kommu-
nen in Deutschland, ca. 18%, haben bereits einen
Agendabeschluss. Stand Oktober 2003) und dem
Eine-Welt-Gedanken.
16Sie können auch lesen