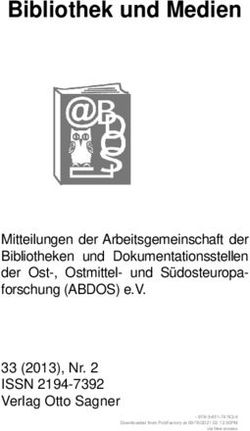DIALOG MIT BIBLIOTHEKEN - 2019/2 31. Jahrgang
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
BESUCHEN SIE UNS!
Auf der Frankfurter Buchmesse
vom 16. bis 20. Oktober 2019
in Halle 4.2 am Stand N72
Wir freuen uns auf das persönliche Gespräch mit Ihnen und erwarten
Sie am Stand mit Informationen zu den vielfältigen Angeboten der
Deutschen Nationalbibliothek.
Für Fragen
| zu den bibliografischen Angeboten und Diensten,
| zur Ablieferung von Netzpublikationen,
| zur Erwerbung im In- und Ausland,
| zum Lizenzierungsservice Vergriffene Werke,
| zur Gemeinsamen Normdatei (GND) und
| zu Resource Description and Access (RDA)
stehen Ihnen von Mittwoch bis Sonntag weitere Fachkolleginnen und
Fachkollegen zur Verfügung, Sprechzeiten unter www.dnb.de/veranstaltung.
Besuchen Sie auch die Führungen und Lesungen im Rahmen der Frankfurter
Buchmesse, zu denen wir Sie herzlich in die Räume der
Deutschen Nationalbibliothek an der Adickesallee 1 einladen.
Ihre Ansprechpartnerin: Frau Uta Ackermann, E-Mail: u.ackermann@dnb.de
www.dnb.de
Foto: DNB, Stephan JockelInhalt
Dr. Elisabeth Niggemann 5 EDITORIAL
6 FORUM
Stefanie Golla 6 »Nur was sich ändert, bleibt.«
Dr. Frédéric Döhl 9 Deutsche Nationalbibliothek verstärkt Engagement
in den Digital Humanities
Lisa Landes 12 Ein Zeitungsportal für Deutschland
Renate Behrens 15 Warum wir RDA neu implementieren oder fünf
Fragen zum 3R Project
Nathalie Küchler 19 Deutsche Nationalbibliothek setzt auf Emulation
zur Bestandserhaltung
Philippe Genêt 25 Halbzeit in der Wunderkammer der digitalen
Nachnutzung
Dr. Sylvia Asmus, Dr. Kathrin Massar 28 Exil und Archiv
Lidia Westermann 32 Mit virtuellen Ausstellungen Geschichten erzählen
Cornelia Ranft 36 Das Projekt Provenienzrecherchen – Ein Werk-
stattbericht
Dr. Sören Flachowsky, Dr. Christian Rau 40 Geschichte der Deutschen Nationalbibliothek
Susanne Oehlschläger 44 Wie misst man die Qualität einer
Nationalbibliothek?
48 ZEITPUNKTE
Jürgen Clemen 48 Das Gilgamesch-Epos als Graphic Novel
Barbara Fischer 50 Türen öffnen und neue Freunde gewinnen
Dr. Stephanie Jacobs 51 Typografie und Meinungsfreiheit
Barbara K. Fischer, Jürgen Kett 53 Leipziger Einsichten zur Öffnung der GND
Peter Kühne 57 Die Schwarze Kunst und die Weiße Kunst
Dr. Stephanie Jacobs 59 Kriegsbedingt verlagert
Dr. Jesko Bender 62 Was ist das Gegenteil von »gut«?
Dr. Patrick Merziger 64 Schmutz und Schund. Die Weimarer Republik
Annett Koschnick 67 Veranstaltungsvorschau
Lisa Eyrich 72 Nachgelesen – Ein Veranstaltungsrückblick
75 NOTIZEN
75 Personelles
77 Neue Veröffentlichungen
78 Fachveranstaltungen
CC BY-SA 3.0 Dialog mit Bibliotheken 2019/2 3GESELLSCHAFT Sie fühlen sich der Deutschen Nationalbibliothek verbunden?
Sie möchten die Deutsche Nationalbibliothek als ein Zentrum
FÜR DAS BUCH E.V. der Wissenschaft und Kultur fördern?
Sie befinden sich gerne in anregender Gesellschaft und treffen
an Kultur interessierte Menschen?
Sie möchten exklusive Führungen durch die Deutsche National-
bibliothek und deren Ausstellungen erleben und persönliche
Einladungen zu den kulturellen Veranstaltungen erhalten?
Werden Sie Mitglied in der Gesellschaft für das Buch e. V.!
Ziel des Freundes- und Förderkreises ist es, die Deutsche
Nationalbibliothek in ihren vielfältigen Aufgaben und ihrem Kultur-
programm finanziell und ideell zu fördern. Mit Ihrem Engagement
unterstützen Sie die Bibliothek dabei, Ausstellungen, Lesungen,
Tagungen, Publikationen und pädagogische Angebote zu
realisieren. Weitere wichtige Aufgaben sind die Bewahrung der
Bestände und die Erweiterung von besonderen Sammlungen.
Wir freuen uns auf Sie und informieren Sie gerne über mögliche
Formen der Mitgliedschaft.
Gesellschaft für das Buch e. V.
c/o Deutsche Nationalbibliothek
Adickesallee 1
60322 Frankfurt am Main
Tel: 069 1525-1026
E-Mail: info-gfdb@dnb.de
www.dnb.de/foerdererEditorial
Der Beitrag »Exil und Archiv« in dieser Ausgabe des »Dialog mit Biblio-
theken« ist der Abschluss einer vierteiligen Reihe zu der im Frühjahr 2018
eröffneten Dauerausstellung des Deutschen Exilarchivs. Er beschäftigt
sich mit der bewegenden Überlieferungsgeschichte der Ausstellungsobjek-
te. Zu der Ausstellung in unserem Frankfurter Haus und ihrem virtuellen
Pendant im Internet ist kürzlich ein umfassender und schön gestalteter
Katalog erschienen.
Das Forum dieser Dialog-Ausgabe spannt einen weiten zeitlichen und
inhaltlichen Bogen. Wir ziehen Bilanz des Forschungsprojektes zur Ge-
schichte unseres Hauses und wenden uns mit dem Provenienzforschungs-
projekt einer weiteren historischen Thematik und ersten Ergebnissen zu.
Vielfältige Arbeitsfelder beschäftigen uns tagtäglich: Die Deutsche Na-
tionalbibliothek engagiert sich verstärkt in den Digital Humanities; ein neues Zeitungsportal wird in der
Deutschen Digitalen Bibliothek entwickelt; mit dem RDA Restructure and Redesign Project kommen zum
Teil weitreichende Konsequenzen für die praktische Erschließung auf uns zu.
Damit Sie auch in Zukunft unsere digitalen Sammlungen nutzen können, setzen wir bei der Bestandserhal-
tung auf Emulation. Eine Strategie, die Gedächtnisinstitutionen bislang nur vereinzelt anwenden. Ebenfalls
erst am Anfang stehen Nationalbibliotheken bei der Aufgabe, die Qualität ihrer Arbeit zu messen und zu
vergleichen. Die Herausforderungen bei der Einführung neuer Methoden beschreiben zwei unserer Beiträge.
Mit diesem Editorial verabschiede ich mich von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Nach mehr als 20 Jahren
übergebe ich die Leitung der Deutschen Nationalbibliothek zum 1. Januar 2020 an Frank Scholze. Er ist
derzeit Direktor der Bibliothek des Karlsruher Instituts für Technologie, und wir haben mit ihm ein erstes
Interview über seine Pläne und Erwartungen geführt.
Vor uns liegt zunächst aber noch ein ereignisreicher Herbst: Auf der Frankfurter Buchmesse freuen wir
uns auf Begegnungen an unserem Stand und auf Gespräche mit Ihnen. Wir begleiten die Messe mit der
Eröffnung von OPEN BOOKS und Veranstaltungen im Rahmen von BOOKFEST in unserer Bibliothek
und laden Sie herzlich zum Besuch ein. Mit Ausstellungseröffnungen des Deutschen Exilarchivs 1933-1945
und des Deutschen Buch- und Schriftmuseums und mit Lesungen tragen wir zum kulturellen Angebot in
Leipzig und Frankfurt am Main bei.
Wir freuen uns auch auf die Fachkonferenzen dieses Herbstes. Zum zweiten Mal sind wir Gastgeberin von
»Zugang Gestalten«, das »Forum Wissenschafts- und Buchgeschichte« ist ebenso bei uns zu Gast und mit
»Netzwerk maschinelle Verfahren in der Erschließung« beginnen wir eine neue Veranstaltungsreihe. Details
zu diesen und weiteren Konferenzen finden Sie auf unseren überarbeiteten und neu gestalteten Internetseiten.
Elisabeth Niggemann
CC BY-SA 3.0 Dialog mit Bibliotheken 2019/2 5Forum
Stefanie Golla
»Nur was sich ändert, bleibt.«
Derzeit leitet Frank Scholze die Bibliothek des
Karls
r uher Instituts für Technologie. Ab Januar
2020 tritt er die Nachfolge von Elisabeth Nigge-
mann an und wird neuer Generaldirektor der Deut-
schen Nationalbibliothek. Im Interview mit »Dia-
log mit Bibliotheken« verrät er, was er für die ersten
100 Tage im Amt plant und wo er die Deutsche
Nationalbibliothek in zehn Jahren sieht.
Im Januar treten Sie Ihren Posten als neuer Gene-
raldirektor der Deutschen Nationalbibliothek an.
Wie haben Sie von der Entscheidung des Verwal-
tungsrats erfahren und was war Ihr erster Gedanke?
Ich erfuhr von Günter Winands, dem Vorsitzen-
den des Verwaltungsrats, noch in der Sitzung, dass
die Wahl auf mich gefallen war. Der Entscheidung
waren intensive und spannende Diskussionen vor-
ausgegangen. Meine ersten Gedanken waren Freu-
de über die Zustimmung, die ich erfahren durfte.
Und natürlich Neugierde auf die neuen Aufgaben, Frank Scholze. Foto: KIT (CC-BY-SA)
gemischt mit Respekt. Denn ich bin mir bewusst,
welch große Aufgabe und Verantwortung es ist, Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausfor-
eine Institution wie die Deutsche Nationalbiblio- derungen, vor der Gedächtnisinstitutionen und insbe-
thek zu leiten. sondere die Deutsche Nationalbibliothek stehen?
Eine der großen Herausforderungen für die Deut-
Was haben Sie sich für Ihre ersten 100 Tage vorge- sche Nationalbibliothek liegt sicherlich in ihrer
nommen? Aufgabe begründet, das »kulturelle Gedächtnis der
Zu Beginn steht für mich vor allem Lernen und Vergangenheit und der Zukunft zu sein«. Wie kön-
Kennenlernen. Die Menschen, die Themen, die nen wir das kulturelle Erbe bewahren? Und zwar
Fragestellungen und Prioritäten. Dazu werde ich das analoge und das digitale Erbe. Wie bewältigen
viele Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen wir das kooperativ, konzeptionell und auch tech-
in Leipzig und Frankfurt am Main sowie den wich- nisch? Wobei uns die Bewahrung des digitalen Er-
tigsten Kooperationspartnern führen. Bislang ken- bes aktuell vor größere Herausforderungen stellt.
ne ich die Deutsche Nationalbibliothek ja nur von Welche Teile des Internets und der sozialen Netz-
außen. Jetzt freue ich mich darauf, die Bibliothek werke gehören etwa zum kulturellen Gedächtnis?
und ihre Menschen auch persönlich kennenzuler- Wie können wir all diese modernen Medienfor-
nen. Ich denke, die Deutsche Nationalbibliothek men, seien es nun Blogs oder Tweets, maschinell
ist bereits sehr gut aufgestellt. Sei es strategisch, so erschließen, dass sie im aktiven Gedächtnis der
organisatorisch oder personell. Auf dieser Basis Gesellschaft und der Wissenschaft verfügbar sind?
möchte ich aufbauen, um gemeinsam mit den Mit- Und wie können wir als Deutsche Nationalbiblio-
arbeitern und Mitarbeiterinnen inhaltliche Schwer- thek diesem kulturellen Gedächtnis in Zukunft ein
punkte zu setzen. Gesicht geben?
6 Dialog mit Bibliotheken 2019/2 CC BY-SA 3.0Forum
Was bedeutet das für die Deutsche Nationalbiblio-
Zur Person thek?
Frank Scholze, Jahrgang 1968, studierte Bibliotheks- Kulturelles Gedächtnis sein, Erbe bewahren – all
wesen an der Hochschule der Medien Stuttgart sowie das ist unausweichlich verbunden mit dem Wandel.
Kunstgeschichte und Anglistik an der Universität Wir sollten Wandel dabei als Teil des Bewahrens be-
Stuttgart. Er leitete die Benutzungsabteilung der Uni-
greifen, nicht als Gegensatz. Mehr noch: Bewahren
versitätsbibliothek Stuttgart und war als Referent im
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst geht nur über den digitalen Wandel. Das bedeutet
Baden-Württemberg tätig. 2010 trat er den Posten auch, dass wir uns wieder stärker auf die Wurzeln
des Direktors der Bibliothek des Karlsruher Instituts des Bibliothekswesens rückbesinnen sollten. Dass
für Technologie an. Ab Januar 2020 wird er Gene-
raldirektor der Deutschen Nationalbibliothek. Frank
wir Bibliotheken eben auch als Labore oder Werk-
Scholze engagiert sich in verschiedenen Gremien für stätten verstehen, in denen experimentiert und er-
das Bibliothekswesen. Unter anderem ist er Mitglied probt wird. Wenn wir es als Organisation schaffen,
des Bundesvorstandes des Deutschen Bibliotheksver-
den digitalen Wandel so natürlich zu leben wie die
bandes (dbv).
Erneuerung der Zellen unseres Körpers, dann ha-
ben wir die richtige Digitalisierungsstrategie. Dies
Wo sehen Sie die Deutsche Nationalbibliothek in bedeutet, Standardisierung und Systematisierung
zehn Jahren? mit Agilität und Experimentierfreude zu verbinden.
Die Herausforderung ist für mich ganz klar auch
Zukunftsperspektive: Ich sehe die Deutsche Nati- Welche Entwicklungen im Bibliothekswesen inter-
onalbibliothek als das »kulturelle Gedächtnis der essieren Sie persönlich aktuell am stärksten?
Vergangenheit und der Zukunft«. Und damit als Derzeit ist mein Blick natürlich von meiner jetzi-
einen starken Partner für Gesellschaft, Kultur und gen Tätigkeit am Karlsruher Institut für Techno-
Wissenschaft. Ich sehe eine Deutsche Nationalbi- logie geprägt. Zurzeit beschäftige ich mich stark
bliothek, die bereit ist, in Kooperationen Verant- damit, wie Informationsinfrastrukturen und Wis-
wortung zu übernehmen, zwischen verschiedenen senschaft im Zuge der Digitalisierung enger mitei-
Interessen zu vermitteln und strategische Entwick- nander verbunden werden können. Dazu gehören
lungen zu gestalten. Und ich sehe sie noch deutlich Themen wie Forschungsdatenmanagement, etwa
offensiver in ihrer Außenwirkung als sie das heute im Rahmen der Diskussion um die nationale For-
schon ist. Dies bezieht sich sowohl auf den Bereich schungsdateninfrastruktur NFDI, Open Access im
der Kultur und der Wissenschaft, aber auch auf den Publikationswesen, oder die Entwicklung von Text
Bereich der Informationsinfrastruktur, der im Zuge und Data Mining. All diese Themenfelder spielen
der Digitalisierung enger mit den anderen Berei- in einer abgewandelten Form aber sicher auch für
chen zusammenwachsen wird. die Deutsche Nationalbibliothek eine wesentliche
Rolle. Mit Formaten wie der Gemeinsamen Norm-
Die Digitalisierung macht auch vor Bibliotheken datei und der Deutschen Digitalen Bibliothek hat
nicht halt. Wie sieht Ihre Digitalisierungsstrategie sich die Deutsche Nationalbibliothek bereits sehr
für die Deutsche Nationalbibliothek aus? gut positioniert. Ich glaube, dass hier noch weiteres
»Nur was sich ändert, bleibt« – dieses Goethe-Motto Potenzial liegt, etwa bei den Digital Humanities,
des Bibliothekartages 1998 in Frankfurt am Main, für die wir »Forschungsdaten« liefern und analysie-
das oft auch in Verbindung mit Klaus-Dieter Leh- ren helfen können. Es ist eine schöne Perspektive,
mann, dem damaligen Generaldirektor der Deut- gerade als Nationalbibliothek Kultur und Wissen-
schen Nationalbibliothek, gebracht wird, bringt es schaft zu verbinden.
meiner Meinung nach auf den Punkt. Digitalisie-
rung macht den ohnehin vorhandenen Wandel nur Worauf freuen Sie sich in Ihrer neuen Funktion
deutlicher, offensichtlicher bisweilen auch rasanter besonders?
spürbar. Am meisten freue ich mich auf die Menschen in
der Deutschen Nationalbibliothek. Schon heute
arbeiten sie gemeinsam an dem Ziel, ein kulturelles
CC BY-SA 3.0 Dialog mit Bibliotheken 2019/2 7Forum
Gedächtnis für die Vergangenheit und die Zukunft
zu sein und diesem Gedächtnis ein Gesicht zu ge-
ben. Diesen Weg gemeinsam weiter zu beschreiten,
darauf freue ich mich.
Abschließend noch eine persönliche Frage: Welche
Bücher lesen Sie aktuell?
Auf meinem Schreibtisch liegen derzeit - wie meis-
tens - mehrere Bücher. Ich greife nur zwei heraus,
um die Bandbreite zu verdeutlichen. Zum einen
Jörg Zink »Womit wir leben können«, eine Samm-
lung zentraler Texte der Bibel in zeitgenössischer
Sprache. Zum anderen »Measuring Research« von
Cassidy Sugimoto. Das ist eine Einführung in die
mathematische beziehungsweise statistische Be-
schreibung von Wissenschaft. Herr Scholze, ich
bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch!
Das Gespräch führte Stefanie Golla
8 Dialog mit Bibliotheken 2019/2 CC BY-SA 3.0Forum
Frédéric Döhl
Deutsche Nationalbibliothek verstärkt
Engagement in den Digital Humanities
Die Deutsche Nationalbibliothek nimmt seit An- Gesetzesnovelle
fang 2018 verstärkt die Digital Humanities in den erleichtert Text und Data Mining
Blick. Auslöser waren Novellen des deutschen Ur-
heberrechts und der Änderung des Gesetzes über All das gilt zum Beispiel für Themenfelder wie den
die Deutsche Nationalbibliothek in Artikel 2 des Umgang mit Forschungsdaten als wissenschaft-
Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz. licher Publikationsform, für die Erhaltung der
Schon seit langem geht die Deutsche Nationalbi- Langzeitnutzbarkeit von Forschungsdaten, für den
bliothek Aufgaben nach, die sich heutzutage un- anstehenden Aufbau nationaler Forschungsdaten-
ter dem Label Digital Humanities wiederfinden: infrastrukturen in den Geisteswissenschaften, für
von der Digitalisierung über die Sammlung von einen zeitgemäßen Umgang mit großen Datenmen-
born-digital content und die digitale Langzeitarchi- gen, um sie für den bibliothekarischen Gebrauch
vierung hin zur Entwicklung zeitgemäßer Erschlie- sinnvoll nutzbar zu machen, oder für Fragen der
ßungs- und Vernetzungsstrategien für ihre digital Standardisierung und Vernetzung von digitalen In-
vorliegenden Informationsbestände bis zu Produk- formationen. Es gilt aber im besonderen Maße für
ten wie der GND. Die besagten Rechtsänderungen das sogenannte Text und Data Mining. Darunter
haben die Situation nun aber grundlegend verän- versteht man das computerunterstützte Aufarbeiten
dert. Sie eröffnen der Deutschen Nationalbiblio- großer Datenmengen auf geisteswissenschaftliche
thek erstmals die Möglichkeit, zentrale Arbeitsfel- Thesen und Fragen hin, etwa um Muster, Trends
der der Digital Humanities nicht mehr nur passiv und Korrelationen aufzudecken. Für das Text und
zu verfolgen, sondern sich aktiv an ihnen zu betei- Data Mining gilt seit März 2018 mit § 60d UrhG
ligen. Und hierdurch mit ganz anderer Intensität ein vergleichsweise präziser und rechtssicherer Rah-
und Tiefe lernen zu können, was Digital Humani- men. Artikel 3 der gut ein Jahr später auf euro-
ties sind, was sie können und was nicht und was päischer Ebene beschlossenen Richtlinie 2019/790
sie vor allem mit einer zeitgemäßen Erfüllung ihres über das Urheberrecht und die verwandten Schutz-
gesetzlichen Auftrags zu tun haben. Vor diesem rechte im digitalen Binnenmarkt bestätigt diese le-
Hintergrund geht es derzeit für die Deutsche Nati- gislative Entwicklung und adressiert nun sogar aus-
onalbibliothek vor allem darum, in Sachen Digital drücklich Gedächtnisinstitutionen (»Einrichtungen
Humanities Grund unter den Füßen zu gewinnen. des Kulturerbes«) als legitimiert, sich im Bereich
Die Entwicklung zu verstehen, mit maßgeblichen Text und Data Mining in geistes- und sozialwissen-
Akteurinnen und Akteuren in Dialog und Koope- schaftliche Forschung einzubringen.
rationen zu kommen, um perspektivisch auf dieser Text und Data Mining ist in diesem Kontext dann
Basis fundiert entscheiden zu können, wo, wenn, besonders interessant, wenn es um Quellenmengen
warum und in welcher Form sie sich im Kontext geht, die händisch, also durch anschauen, lesen, an-
der Digital Humanities künftig engagieren will – hören, nicht mehr zu bewältigen sind. Man denke
und partiell vielleicht sogar muss – und wann sie an die 80 Kilometer Akten der Hafenverwaltung
dies nicht will, kann oder darf. des mittelalterlichen Venedigs für die Geschichts-
wissenschaft. Oder an die Abermillionen, weithin
unbekannten Musiktitel von YouTube über Spotify
bis SoundCloud für die Musikwissenschaft. Oder
an die nicht überschaubaren Konversationen zu ge-
sellschaftspolitischen Trendthemen in sozialen Me-
CC BY-SA 3.0 Dialog mit Bibliotheken 2019/2 9Forum
dien für Sozial- und Politikwissenschaft. Oder eben ber trennen kann oder gar sollte, ist in den Digital
an die über 36 Millionen Medien der Deutschen Humanities selbst ebenfalls weithin umstritten2. Es
Nationalbibliothek, die aufgrund ihres Grads an ist schon deswegen gar nicht so einfach, zu klären,
Vollständigkeit für bestimmte geisteswissenschaftli- was Digital Humanities sind und was sie vor allem
che Fragestellungen von besonderem Interesse sind. mit einer zeitgemäßen Erfüllung des gesetzlichen
Die Erwartungen an Text und Data Mining sind Auftrags der Deutschen Nationalbibliothek zu tun
zudem dann besonders groß, wenn es darum geht, haben und was nicht. Je tiefer und systematischer
neue Erkenntnis aus der Vernetzung von Informati- man einsteigt, je näher aber auch an den digitalen
onen zu gewinnen. Und dann, wenn man sich mit Geisteswissenschaften und wo möglich in Dialog
Bereichen kultureller Produktivität beschäftigen und Kooperation, desto größer sind die Aussich-
möchte, die zwar mengenmäßig gesehen groß, aber ten, die derzeit sich äußerst dynamisch und durch-
mangels akademischen Prestiges kaum systematisch aus heterogen entwickelnde Sache adäquat in den
untersucht sind. Popularkultur von Groschenroma- Griff zu bekommen.
nen bis Fan Fiction etwa. Zunehmend sieht sich die Deutsche Nationalbi
Die Deutsche Nationalbibliothek ist ihrem gesetz- bliothek zudem mit Hoffnungen und Erwartungen
lichen Auftrag nach nicht selbst eine forschende aus den digital arbeitenden Geisteswissenschaften
Einrichtung. Dennoch ist das nun verstärkt be- konfrontiert, die sie angemessen zu prüfen hat.
triebene Engagement bei den Digital Humanities Diese reichen von erbetener Hilfestellung etwa bei
keineswegs nur punktuell und letztlich oberfläch- Normdaten über ein Forschungsinteresse an ihren
lich. Vielmehr bemüht sich die Deutsche Natio- Beständen bis zum ungelösten Problem, Datenkor-
nalbibliothek derzeit, sich diese systematisch zu pora der Digital Humanities über die oft nur befris-
erschließen und sich zugleich als Gesprächs- und tet finanzierten Projekte hinaus für die Forschung
Kooperationspartnerin zu etablieren. Dafür legt sie nachnutzbar halten zu können.
Pilotprojekte in Wissenschaftskooperationen auf, Die Deutsche Nationalbibliothek verspricht sich
etwa bei Text und Data Mining, hat einen Strategie- des Weiteren durch ein stärkeres Engagement
referenten, der sich mit dem Thema beschäftigt, sie eine höhere Sichtbarkeit ihrer Kompetenzen und
veröffentlicht zum Thema, führt Tagungen durch, Dienstleistungen innerhalb der digitalen Geistes-
und schult Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. wissenschaften. So will sie Produkte und Service-
angebote wie die GND, nestor oder die Deutsche
Digitale Bibliothek ebenso bekannter machen wie
Ziele ihre bereits heute für die Forschung frei nutzba-
ren digitalen Informationen, etwa Metadaten und
Mit diesen Aktivitäten verfolgt die Deutsche Nati- Inhaltsverzeichnisse. Zudem will sie auf die neu-
onalbibliothek verschiedene Ziele. en Möglichkeiten für Gedächtnisinstitutionen
Zunächst geht es darum, zu klären, was Digital aufmerksam machen, die sich durch die jüngsten
Humanities mit einer zeitgemäßen Erfüllung des juristischen und wissenschaftlichen Entwicklungen
gesetzlichen Auftrags der Deutschen Nationalbi ergeben, beispielsweise bei Text und Data Mining,
bliothek zu tun haben und was nicht. Doch was vergriffenen Werken oder Zitationsarchiven.
sind Digital Humanities überhaupt? Die Definition Nicht zuletzt verspricht ein nachhaltiges und ver-
erweist sich laut Mareike König als Gretchenfrage: tieftes Engagement aber auch, nahe an den neues-
Handelt »es sich bei den Digital Humanities um ten Entwicklungen zu sein und Know-how für die
eine Disziplin, eine Sammlung an Methoden oder zeitgemäße Fortschreibung der eigenen Aufgaben
eine in den jeweiligen [geisteswissenschaftlichen] zu gewinnen. Außerdem erhofft die Deutsche
Disziplinen verankerte Grundwissenschaft«?1 Die Nationalbibliothek sich so bei qualifizierten Absol-
Folgefrage, ob man im Fall der Digital Humanities venten und Absolventinnen, Arbeitnehmern und
Infrastrukturfragen und Forschungsinhalte, hilfs- Arbeitnehmerinnen verstärkt als potentielle Arbeit-
wissenschaftlichen Auftrag und eigenständig-diszi- geberin ins Bewusstsein zu bringen. Denn der Be-
plinären theoretisch-methodischen Anspruch sau- darf an qualifiziertem Personal wird mit der
10 Dialog mit Bibliotheken 2019/2 CC BY-SA 3.0Forum
fortschreitenden digitalen Entwicklung der biblio Engagement trägt erste Früchte
thekarischen Aufgaben und Dienstleistungen wei-
ter zunehmen. Erste Ergebnisse des verstärkten Engagements zei-
gen sich bereits jetzt: Kooperationen konnten auf
und ausgebaut werden, Netzwerke zu Austausch
und Projektentwicklung wurden angestoßen, erste
Publikationen3 sind erschienen, erste Tagungen4
wurden ausgerichtet.
Darauf aufbauend sind 2019 und 2020 weitere Ta-
gungen geplant. Themen sind unter anderem der
Wandel der Bewertungskultur von Informationen
durch das Digitale, Digital Humanities und Recht,
die Rolle der Digital Humanities in Gedächtnisin-
stitutionen sowie Digital Humanities und Musik.
Darüber hinaus beteiligt sich das Haus mit eige-
nen Beiträgen an einschlägigen wissenschaftlichen
Tagungen Dritter. Ferner bringt sich die Deutsche
Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Workshops »Digital- Nationalbibliothek aktuell ein bei der Erstellung
Humanities-Zentren« in der Deutschen Nationalbibliothek von Förderanträgen für das neue DFG-Programm
in Frankfurt am Main.
Foto: Deutsche Nationalbibliothek, Stephan Jockel zum Aufbau Nationaler Forschungsdateninfra-
strukturen, in dem Digital Humanities für die Geis-
teswissenschaften eine wichtige Rolle spielen5.
Anmerkungen
1 Mareike König: Was sind Digital Humanities? Definitionsfragen und Praxisbeispiel aus der Geschichtswissenschaft. In: Digital
Humanities am DHIP, 2016, .
2 Vgl. Susan Schreibmann, Ray Siemens und John Unsworth: Preface. In: A New Companion to Digital Humanities, hg. von diess.,
Malden/MA 2016, S. xvii-xviii, hier S. xvii.
3 Vgl. z.B. Frédéric Döhl: »Potential und Risiken des Archival Turns in den Digital Humanities für die Musikwissenschaft«,
in: Archiv für Musikwissenschaft 75/4 (2018), S. 301–320; Frédéric Döhl: »Digital Humanities und Bibliotheken. Über tech-
nisch-organisatorische Infrastruktur hinausgedacht«, in: ZfBB – Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 66/1 (2019),
S. 4–18; Frédéric Döhl: Musikgeschichte ohne Markennamen. Soziologie und Ästhetik des Klavierquintetts, Bielefeld 2019,
; Fotis Jannidis, Leonard Konle und Peter
Leinen: Makroanalytische Untersuchung von Heftromanen. In: DHd 2019 – Digital Humanities: multimedial & multimodal, hrsg.
von Patrick Sahle, 2019, S. 168–174, .
4 Vgl. .
5 Vgl. .
CC BY-SA 3.0 Dialog mit Bibliotheken 2019/2 11Forum
Lisa Landes
Ein Zeitungsportal für Deutschland
Warum ein papers« veröffentlicht, das in Teilen an die »Histo-
nationales Zeitungsportal? ric Newspapers Collection« der European Library
anknüpft.1 Das für deutschsprachige Nutzer und
Die Zeitung ist ein Medium, das alle Bereiche des Nutzerinnen besonders interessante österreichische
Lebens abdeckt – Politik, Wirtschaft, Kultur, So- Zeitungsportal ANNO2 weist schon seit Jahren be-
ziales, Sport, Lokales – es gibt quasi kein Thema, eindruckende Zahlen auf: »Täglich nutzen durch-
das nicht auch in Zeitungen verhandelt wird. Und schnittlich 2500 Leser ANNO. 10% bleiben länger
nicht nur die eigentlichen Inhalte sind von Inter- als eine Stunde, weitere 10% zwischen einer halben
esse: Zeitungen können auch nach der Geschich- und einer Stunde. Insgesamt 46% der Besuche dau-
te des Designs (Verwendung von Schrifttypen, ern länger als 15 Minuten.«3 In Deutschland existie-
Layout-Entwicklung), der Werbung (kommerzielle ren zwar bereits Zeitungsportale, die Bestände ein-
Anzeigen), natürlich der Presse selber (Auflage, Ver- zelner Bibliotheken oder Bundesländer anbieten.4
breitung, Preisentwicklung) und nach vielen weite- Ein übergreifendes nationales Angebot allerdings
ren Themen befragt werden. fehlt.
Zeitungen sind darum eine äußerst wichtige Quelle
für alle Arten von Forschungsvorhaben. Das gilt
zunächst für Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler unterschiedlichster Disziplinen. Das gilt
aber auch für den Bildungsbereich sowie für private
Nutzerinnen und Nutzer wie Heimat- und Famili-
enforschende. Besonders spannend wird es für die
Nutzerinnen und Nutzer, wenn Zeitungen nicht
nur digitalisiert, sondern als elektronische Volltexte
vorliegen und wenn zudem eine Vielzahl von Be-
ständen über ein einziges Zeitungsportal zugäng-
lich ist. So können mit einem Klick viele Zeitungen
und viele Ausgaben auf einmal durchsucht werden,
zum Beispiel nach Namen, Orten oder weiteren
Suchbegriffen. Historische Zeitungen lassen sich bald im nationalen
Genau das soll das nationale Zeitungsportal leisten, Zeitungsportal bequem von zu Hause per Volltextsuche
durchstöbern.
das seit Anfang 2019 im Aufbau ist.
Foto: Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer
Kulturen, Fotograf: Michael Mohr (urheberrechtlich geschützt)
Ein Blick über den DFG fördert Projekt
nationalen Tellerrand
Dank einer Förderung der Deutschen Forschungs-
In anderen Ländern ist der Aufbau von nationalen gemeinschaft (DFG) wird sich das nun ändern.
Zeitungsportalen weiter gediehen – so gibt es bei- Grundlage für das Projekt »DDB-Zeitungsportal«
spielsweise in Großbritannien, den Niederlanden ist ein Masterplan, den ein Konsortium aus nam-
und Australien schon länger nationale Zeitungspor- haften und bei der Digitalisierung führenden Bi
tale, die von den Nutzerinnen und Nutzern sehr bliotheken im Rahmen des DFG-Pilotprojekts »Di-
gut angenommen werden. Und erst vor kurzem gitalisierung historischer Zeitungen« erarbeitet hat.
wurde auf europäischer Ebene »Europeana News- In diesem heißt es: »Die Deutsche Digitale Biblio-
12 Dialog mit Bibliotheken 2019/2 CC BY-SA 3.0Forum
thek sollte so bald als möglich ein nationales Zei- de aus sechs deutschen Bibliotheken, die auch an
tungsportal mit dem Zugang zu allen digitalisier- den DFG-Pilotprojekten beteiligt waren, verfügbar
ten Zeitungen in Deutschland mit den in diesem sein.6 Schritt für Schritt werden dann Bestände aus
Masterplan beschriebenen Features entwickeln. weiteren Einrichtungen dazukommen. Hier wird es
Eine Förderung ist dringlich, um die zahlreichen zunächst um solche Bestände gehen, die den tech-
überregionalen, regionalen und lokalen Aktivitäten nischen Format-Vorgaben des Zeitungsportals ent-
wissenschaftskonform nutzbar zu machen.«5 sprechen.7 Für die zweite Projektphase ist geplant,
Das Zeitungsportal wird folgende Funktionen an- weitere Workflows zu etablieren, die es dann auch
bieten: ermöglichen, Zeitungsdaten in anderen Formaten
– übergreifende Volltextsuchen in den digitalisier- in das Portal einzuspielen.
ten Zeitungsbeständen,
– unterschiedliche Einstiegspunkte, zum Beispiel
über Kalender und Zeitungstitel, Aktueller Stand und Ausblick
– einen unmittelbar in die Portalumgebung inte
grierten Viewer für Volltexte und Images, Bisher haben sich die Arbeiten am nationalen Zei-
– persistente Referenzierbarkeit und damit Zitati- tungsportal darauf konzentriert, Konzepte zu er-
onsfähigkeit der digitalen Zeitungsobjekte. stellen. Darüber hinaus hat ein sehr ertragreicher
Workshop mit der im Projekt eingebundenen wis-
Der Startschuss für das Projekt fiel am 1. Januar senschaftlichen Begleitgruppe stattgefunden. Es
2019. Die Laufzeit beträgt zunächst zwei Jahre. wurde außerdem eine groß angelegte Online-Um-
Eine zweite Projektphase ist bereits geplant. Die frage unter potenziellen Nutzern und Nutzerinnen
Deutsche Nationalbibliothek leitet das Projekt. Zu durchgeführt. Mit mehr als 2.200 ausgefüllten Fra-
den Partnern gehören die Sächsische Landesbiblio- gebogen war der Rücklauf sehr gut.
thek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Sowohl die Ergebnisse des Workshops mit Wissen-
die Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kul- schaftlerinnen und Wissenschaftlern als auch die
turbesitz sowie FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Ergebnisse der Umfrage werden soweit wie mög-
Informationsinfrastruktur. lich in die weitere Entwicklung des Zeitungsportals
Die Deutsche Digitale Bibliothek, an der alle vier einfließen. Aus den engagierten Diskussionen beim
Projektpartner beteiligt sind, soll das Projekt orga- Workshop und der Anzahl sowie den Inhalten der
nisatorisch und technisch umsetzen. Dafür bringt Umfrage-Antworten lässt sich einmal mehr ablesen,
sie ihre bestehende Infrastruktur und ihre stabile dass der Bedarf nach einem nationalen Zeitungs-
Betriebssituation in das Zeitungsportal ein. Darü- portal beträchtlich ist.
ber hinaus verfügt sie als gesamtstaatliches Vorha-
ben über eine langfristige Perspektive.
Mitmachen beim
DDB-Zeitungsportal
Wie die Deutsche Digitale Bibliothek selber hat
sich auch das DDB-Zeitungsportal ein hohes Ziel
gesetzt: Mittelfristig sollen hier alle Bestände digi-
talisierter Zeitungen, die in deutschen Kultur- und
Wissenseinrichtungen aufbewahrt werden, nach-
gewiesen und zugänglich gemacht werden. Dabei
liegt der Fokus zumindest in der ersten Projekt-
phase auf historischem, das heißt rechtefreiem
Material. Konkret sollen zum Start des Portals,
der für Ende 2020 geplant ist, mindestens Bestän-
CC BY-SA 3.0 Dialog mit Bibliotheken 2019/2 13Forum
Anmerkungen
1
Großbritannien: British Newspaper Archive (); Niederlande: Delpher
(); Australien: Trove (); Europa: Europeana Newspapers ()
2
3 Müller, Christa: ANNO – Der digitale Zeitungslesesaal der Österreichischen Nationalbibliothek, in: BIBLIOTHEK – Forschung
und Praxis 2016; 40(1): S. 83–89.
4
Zum Beispiel ZEFYS von der Staatsbibliothek zu Berlin (), digi-
press, das Portal der Bayerischen Staatsbibliothek () oder das Zeitungsportal NRW
()
5 Auszug aus »Empfehlungen zur Digitalisierung historischer Zeitungen in Deutschland (Masterplan Zeitungsdigitalisierung) –
Ergebnisse des DFG-Projektes »Digitalisierung historischer Zeitungen« Pilotphase 2013–2015«, 29.01.2016 (Partner: Staatsbiblio-
thek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Staats- und Universitätsbibliothek Bremen, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und
Universitätsbibliothek Dresden, Deutsche Nationalbibliothek, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Bayerische
Staatsbibliothek).
6 Dabei handelt es sich um: Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Staatsbibliothek zu Berlin
– Preußischer Kulturbesitz, Bayerische Staatsbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, Univer-
sitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Staats- und Universitätsbibliothek Bremen.
7 Hierbei am wichtigsten: Die Metadaten müssen im METS/MODS-Format vorliegen, die Volltexte im ALTO-Format. Außerdem
muss jede Zeitung eine ZDB-ID haben.
14 Dialog mit Bibliotheken 2019/2 CC BY-SA 3.0Forum
Renate Behrens
Warum wir RDA neu implementieren oder
fünf Fragen zum 3R Project
Was ist 3R? wie ein konventionelles Buch gestalteten Oberflä-
che ist ein sogenanntes »Data-Dictionary« gewor-
3R ist die geläufige Abkürzung für das RDA Res den. Diese längst überfällige Entwicklung ist sehr
tructure and Redesign Project1. Es wurde 2016 be- zu begrüßen, bedeutet aber gleichzeitig einen er-
gonnen und wird vom RDA Steering Committee neuten Schulungsbedarf für die Anwendung.
(RSC)2 und den Co-publishers des RDA Toolkit Mit all diesen Veränderungen wurde ein bereits
unter der Federführung des RDA Board durchge- beim ersten Erscheinen der RDA angekündigter
führt. Mit der Veröffentlichung der Beta-Version3 Weg weiter beschritten. Die Öffnung der RDA für
des RDA Toolkit im Juni 2018 und der Stabilisie- weitere Kultureinrichtungen, über den Bibliotheks-
rung des englischen Texts im April 2019 wurden bereich hinaus, ist eine wichtige Anforderung des
wichtige Meilensteine innerhalb des Projekts er- gesamten Projekts gewesen. Viele der bisherigen fes-
reicht. Die englischsprachige Version der RDA wird ten Regelungen wurden zugunsten von Optionen
bis zum Abschluss des 3R Project inhaltlich nicht gestrichen. Dies soll eine viel stärkere Freiheit in
verändert, um vor allem die Übersetzungsarbei- der Entscheidung beim Erfassen von Metadaten
ten nicht zu behindern. Lediglich offensichtliche unterschiedlicher Herkunft und für sehr verschie-
Fehler werden bereinigt. In Abstimmung mit den dene Verwendungszwecke bringen. Hieraus ent-
Anwendergemeinschaften wird im Laufe des Jah- steht jedoch gleichzeitig ein erhöhter Aufwand für
res 2020 entschieden werden, wann das 3R Project die Anwender-Communitys, Regelungen für ihre
zum Abschluss kommen wird. Mit dem offiziellen Bedürfnisse zu definieren und weiter auszuarbeiten.
Ende wird eine Übergangszeit beginnen, in der das
alte und das neue RDA Toolkit für ein Jahr paral-
lel zur Verfügung gestellt werden. Dies geschieht, Warum 3R?
um den Anwendergemeinschaften ausreichend Zeit
für ihre Anpassungsarbeiten zu geben, das heißt zu Mit dem 3R Project wurden grundlegende neue
übersetzen und ihre lokalen Arbeitsdokumente an- Konzepte eingeführt, die zeitgemäße Erschlie-
zupassen. ßungsmethoden ermöglichen sollen. Im Folgenden
Inhaltlich findet im 3R Project eine grundsätzli- sollen einige Beispiele dies verdeutlichen.
che Neustrukturierung statt. Die Resource De-
scription and Access (RDA)4 wurden durchgängig Recording Methods
an das neue Grundlagenmodell IFLA Library Re- Die neuen RDA kennen vier Methoden der Er-
ference Model (IFLA LRM)5 angepasst. Mit einer schließung und ordnen diese den einzelnen Ele-
Ausnahme wurden alle neuen Entitäten des LRM menten zu:
übernommen. Weitaus bedeutender ist jedoch die 1. Unstrukturierte Beschreibung
Übernahme der neuen Konzepte aus dem LRM, 2. Strukturierte Beschreibung
wie Aggregates und Diachronic Works, die zum 3. Identifier
Teil weitreichende Konsequenzen für die praktische 4. IRI (International Resource Identifier)
Erschließung haben. Durch diese standardisierte Form von Erschlie-
Auch formal ist das neue Toolkit stark verändert. ßungsmethoden werden Datenelemente logisch
Es wurde konsequent in eine moderne Webanwen- und nachvollziehbar kategorisiert. Zusammen mit
dung umgewandelt und an die aktuellen techni- der deutlich ausgebauten Möglichkeit, die Her-
schen Gegebenheiten angepasst. Aus einer mehr kunft der Daten zu erfassen (Data Provenance),
CC BY-SA 3.0 Dialog mit Bibliotheken 2019/2 15Forum
bieten sich Wege zum Beispiel maschinell generier- einen Zeitraum hinweg erscheinen wie zum Beispiel
te Daten auf einem Mindestniveau zu erschließen Zeitschriften, Serien und integrierende Ressourcen.
und dies in den Metadaten festzuhalten. Die im Bereits diese beiden Beispiele lassen vermuten, dass
deutschsprachigen Raum vorherrschende Erschlie- die neuen Konzepte der RDA nicht ganz einfach
ßung mittels einer strukturierten Erschließung und in die bestehende Praxis übertragen werden kön-
Identifiern (etwa GND-Nummern) ist eine Kom- nen. Für jedes Konzept muss geprüft werden, ob es
bination aus den beiden mittleren Recording Me- für die Anwendergemeinschaft geeignet ist und wie
thods und somit bereits aktive Praxis. weit es angepasst werden muss.
Manifestation Statement
Als eines der neu eingeführten Elemente ist das Was müssen wir tun?
Manifestation Statement für die künftige Erschlie-
ßung von großem Interesse. Es steht für die direkte Die nun abgeschlossene Restrukturierung der be-
Übertragung von Angaben aus der Vorlage für die stehenden RDA stellen für die Expertinnen und Ex-
Beschreibung eines Elements. Dieses neue Kon- perten in der Regelwerksarbeit eine große Heraus-
zept ist bei der Erschließung vielfältig einsetzbar forderung dar und werden in der nahen Zukunft
und könnte ebenfalls bei maschinellen oder ma- einige Personalressourcen binden. Grundsätzlich ist
schinen-unterstützten Verfahren eingesetzt werden. es wichtig, sich über die neuen Konzepte und ihre
Aber auch bei der konventionellen Erschließung Umsetzung allgemein zu verständigen. Die Verle-
bringt es einen deutlichen Mehrwert, beispielsweise ger der RDA, ALA Publishing, bieten hierfür einige
bei Spezialmaterialien. Allerdings ist das Mainfesta- Webinare an, die zum einen jedoch kostenpflichtig
tion Statement zurzeit noch nicht in den konventi- und zum anderen für den anglo-amerikanischen
onellen Formaten abbildbar und muss erst über die Raum gemacht sind. Aus diesem Grund wird es ei-
zuständigen Gremien eingeführt werden. gene Schulungen und Schulungsmaterialien für den
deutschsprachigen Raum geben, die wie bisher frei
Guidance Chapters zur Verfügung stehen. Zurzeit gibt es noch keine
Im Zuge der Restrukturierung der RDA wurde konkreten Planungen für die Anpassungsschulun-
angestrebt, alle Inhalte von grundsätzlicher Be- gen im deutschsprachigen Raum.
deutung beziehungsweise Regelungen, die sich auf Auch die RDA-Verantwortlichen betonen, dass das
mehrere Elemente beziehen in Guidance Chapters neue RDA Toolkit nicht ohne Community- oder
zu beschreiben, die einen eigenen Teil des RDA sprachbasierte Application Profiles, also Anwen-
Toolkit bilden. Eines der besonders wichtigen Ka- dungsprofile, einsetzbar ist. Diese sind bislang nur
pitel ist das zu Aggregates. Mit der Bezeichnung in wenigen Anwendergemeinschaften vorhanden
Aggregates sind alle Manifestationen gemeint, die und müssen grundsätzlich an die neue Struktur
mehr als eine Expression beinhalten, also aus meh- angepasst werden. Dazu kommt, dass auch die vor-
reren Teilen bestehen. Dieser Gedanke ist nicht neu handenen Arbeitsdokumente, wie Policy Statements
und bereits im ersten Grundlagenmodell der RDA, und Workflows, überprüft und angepasst werden
den Functional Requirements of Bibliographic Re- müssen. Nicht-englischsprachige Anwender und
cords (FRBR), enthalten. Der Begriff wurde jedoch Anwenderinnen müssen ihre Übersetzungen aktua-
im IFLA LRM neu definiert und beschrieben. In lisieren und die neuen Texte in Gänze übersetzen.
den aktualisierten RDA ist dies nachvollzogen und Aufgrund der starken strukturellen Veränderungen
auf die Regelwerksebene heruntergebrochen wor- im neuen Toolkit besteht die erste Aufgabe jedoch
den. So beschreiben die RDA verschiedene Arten darin, die Tauglichkeit der neuen RDA-Regelungen
von Aggregates und Regelungen, wie man diese für die praktische Erschließungsarbeit zu evaluieren.
erschließt. Von vergleichbarer Bedeutung ist das Erste Einschätzungen lassen vermuten, dass hier mit
Kapitel zu Diachronic Works. Als solche werden einem deutlichen Aufwand bei der Anpassung der
Werke bezeichnet, die wie die Aggregates aus meh- Arbeitsdokumente sowie bei den Schulungen für die
reren Teilen bestehen. Im Gegensatz dazu aber über Erschließenden gerechnet werden muss.
16 Dialog mit Bibliotheken 2019/2 CC BY-SA 3.0Forum
Nicht unerwähnt bleiben muss hier auch, dass viele gelungen und sind somit ohne ein Application Pro-
der zurzeit benutzen Formate die neuen Sachver- file in der Praxis nicht anwendbar. Die Mitglieder
halte noch nicht umsetzen können. Es ist also zu der EURIG haben sich bereits im vergangenen Jahr
empfehlen, bei allen Anpassungsarbeiten die For- dazu entschlossen, ein solches Anwendungsprofil
mate und nachgeordneten Systeme mit zu betrach- gemeinsam zu erstellen. Es soll vor allem ein Tool
ten und Veränderungswünsche rechtzeitig in die für die Erschließung in der Praxis sein und den
entsprechenden Gremien zu geben. Kolleginnen und Kollegen aktive Hilfestellung in
ihrer Arbeit geben. Die deutschsprachige Commu-
nity hat seit der Einführung der RDA Erfahrungen
Wie werden wir das tun? mit einem solchen Anwendungsprofil gemacht. Seit
2014 wird hier mit einem Standardelemente-Set9
Die bisherigen Ausführungen machen deutlich, gearbeitet. Dieses wurde im Frühjahr 2019 als
dass es sich beim Umstieg vom alten auf das neue Grundlage für ein mögliches europäisches Appli-
RDA Toolkit nicht nur um einen Übergang von cation Profile übernommen und daraus ein erster
einer alten Website auf eine neue Darstellung han- Entwurf für eine europäische Lösung ausgearbeitet.
delt. Folgerichtig wurde bereits vor einiger Zeit ein Das RSC hat diesen Entwurf zum Anlass genom-
3R-DACH-Projekt für den deutschsprachigen Raum men, eine RSC Application Profile Working Group
aufgelegt. Alle Anpassungsarbeiten in den nächsten einzuberufen. Diese Working Group wird sich sehr
Monaten werden in der bestehenden Gremienstruk- allgemein über Application Profiles für den Stan-
tur6 für Österreich, Deutschland und die deutsch- dard RDA austauschen, während die EURIG an ih-
sprachige Schweiz durchgeführt. Auftraggeber ist rem Vorhaben, ein Arbeitsinstrument für die Praxis
der Standardisierungsausschuss. Er trifft auch die zu erstellen, festhalten wird und die Arbeiten in
strategischen Entscheidungen. Auf der Arbeitsebe- ihrem Editorial Committee fortführen wird. Dar-
ne werden die Fachgruppen Erschließung und Da- über hinaus haben sich die Mitglieder der EURIG
tenformate mit ihren untergeordneten Arbeits- und auf eine weitere Zusammenarbeit im Interesse der
Themengruppen die fachliche Durchführung aller Austauschbarkeit und Vergleichbarkeit von Daten
nötigen Anpassungen übernehmen. Dazu kommen geeinigt und werden weitere Projekte gemeinsam
die Sonderarbeitsgruppen des Standardisierungs- durchführen. Neben dem europäischen Applicati-
ausschusses für die Spezialmaterialien7. Das Projekt- on Profile ist als nächstes konkretes Vorhaben die
management liegt bei der Arbeitsstelle für Standar- Einrichtung einer Arbeitsgruppe geplant, die euro-
disierung der Deutschen Nationalbibliothek, die päische Beispiele für die RDA sammeln und zur
auch für die Übersetzung des neuen RDA Toolkit Verfügung stellen wird. Voraussichtlich im nächs-
verantwortlich ist. Alle internationalen Arbeiten ten Jahr werden die Arbeiten an einem Application
werden von den dafür zuständigen Kolleginnen in Profile für Musikressourcen aufgenommen.
der Deutschen Nationalbibliothek übernommen,
die sowohl im RDA Board als auch im RSC für die
europäischen Belange zuständig sind. Was ist im deutschsprachigen
Es besteht Konsens, dass alle Anpassungsarbeiten Raum zu erwarten?
im deutschsprachigen Raum einen starken Fokus
auf internationale Lösungen haben sollen. Ein Gerade bei einer weltweiten internationalen Zusam-
wichtiger Player in diesem Zusammenhang ist die menarbeit sind viele Faktoren zu berücksichtigen.
European RDA Interest Group (EURIG)8. Die Mit- Die Planungen sind immer abhängig von den glo-
glieder der EURIG sind sich einig, dass sie auch balen Entscheidungen und können sich verändern.
weiterhin internationalen Regelungen den Vor- Nach der Veröffentlichung des stabilen englischen
zug vor nationalen beziehungsweise solchen von Texts der RDA Mitte April 2019 hat der Standar-
sprachgebundenen Communitys geben wollen. disierungsausschuss Anfang Juli beschlossen, das
Hierzu gibt es bereits ein konkretes Vorhaben.So 3R-DACH-Projekt durchzuführen. Die EURIG hat-
enthalten die neuen RDA sehr viele optionale Re- te sich bereits zuvor in ihrem Treffen Anfang Mai
CC BY-SA 3.0 Dialog mit Bibliotheken 2019/2 17Forum
2019 über das weitere Vorgehen verständigt und lerdings noch unberührt. Erst wenn alle notwen-
das RSC wird sich Ende Oktober 2019 in seinem digen Vorarbeiten abgeschlossen und Anpassungs-
jährlichen Meeting über die weiteren Schritte im schulungen durchgeführt sind, kann das neue RDA
internationalen 3R Project beraten. Für die weitere Toolkit eine Basis für die Erschließung in der Praxis
Planung im DACH-Raum ist, wie bereits erwähnt, sein. Schwerpunkt aller Arbeiten in den nächsten
zunächst eine vertiefte Evaluation der neuen Kon- Monaten müssen nun die Vorbereitungen für den
zepte und des Toolkit zu den Konsequenzen für Umstieg auf das neue RDA Toolkit in der prak-
die praktische Anwendung notwendig. Eine belast- tischen Katalogisierung und die Vermittlung an
bare Planung für die nächsten Jahre kann daher erst die Katalogisierenden sein. Alle Änderungs- und
nach diesem Schritt erfolgen. Verbesserungswünsche für die RDA selbst oder
das RDA Toolkit müssen zunächst zurückgestellt
und in das neue reguläre RDA Review-Verfahren
Fazit eingebracht werden. Änderungen, die keine oder
nur sehr geringe Auswirkungen auf die Inhalte des
Das internationale 3R Project bringt eine starke Toolkit und seine Übersetzungen haben, können
strukturelle Veränderung in der Erschließung mit jedoch bereits jetzt vorgeschlagen werden. Das RSC
sich. Viele vertraute Regelungen werden sich än- möchte versuchen, diese auch in der Übergangs-
dern, andere bleiben bestehen. Das Grundlagen- phase einzubringen.
modell LRM hat einige gänzlich neue Konzepte Es bleibt zu wünschen, dass die geplanten inter-
eingebracht, die zunächst verstanden und dann nationalen beziehungsweise europäischen Ansätze
für die Praxis aufgearbeitet werden müssen. Viele zur Zusammenarbeit erfolgreich sein werden, um
Fragen sind hierbei noch offen und werden die Ex- einem der ursprünglichen Ansätze der RDA, dem
pertinnen und Experten, die mit den Anpassungs- internationalen Datentausch zu dienen, weiter
arbeiten betraut sind, in starkem Maße fordern. gerecht werden zu können. Darüber hinaus wäre
Vielleicht werden am Ende die Veränderungen für es wünschenswert, dem Standard RDA eine Wei-
die tägliche Arbeit gar nicht so stark sein. Aber le Kontinuität zu gewähren, damit die weltweite
dies herauszufinden wird einen langen und inten- Community eine Chance hat, sich mit dem Stan-
siven Arbeitsprozess erfordern. Dieser Prozess hat dard sicher zu fühlen und ihre Erschließungspraxis
für den deutschsprachigen Raum bereits begonnen. produktiv zu halten.
Die Arbeit in der Katalogisierung bleibt davon al-
Anmerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
18 Dialog mit Bibliotheken 2019/2 CC BY-SA 3.0Forum
Nathalie Küchler
Deutsche Nationalbibliothek setzt auf
Emulation zur Bestandserhaltung
Lesesäle werden Die Deutsche Nationalbibliothek betreibt EMiL
mit EMiL ausgestattet auf einem Linux-Server, der zugleich an den Ka-
talog und das Archivsystem angeschlossen ist. Der
Gedächtnisinstitutionen bewahren in zunehmen- Aufruf einer EMiL-Bereitstellung erfolgt an Rech-
dem Umfang digitales Kulturgut für die Nachwelt ner-Arbeitsplätzen in den Lesesälen. Dort können
auf. Eine wichtige Strategie zu dessen dauerhafter Benutzerinnen und Benutzer über einen Webbrow-
Erhaltung ist Emulation. Allerdings setzen Ge- ser auf das Katalogsystem zugreifen, Publikationen
dächtnisinstitutionen bislang nur vereinzelt auf die- recherchieren und direkt aus deren Datensätzen
se Technologie. Verantwortlich dafür ist nicht nur EMiL starten. Damit die Bereitstellung via EMiL
die Komplexität von Emulationslösungen, sondern funktioniert, müssen die Zugriffsrechner mit ei-
auch die Notwendigkeit der Lizenzierung von Be- nem aktuellen Browser wie etwa Google Chrome,
triebssystem-Software. Mozilla Firefox oder Safari ausgestattet sein. Prin-
Gemeinsam mit vier Partnern hat die Deutsche zipiell könnte EMiL als Cloudbasierte Bereitstel-
Nationalbibliothek im DFG-geförderten Projekt lungslösung per Online-Zugriff auch von externen
EMiL, kurz für Emulation of Multimedia Objects Rechnern angesteuert werden – vorausgesetzt der
in Libraries, eine praxistaugliche Lösung entwickelt, externe Zugriff auf Publikationen und emulierte
die gezielt für den Einsatz in Lesesälen konzipiert Systeme ist lizenzrechtlich zulässig.
wurde. Mit der Einführung von EMiL in Leipzig
und Frankfurt am Main hat die Deutsche Natio-
Wie funktioniert die
nalbibliothek Praxiserfahrungen gesammelt, die
Erhaltungsstrategie Emulation?
anderen Gedächtnisinstitutionen als Orientierung
dienen können. Unterstützt wurde sie dabei vom Emulation kann auf den drei Ebenen von Anwen-
Unternehmen OpenSLX, das von der Universität dungssoftware, Betriebssystemen oder Hardware
umgesetzt werden. Für die Anforderungen von
Freiburg nach Projektende gegründet wurde1.
Gedächtnisinstitutionen ist die Hardware-Emulation
am besten geeignet. Dabei wird die für ein Betriebs-
system notwendige Hardware-Umgebung in Software
Das EMiL-System nachgebildet, um sie auf einer aktuellen Plattform
betreiben zu können. So lassen sich nahezu beliebige
historische und sogar plattform-inkompatible Betriebs-
Das EMiL-System ist ein Emulations-Framework, systeme auf aktueller Hardware nutzen3.
in das Hardware-Emulatoren und Systemumge-
bungen eingebettet werden. In EMiL werden sie
als Basisumgebung verwaltet, die aus drei Ebenen
besteht: einem Emulator, einem Festplatten-Ab- Bereitstellungskomponenten
bild mit dem installierten Betriebssystem und ei- von EMiL
ner Konfigurationsebene beziehungsweise optional
installierter Anwendungssoftware. Diese Systemar- Bei EMiL-Bereitstellungen spielen bis zu fünf
chitektur erlaubt es, einen Emulator, der zu aktu- Komponenten zusammen: (1) elektronische Pu-
eller Hardware inkompatibel geworden ist, auszu- blikationen, (2) das EMiL-Framework, (3) Hard-
tauschen, ohne die darüber liegenden Ebenen der ware-Emulatoren, (4) emulierte Betriebssysteme
Basisumgebung anpassen zu müssen2. und gegebenenfalls (5) zusätzlich benötigte Anwen-
dungssoftware. Jede dieser Komponenten verfügt
CC BY-SA 3.0 Dialog mit Bibliotheken 2019/2 19Forum
über individuelle urheber- und lizenzrechtliche EMiL und die Nachhaltigkeit des emulationsbasier-
Bestimmungen, die ihre Nutzungsrechte regulieren. ten Bereitstellungsansatzes in Gedächtnisinstitutio-
Die deutsche Gesetzgebung räumt der Deutschen nen sollen befördert werden.
Nationalbibliothek ein Mandat zur Sammlung aller Dass sich das Open-Source-Prinzip bewährt, zeigen
deutschen und deutschsprachigen Publikationen die in EMiL eingebundenen Emulatoren: Hier
ein. Das Gesetz ruft sie ausdrücklich dazu auf, ihre kommen Hardware-Emulatoren zum Einsatz, die
Bestände »auf Dauer zu sichern und für die Allge- von nicht-kommerziellen Initiativen entwickelt und
meinheit nutzbar zu machen«. gepflegt werden. Ein Beispiel ist der QEMU-Emu-
Während die Verwertungs- und Vervielfältigungs- lator, mit dem sich verschiedene Hardware-Um-
rechte für eine sammelpflichtige Publikation bei gebungen nachbilden und unterschiedliche Platt-
ihrem Urheber/ ihrer Urheberin oder der/dem formen emulieren lassen. Die QEMU-Software ist
Nutzungsberechtigten liegen, erlaubt das Urheber- unter der GNU General Public License Version 2
rechtsgesetz Archiven und öffentlich zugänglichen veröffentlicht. Diese gestattet nicht nur die Nut-
Bibliotheken, die im öffentlichen Interesse tätig zung der Software, sondern auch deren Verände-
sind und keine unmittelbaren oder mittelbaren rung und Weiterverbreitung.
kommerziellen Zwecke verfolgen, eine Vervielfälti- Die Emulatoren unterliegen hohen Qualitäts- und
gung zum Zweck der Langzeitarchivierung (§ 60e Authentizitätsansprüchen ihrer Entwicklungs- und
Abs.1 UrhG). Die Deutsche Nationalbibliothek Anwendungs-Communities. Allerdings sind deren
erstellt digitale Sicherungskopien ihrer Multime- Anwendungsbereiche und die von Gedächtnisinsti-
dia-Bestände in Disk-Image-Formaten wie ISO oder tutionen nicht deckungsgleich.
Cue-Bin, die sie an den elektronischen Arbeitsplät- Der Anwendungsfokus der frei veröffentlichten
zen in ihren Lesesälen bereitstellt und in ihrem Emulatoren richtet sich insbesondere auf histo-
Langzeitarchiv aufbewahrt. rische Gaming-Software, das heißt auf komplexe
Sofern Publikationen nicht ausdrücklich als frei interaktive Objekte. Die Emulatoren eignen sich
nutzbare Werke abgeliefert werden, ist der Zugriff daher ideal für die Bereitstellung technisch an-
auf die (elektronischen) Lesesaal-Arbeitsplätze der spruchsvoller Publikationen mit interaktiven oder
Deutschen Nationalbibliothek beschränkt. Dies multimedialen Inhalten wie etwa Lernsoftware,
betrifft den überwiegenden Teil der multimedialen Datenbanken oder digitalen Enzyklopädien. An-
Bestände. dere Anwendungsfelder lassen sich mit ihnen nur
bedingt bedienen – das betrifft beispielsweise die
Bereitstellung von Audio-Tracks, die auf einer Hy-
DFG-Projekt EMiL brid-CD enthalten oder als Audio-CD Teil einer
mehrteiligen Publikation sein können. Die beiden
Das EMiL-System ist ein von der Deutschen For- Anwendungsbeispiele zeigen: frei verfügbare Frem-
schungsgemeinschaft (DFG) gefördertes Projekt. dentwicklungen reduzieren die eigenen Entwick-
Um seine Nachnutzung weiteren Gedächtnisinsti- lungsaufwände für Gedächtnisinstitutionen zwar
tutionen zu ermöglichen, wurde es 2016 als freie erheblich, sie erübrigen sie aber nicht gänzlich.
Software veröffentlicht. Auch die Plattform Linux,
auf der EMiL betrieben wird, ist ein freies System.
Der Freeware-Grundsatz wurde bei anschließenden Rechtliche Rahmenbedingungen
Weiterentwicklungen beibehalten: Im Zuge der In-
tegration des Systems in den Lesesälen der Deut- Die Rechteinhabenden von Computer-Plattformen
schen Nationalbibliothek wurden in Zusammen- und Betriebssystemen üben ihr Recht, die Nutzung
arbeit mit OpenSLX weitere Funktionen ergänzt, eines Werks zu reglementieren aus, indem sie sie
die ebenfalls zur freien Nachnutzung zur Verfü- an Lizenzbedingungen knüpfen. Offene Lizenzie-
gung gestellt werden. Dabei werden ganz bewusst rungsmodelle haben sich in diesem Kontext bis-
weitreichende Nutzungs- und Modifikationsrechte lang wenig durchgesetzt. Bevor die Deutsche Nati-
eingeräumt. Denn der langfristige Fortbestand von onalbibliothek EMiL in ihren Lesesälen integrieren
20 Dialog mit Bibliotheken 2019/2 CC BY-SA 3.0Sie können auch lesen