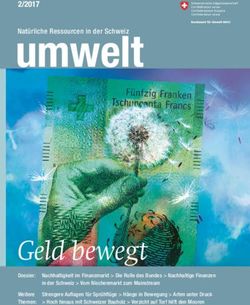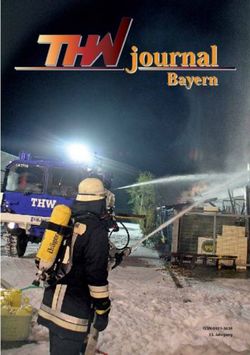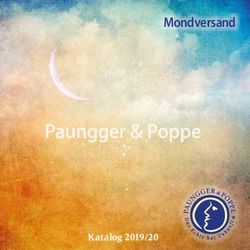Umwelt - Anpassung an den Klimawandel 3/2017 - Bundesamt für Umwelt
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
DOSSIER ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL < umwelt 3/2017
3/2017
umwelt
Natürliche Ressourcen in der Schweiz
Anpassung
an den Klimawandel
Dossier: Risiken und Chancen im Klima der Zukunft > Hitze in den Städten > Wasserknappheit
> Gemeinde Guttannen: Leben mit Naturgefahren
Weitere Die alten Lasten im Griff > Neue Karten für die Hochwasserprävention > Wenn der Lärm
Themen: im Stadion nervt > Freiwillige auf Pflanzensuche > Bahn 2000 im Artencheckumwelt 3/2017
In grösseren Zeiträumen
denken und handeln
Die Folgen des Klimawandels sind schneller sicht- und spür-
bar, als es uns lieb sein kann. Davon habe ich mir kürzlich
auf einer Reise in die Arktis selbst ein Bild gemacht: Das
Eis schmilzt in rasantem Tempo; ein so milder Winter wie
der vergangene wurde dort noch nie beobachtet. Daher
befürchten Klimaforscher, der erste meereisfreie Sommer
am Nordpol könnte bereits in wenigen Jahren Tatsache sein.
Das wäre zwei Jahrzehnte früher als bisher angenommen.
Auch in der Schweiz ist der Klimawandel längst im Gang. Wenngleich
die Folgen hier nicht derart dramatisch sind wie am Nordpol: Schwer
wiegen sie allemal. Doch zeigen sie sich mitunter erst in den kom-
menden Jahrzehnten. Das macht es so schwierig, den Menschen die
Tragweite des Klimaproblems vor Augen zu führen. Weshalb sollten
uns Dinge kümmern, die wir uns kaum vorstellen können und die erst
nachfolgende Generationen wirklich betreffen?
Beim Klimaschutz ist Denken und Handeln in grösseren Zeiträumen
nötig. Die Folgen des Klimawandels gehen uns alle an. Verantwortlich
sind wir für unser Tun, aber auch für das Nichtstun. Die Schweiz hat
schon viel unternommen; auch mit wirkungsvollen Massnahmen im
Ausland. Der Bundesrat wird im Herbst die nationale Umsetzung des
Pariser Abkommens bis 2030 präsentieren. Die Schweiz will nochmals
weniger Treibhausgase ausstossen. Deshalb setzen wir auf techno-
logische Fortschritte, strengere technische Vorschriften und griffige
Gesetze. Aber wir stehen gleichzeitig vor der Herausforderung, die
Gesellschaft auf nicht mehr zu vermeidende Klimaschäden und -risiken
vorzubereiten. Die Anpassungsstrategie des Bundesrates und der
dazugehörige Aktionsplan helfen dabei – aufbauend auf den langen
Erfahrungen der Schweiz im Umgang mit Naturgefahren. Inzwischen
sind viele Kantone aktiv geworden und haben eigene Strategien ent-
wickelt. Die Schweiz tut gut daran, bereits heute konkrete Massnahmen
für das Leben in einem veränderten Klima vorzusehen. Auch bei der
Anpassung gilt: Vorbeugen ist besser als heilen. Wir werden so oder so
mit den neuen klimatischen Realitäten leben müssen. Warten wir un-
nötig länger zu, werden uns die Anpassungen teuer zu stehen kommen.
Doris Leuthard, Bundespräsidentin und Vorsteherin des Eidgenössischen
Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)
2umwelt 3/2017
Dossier Anpassung
an den Klimawandel
4 Gewinner und Verlierer im Klima der Zukunft
Welche Risiken und Chancen kommen auf die Schweiz zu?
8 Die Geschichte vom Mann, der mit seiner Insel versinkt
Anpassung an den Klimawandel in den Kantonen
11 «Die Risikoanalysen trugen wesentlich zur Sensibilisierung bei»
Interview zur föderalen Zusammenarbeit bei der Klimaanpassung
14 ____ Mehr Grün und Blau als Grau
Städte und Agglomerationen leiden besonders unter der Klimaerwärmung.
18 Was tun, wenn das Wasser knapp wird?
Baselland plant den Umgang mit Trockenheit
21 Ein Dorf macht sich Gedanken über den Klimawandel
Guttannen und die Naturgefahren der Zukunft
26 ____ Trockenstress verändert den Schweizer Wald
Folgen des künftigen Klimas für die Forstwirtschaft
29 Trotz erhöhter Temperatur gesund
Die Schweiz ist gegen Gesundheitsrisiken gewappnet.
33 «Unser Gehirn ist auf das unmittelbare Überleben programmiert»
Der Zürcher Hirnforscher Martin Meyer im Gespräch
Weitere Themen
39 Der Mehrfachschlüssel zum Sanierungserfolg
Bewältigung von grossen Altlasten
42 Quantensprung für die Prävention von Wasserschäden
Gefährdungskarte für den Oberflächenabfluss
46 Bei Sportanlässen stört vor allem das Drumherum
Überarbeitete Vollzugshilfe zum Sportlärm
48 Ein unglaubliches Citizen-Science-Projekt
52
Rote Liste der Pflanzen
____ Ein Grossprojekt auf dem Prüfstand
Ökologische Erfolgskontrolle an der Bahn-2000-Strecke
Documenta Natura
Herausgeber: Bundesamt für Umwelt BAFU • 3003 Bern • +41 58 462 93 11 • www.bafu.admin.ch • info@bafu.admin.ch
Gratisabo: www.bafu.admin.ch/leserservice • Das Magazin im Internet: www.bafu.admin.ch/magazin2017-3
Titelbild: Rubriken 36__ Vor Ort 60__ Tipps
Damit die Schweizer Landwirtschaft auch im künftigen 38__ International 61__ Impressum
Klima gedeiht, braucht es unter anderem eine gute
Bodenstruktur. In Feldversuchen haben Forschende von 57__ Bildung 62__ Aus dem BAFU
Agroscope, dem Kompetenzzentrum des Bundes für land- 58__ Recht 63__ umwelt unterwegs
wirtschaftliche Forschung, bodenschonende Bewirtschaf- 58__ Publikationen
tungspraktiken untersucht.
Alle Bilder im Dossier: Flurin Bertschinger/Ex-Press/BAFU,
ausser wo angegeben
3umwelt 3/2017 > DOSSIER ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL
RISIKEN ÜBERWIEGEN CHANCEN
Gewinner und Verlierer
im Klima der Zukunft
Welche Risiken und Chancen kommen mit dem sich ändernden Klima auf die Schweiz zu?
Fallstudien aus allen Gebieten des Landes liefern ein differenziertes Bild. Doch eines steht
fest: Obwohl der Klimawandel auch Chancen eröffnet, überwiegen die Risiken bei Weitem.
Daher hat ein wirksamer Klimaschutz erste Priorität. Text: Kaspar Meuli
Wir sind vielseitigen Risiken ausgesetzt. Und wir und die zu erwartende Entwicklung bis ins Jahr Der Klimawandel be-
leben in einer Gesellschaft, die erwartet, dass wir 2060. Die Liste umfasst einige Chancen und rund günstigt die Ausbreitung
uns so gut wie möglich dagegen absichern. Auch 20 prioritäre Klimarisiken – von bereits länger bislang unbekannter
der Klimawandel bringt Unsicherheiten mit sich. diskutierten Auswirkungen der zunehmenden Schädlinge, die für unsere
Nur folgerichtig also, dass seine Auswirkungen Hitze und Trockenheit bis zu weniger bekann- Kulturpflanzen zum
ebenfalls aus einer nüchternen Risikoperspek- ten Risiken wie der Ausbreitung von invasiven Problem werden. Im
tive betrachtet werden – etwas, was zum Bei- gebietsfremden Arten. Als prioritär gelten ins- Kanton Genf werden
spiel Rückversicherer wie Swiss Re seit Längerem besondere Risiken, die im Vergleich zu heute Methoden und Instrumen-
tun. in den kommenden 45 Jahren besonders stark te entwickelt, die auf-
Nun hat auch das BAFU in einer gross ange- zunehmen könnten. zeigen, welche Pflanzen
legten Studie Klimarisiken systematisch eruiert. «Bis anhin hat man die Folgen des Klimawan- und Insekten in
Nach England ist die Schweiz erst das zweite dels vor allem für einzelne Sektoren wie Wasser- der Landwirtschaft
Land, das dies getan hat. Der Bericht, der Ende wirtschaft, Tourismus, Naturgefahren oder künftig grossen Schaden
2017 veröffentlicht wird, befasst sich mit den Gesundheit beurteilt», so Pamela Köllner, «in anrichten könnten.
klimabedingten Risiken und Chancen in der unserer Untersuchung wollen wir hingegen eine
Schweiz. Die Analyse soll im Sinne des Risi- gesamtheitliche Sicht auf die Schweiz bieten.»
komanagements als Grundlage dafür dienen, Dazu wurden in 8 Kantonen Fallstudien zu
Klimastrategien zu entwickeln und Anpas- Grossräumen durchgeführt. Sie betreffen den
sungsmassnahmen zu priorisieren. «Wir haben Jura, das Mittelland, die Voralpen, die Alpen, die
Risiken für ausgewählte Schweizer Grossräume Südschweiz und die grossen Agglomerationen.
systematisch bestimmt», erklärt Pamela Köllner, Untersucht wurden die Kantone Jura, Aargau,
die Leiterin des Projekts. «Zudem haben wir die Freiburg, Uri, Graubünden, Tessin, Basel-Stadt
Chancen analysiert, die sich für die Schweiz aus und Genf.
dem Klimawandel ergeben könnten.» Um die angestrebte gesamtheitliche Sicht zu
erreichen, war ein einheitliches methodisches
Gesamtheitliche Sicht auf die Schweiz Vorgehen gefragt. Dazu gehören auch die An-
Das Resultat dieser Analyse, in die unter ande- nahmen über die Klimaänderung selbst: Sie
rem mehr als 400 Experten und Expertinnen stützen sich auf ein Szenario mit einer mittleren
aus der Praxis und von kantonalen Fachstellen Erwärmung, die in der Schweiz bis 2060 einem
miteinbezogen waren, ist ein Überblick über Anstieg der Temperaturen im Sommer um
die bereits spürbaren Folgen des Klimawandels 3,5 Grad gleichkommt (Referenzperiode ist
4umwelt 3/2017 > DOSSIER ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL
1980–2009). Die mittlere Niederschlagsmen- um über 5 Prozent. Drei Viertel der Verstorbenen
ge dürfte in diesem Zeitraum im Sommer um waren über 75 Jahre alt. Verschärft wird das Ri-
20 Prozent ab- und im Winter um 20 Prozent zu- siko dadurch, dass die Bevölkerung immer älter
nehmen. Dies im Vergleich zur Referenzperiode wird und immer mehr Leute in dicht besiedelten
1980 bis 2009. Ebenfalls einheitliche Annahmen Gebieten leben, die am stärksten von der Hitze-
wurden in Bezug auf die sozioökonomischen und belastung betroffen sind (siehe Seite 29 ff.)
demografischen Veränderungen getroffen, die Dieses Risiko ist eine Folge davon, dass mit dem
für das Ausmass der klimabedingten Schäden Klimawandel nicht nur die Durchschnittstempe-
mitbestimmend sind. Mit anderen Worten: Fakto- raturen, sondern auch die Extreme zunehmen.
ren wie das zu erwartende Wirtschaftswachstum Im Jahr 2060 könnte es in Basel so warm sein wie
und die sich abzeichnende Überalterung der heute in Lugano und Locarno. In Genf könnten
Gesellschaft. Verhältnisse herrschen wie heute in Mailand,
und in Lugano dürften die Temperaturen auf
Klimarisiken wirken sich regional unterschiedlich aus Werte steigen, wie sie heute Florenz und Rom
Die 6 untersuchten Grossräume (siehe Grafik auf kennen.
Seite 7) sind unterschiedlich stark von den iden-
tifizierten Risiken betroffen. Waldbrände etwa Steigende Konkurrenz ums Wasser
werden vor allem das Tessin vor Probleme stellen, Die zunehmende Sommertrockenheit könnte
wo ihre Zahl bis 2060 um ein Viertel zunehmen künftig auch im Wasserschloss Schweiz vermehrt
dürfte. In der übrigen Schweiz könnten sich in zu lokaler, zeitlich begrenzter Wasserknappheit
Zukunft insbesondere Regionen mit grösseren führen, wie das 2003, 2006 und 2015 der Fall
Herausforderungen konfrontiert sehen, die bis war, und so Nutzungskonflikte verschärfen.
anhin von Waldbränden verschont geblieben Knapp wird das Wasser dann, wenn das Ange-
bot die Nachfrage nicht mehr decken kann. Der
Klimawandel wirkt sich auf beide Schalen dieser
Während von einer Zunahme von Hitzewellen Waage aus. Zum einen könnte die Wasserverfüg-
auszugehen ist, lässt sich bislang nicht sagen, ob barkeit aufgrund häufigerer Trockenperioden ab-
Hagel- und Sturmschäden zu- oder gar abnehmen nehmen, zum andern ist die Nachfrage gerade in
Trockenperioden zum Beispiel für Bewässerung
werden. besonders gross. In Zeiten der Knappheit dürfte
sich die Konkurrenz ums Wasser verstärken –
waren, sich jedoch aufgrund des Klimawandels etwa zwischen Skigebieten, die im Sommer
auch mit diesem Risiko auseinandersetzen müs- Reserven für die künstliche Pistenbeschneiung
sen. Zum Beispiel Regionen nördlich der Alpen. anlegen wollen, und der Landwirtschaft, die
Aber nicht bei allen Aspekten des Klimawandels bewässern möchte. In gewissen Fällen betrifft
ist der Wissensstand gleich gross. Während von der Konflikt auch das Trinkwasser. Im Kanton
einer Zunahme von Hitzewellen auszugehen Graubünden etwa ist heute ein Drittel des zum
ist, lässt sich bislang nicht sagen, ob Hagel- und Bewässern benötigten Wassers Trinkwasser. Und
Sturmschäden zu- oder gar abnehmen werden. in der Unterengadiner Gemeinde Scuol entspricht
Doch wie sehen die Klimarisiken in der Schweiz das zum Beschneien verwendete Wasser gegen
im Einzelnen aus? Hier einige Erkenntnisse: Be- 40 Prozent des lokalen Trinkwasserverbrauchs.
sonders in tiefen Lagen und grossen Agglomera-
tionen, wo die meisten Menschen leben, werden Klimawandel belastet Allergiker
im Sommer häufigere und intensivere Hitzepe- Auch mit Blick auf die Umwelt bringen klima-
rioden zur Belastung. Ein Risiko stellt die zu- bedingte Veränderungen Risiken mit sich –
nehmende Hitze vor allem für die Gesundheit angefangen bei der steigenden Waldgrenze
dar. Unter allen Naturereignissen verursachten und höheren Wassertemperaturen bis hin zur
Hitzewellen in Europa in den vergangenen Jahr- Ausbreitung exotischer Pflanzen und Tiere. Be-
zehnten die meisten Todesfälle. Und auch in der reits heute zählt man in der Schweiz 800 nicht
Schweiz wirkten sie sich auf die Sterblichkeit aus: heimische Arten, von denen rund 100 als beson-
Zwischen Juni und August 2015 starben rund ders invasiv oder potenziell gefährlich gelten.
800 Personen mehr als in einem normalen Som- Dazu gehört zum Beispiel der Riesen-Bärenklau,
mer. Das entspricht einer Zunahme der Todesfälle der nach Hautkontakt verbrennungsartige Ent-
6DOSSIER ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL < umwelt 3/2017
zündungen verursacht. Der Klimawandel kann
dazu führen, dass die gebietsfremden Arten
günstige Bedingungen für das Überleben und
die Fortpflanzung in der Schweiz vorfinden und
heimische Arten verdrängen.
Gebietsfremde allergene Pflanzen etwa haben
sich bereits in den vergangenen Jahren in der
Schweiz verbreitet. So zum Beispiel das Bei-
fussblättrige Traubenkraut (Ambrosia), das bei
10 Prozent der Schweizer Bevölkerung allergische
Reaktionen oder Asthma verursacht. Ganz allge-
mein dürfte der Klimawandel zu einem früheren
Beginn und einer Verlängerung der Pollensai-
son führen. Diese Entwicklung betrifft immer
mehr Menschen, zeigen doch bereits heute rund
15 Prozent der Erwachsenen eine allergische
Reaktion auf Pollen.
Risiken überwiegen Chancen
Die neue Studie will nicht nur Klimarisiken be- Um eine gesamtheitliche Sicht auf die Folgen des Klimawandels zu haben,
leuchten, sondern auch Chancen aufzeigen, die wurden in den 6 Grossräumen Fallstudien durchgeführt. Quelle: BAFU
sich aus dem sich wandelnden Klima ergeben.
Doch Pamela Köllner stellt klar: «Auffallend ist, Für zentrale Fragen wie «Welche Massnahmen
dass weit mehr prioritäre Risiken als Chancen haben das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis?» bie-
identifiziert wurden.» Tatsächlich ergeben sich in tet der Bericht zwar eine umfassende Grundlage.
der Praxis klimabedingte Chancen vor allem der Sie müssen jedoch anhand weiterer Analysen
steigenden mittleren Temperaturen wegen. Von beantwortet werden. «Bei gewissen Risiken lohnt
dieser Entwicklung könnte die Landwirtschaft es sich, Massnahmen jetzt zu ergreifen», erklärt
profitieren, da sich die Vegetationsperiode verlän- Pamela Köllner. So würden beispielsweise schon
gern und die Ernteerträge zunehmen dürften – heute Hitzewarnungen und Verhaltensempfeh-
allerdings nur, wenn genügend Nährstoffe und lungen bei Hitzewellen ausgesprochen. «Wo die
Wasser vorhanden sind. Auch für die Winzer Unsicherheiten noch sehr gross sind, gilt es, ein
könnte die Temperaturveränderung positive Fol- Monitoring aufzubauen, um die Entwicklung der
gen haben, da sich künftig eine breitere Palette Risiken genau zu beobachten.»
von Traubensorten anbauen lässt. Die zunehmen- Eines allerdings steht fest, nämlich dass die
de Trockenheit schafft in den Rebbergen aber Schweiz dem Klimawandel nicht nur mit Anpas-
auch Probleme, zum Beispiel mit der Qualität sungsmassnahmen begegnen kann. Nötig sind
der Trauben. Dem Sommertourismus wiederum vor allem Anstrengungen, um die klimatischen
winken neue Gäste, falls die alpine Sommerfri- Veränderungen abzuschwächen. Der Weg dazu
sche auf Kosten der Strandferien am Mittelmeer ist klar. Wir müssen viel weniger Treibhausgase
beliebter wird. Und nicht zuletzt darf sich die ausstossen als bis anhin und somit unseren Bei-
ganze Schweizer Bevölkerung der milderen Win- trag zur Reduktion leisten. Nur so lassen sich die
ter wegen auf tiefere Heizkosten freuen. Klimarisiken langfristig vermindern.
Hitzewarnungen und Verhaltensempfehlungen
bei Hitzewellen
Weiterführende Links zum Artikel:
So weit die Analyse, doch welche Taten müs-
www.bafu.admin.ch/magazin2017-3-01
sen folgen, um die Schweiz für das Leben mit
Klimarisiken tauglich zu machen? Der Bericht KONTAKT
beschränkt sich auf eine Analyse der Risiken Pamela Köllner
Sektion Klimaberichterstattung und -anpassung
und Chancen. Auf konkrete Massnahmen, die BAFU
der Schweiz eine Anpassung an den Klimawandel +41 58 462 06 34
ermöglichen sollen, geht er nur am Rande ein. pamela.koellner@bafu.admin.ch
7umwelt 3/2017 > DOSSIER ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL
ANPASSUNG IN DEN KANTONEN
Die Geschichte vom Mann,
der mit seiner Insel versinkt
Neben dem Bund beschäftigen sich auch die Kantone mit den Folgen des Klimawandels; sie entwickeln
zunehmend eigene Strategien und Anpassungsmassnahmen. Besonders wichtig dabei ist, dass auch die
Regionen und Gemeinden miteinbezogen werden. Text: Lukas Denzler
Der Klimawandel wird immer mehr sicht- und habe, liege wohl an der Bedrohung durch Na-
spürbar: schmelzende Gletscher, schneearme turgefahren, den unterschiedlichen Klimazonen
Winter, Hitzewellen und Trockenheit. An diese und der Abhängigkeit des Wintertourismus vom
Entwicklungen gilt es sich anzupassen. 2012 ver- Schnee, sagt Georg Thomann vom kantonalen
abschiedete der Bundesrat deshalb seine Strategie Amt für Natur und Umwelt. 2015 veröffentlichte
zur Anpassung an den Klimawandel. Zwei Jahre der Kanton je eine Studie zur Klimaanpassung,
später folgte mit dem Aktionsplan der zweite zum Klimaschutz und zu den mit dem Klima-
Teil. «Wichtig ist nun, dass auch die Kantone sich wandel verbundenen Risiken und Chancen. Die
Gedanken machen und Massnahmen einleiten, Synthese dieser drei Studien führte zur kanto-
nalen Klimastrategie. Darin sind 10 Handlungs-
schwerpunkte enthalten.
Die Bündner Regierung ent- Die Bündner Regierung entschied, einen
schied, einen Lenkungsausschuss, Lenkungsausschuss, ein Klimaforum sowie ein
ein Klimaforum sowie ein Klimasekretariat zu schaffen. «Im Klimaforum
sind 12 kantonale Ämter sowie die Gebäudever-
Klimasekretariat zu schaffen. sicherung Graubünden vertreten», sagt Georg
Thomann, der für das Klimasekretariat und das
Klimaforum verantwortlich ist. Dort laufen die
um die Folgen abzufedern und sich bietende Fäden zusammen. Es sei wichtig, betont er, die «Der Klimawandel findet
Chancen zu nutzen», sagt Roland Hohmann, Regionen und Gemeinden in den Prozess der statt. Heute und vor un-
Sektionschef Klimaberichterstattung und -an- Bewältigung des Klimawandels einzubinden. So serer Haustür.» Diese Bot-
passung beim BAFU. «Weil sich die Herausforde- wurde zum Beispiel im Rahmen eines durch den schaft will die Gemeinde
rungen je nach Region unterscheiden, müssen Bund unterstützten Pilotprojekts für die Region Davos im Rahmen einer
die Kantone ihre eigenen Handlungsfelder und Surselva eine Klima-Toolbox entwickelt – ein Sensibilisierungskampa-
Ziele definieren.» Der Bund biete ihnen dabei Werkzeugkoffer zum Umgang mit dem Klima- gne ihren Bürgerinnen
vielfältige Unterstützung, so Roland Hohmann wandel auf regionaler Ebene. Er enthält unter und Bürgern vermitteln.
(siehe Interview Seite 11 ff.). Mehrere Kantone anderem Informationsmaterial dazu, wie sich die Genauso wie den Touris-
haben das Thema bereits aufgegriffen. Nach- klimatischen Änderungen auf den Lebens-, Wirt- ten. Dazu wurde ein Film
folgend vier Beispiele mit den jeweiligen Schwer- schafts- und Naturraum der Surselva auswirken. produziert, der die lokalen
punkten. Die Unterlagen und Ideen unterstützen regio- Folgen des Klimawan-
nale Entscheidungsträger dabei, in einem mo- dels aufzeigt – von der
Graubünden entwickelt Werkzeugkoffer für Regionen derierten Prozess einen gemeinsamen Massnah- Gletscherschmelze bis zur
Bereits 2009 liess die Bündner Regierung einen menplan zu entwickeln. Die Erfahrungen seien Verlängerung der Pollen-
ersten kantonalen Klimabericht erarbeiten. Dass positiv, und man wolle dieses Instrument für alle saison. Ein Teaser läuft
sich der Gebirgskanton vergleichsweise früh mit Regionen des Kantons weiterentwickeln, ergänzt auf den Infobildschirmen
den Folgen des Klimawandels auseinandergesetzt Georg Thomann. in den Ortsbussen.
8umwelt 3/2017 > DOSSIER ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL
Die Waadt identifiziert klimabedingte tes Ergebnis ist dabei ein Leitfaden zum «Klima
Herausforderungen wandelCheck» für das Biodiversitätsmanagement
Der Kanton Waadt orientierte sich bei seiner Risi wertvoller Schutzgebiete entwickelt worden. «Ein
koanalyse weitgehend an der Strategie des Bun weiteres Hilfsmittel ist ein Merkblatt zum Thema
des. «Mithilfe von Experteninterviews ermittelten ‹Natur im Siedlungsraum und Klimawandel› für
wir die wichtigsten Herausforderungen», erläutert die Gemeinden», erläutert Norbert Kräuchi. Hier
Tristan Mariethoz von der Direction générale de würden Möglichkeiten aufgezeigt, wie den Folgen
l’environnement des Kantons Waadt. Von den des Klimawandels mit zusätzlichen Grün und
85 ermittelten Problemen sind 10 als prioritär Freiflächen begegnet werden könne. Dabei soll
eingestuft worden. Dazu zählt unter anderem die einerseits ein angenehmeres Lokalklima für
schon länger erkannte Problematik von Bewässe die Menschen geschaffen und andererseits die
rung und Wasserknappheit. Biodiversität gefördert werden (siehe Seite 14 ff.).
Eher überraschend betreffen 6 der 10 prioritä
ren Herausforderungen die Biodiversität. Die Öko Solothurn setzt auf Information
systeme und Arten würden mit zunehmendem Der Kanton Solothurn stützt sich bei der An
Klimawandel noch stärker unter Druck geraten, passung an das sich wandelnde Klima ebenfalls
sagt Tristan Mariethoz. Und zwar nicht nur wegen vorwiegend auf die Bundesstrategie ab – und er
der Klimaveränderung, sondern auch weil das nutzt dabei die im Aargau durchgeführte Studie.
Risiko bestehe, dass Anpassungsmassnahmen in «Der Auslöser, uns mit dem Klimawandel und
anderen Bereichen die Situation der Biodiversität seinen Folgen für den Kanton zu befassen, war
weiter verschlechterten. Dies kann zum Beispiel eine Interpellation im Parlament», erklärt Mar
der Fall sein, wenn Wintersportorte im grossen tin Heeb vom kantonalen Amt für Umwelt. In
Stil Anlagen zur künstlichen Beschneiung bauen der Folge wurden in Solothurn die wichtigsten
oder wenn die Waldwirtschaft vermehrt auf an Bereiche identifiziert, in denen die kantonale
Trockenheit angepasste, aber gebietsfremde Verwaltung im Klimabereich selbst aktiv werden
Baumarten setzt. Eine Gesamtbetrachtung sei kann. Die Spannweite des Aktionsplans reicht
deshalb unerlässlich, betont Tristan Mariethoz. von einer angepassten Wassernutzung über eine
In einem nächsten Schritt werden nun Schwer verbesserte Warnung bei Waldbrandgefahr bis
punkte für eine Roadmap ausgearbeitet. Über die hin zum Schutz der Bevölkerung bei Hitzewellen.
Umsetzung wird anschliessend die neu gewählte Gleichzeitig legt man einen speziellen Fokus auf
Regierung befinden. die Information. Entscheidend, davon ist Martin
Heeb überzeugt, sei dabei die Sensibilisierung
Der Aargau fokussiert auf Biodiversität der Menschen für den Klimawandel und dessen
Auch im Kanton Aargau ist die Biodiversität als Folgen. Dafür werden auch nicht alltägliche
wichtige Herausforderung erkannt worden – dies Mittel eingesetzt: humorvolle Postkarten mit
ergab unter anderem die ChancenRisikoAnalyse, bedenkenswerten Botschaften, Tischsets in den
die im Auftrag des BAFU erarbeitet wurde (siehe Restaurants, die die Auswirkungen des Klima
Seite 4 ff.). Bereits heute leiden viele Arten unter wandels thematisieren, und Klimageschichten,
übermässigen Nährstoff und Schadstoffeinträ in denen unterschiedliche Menschen zu Wort
gen sowie dem steigenden Nutzungsdruck auf kommen und sich Gedanken über unseren Um
die Lebensräume. «Der Klimawandel verschärft gang mit dem Klimawandel machen. Darunter
das Problem zusätzlich», sagt Norbert Kräuchi, etwa der Schriftsteller Franz Hohler. In einer
der Leiter der kantonalen Abteilung Landschaft Kurzgeschichte erzählt er von einem Mann, der
und Gewässer. Da sich die Lebensräume mit fort mit seiner Insel im Meer versinkt und dessen
schreitendem Wandel weiter verändern, ist es für letzter Gedanke war, dass er vielleicht doch mehr
zahlreiche Arten überlebenswichtig, dass sie in für seine Insel hätte tun sollen.
nahe gelegene andere Lebensräume ausweichen
können. Dazu müssen diese heute oft isolierten KONTAKT
Biotope besser vernetzt werden. Roland Hohmann
Eine vertiefte Analyse im Bereich Biodiversität Sektionschef Klimabericht-
erstattung und -anpassung
ermöglichte im Aargau das vom Bund unter Fe
BAFU
derführung des BAFU lancierte Pilotprogramm Weiterführende Links zum Artikel: +41 58 465 58 83
zur Anpassung an den Klimawandel. Als konkre www.bafu.admin.ch/magazin2017-3-02 roland.hohmann@bafu.admin.ch
10DOSSIER ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL < umwelt 3/2017
FÖDERALE ZUSAMMENARBEIT
«Die Risikoanalysen trugen wesentlich
zur Sensibilisierung bei»
Roland Hohmann ist Chef der Sektion Klimaberichterstattung und -anpassung beim BAFU und koordiniert
die Strategie zur Anpassung an den Klimawandel. Im Gespräch erläutert er, wie der Bund und die Kantone
dabei zusammenarbeiten. Interview: Lukas Denzler
umwelt: Herr Hohmann, weshalb ist die Anpassung der Umgang mit Sommertrockenheit, instabilen
an den Klimawandel ein Gebot der Stunde? Hängen, grösseren Hochwasserrisiken usw. Und
Roland Hohmann: Auch wenn es der Staatenge- bei 4 Herausforderungen geht es um Grund-
meinschaft gelingt, die Treibhausgasemissionen lagenbeschaffung, das Schliessen von Wissens-
künftig massiv zu reduzieren, wird die Schweiz lücken, um Monitoring, Koordination sowie
mit weiteren klimatischen Veränderungen Finanzierung.
konfrontiert sein. Wir müssen uns Gedanken
machen, wie wir damit umgehen. 2015 erlebten Wie erfolgt die Zusammenarbeit mit den Kantonen?
wir nach 2003 den zweiten Hitzesommer. Damit Der Bund übernimmt eine koordinierende
verbundene gesundheitliche Probleme ergaben Funktion. In den Sektorpolitiken ist die Umset-
sich vor allem in den Städten. Und das ist nur zung integriert in die normale Zusammenarbeit
ein Themenbereich von vielen, bei denen Hand- zwischen Bund und Kantonen. Hier sind die
lungsbedarf besteht. Programmvereinbarungen ein zentrales Steue-
rungselement. Beim Wald wurde beispielsweise
2012 verabschiedete der Bundesrat die Strategie zur kürzlich das Waldgesetz mit Bestimmungen zur
Anpassung an den Klimawandel, zwei Jahre später Anpassung an den Klimawandel ergänzt. So ist
den Aktionsplan. Welchen Stellenwert haben diese etwa bei der Jungwaldpflege und der Baumarten-
Dokumente auf Bundesebene? wahl die Klimaentwicklung zu berücksichtigen.
Im CO2-Gesetz ist der Auftrag an den Bund for- Im sektorenübergreifenden Bereich sind wir
muliert, Anpassungen an den Klimawandel zu daran, ein Netzwerk aufzubauen. Zusammen
koordinieren und dafür zu sorgen, dass die dafür mit Vertreterinnen und Vertretern der Kantone
nötigen Grundlagen bereitgestellt werden. Die entwickelten wir einen Leitfaden, wie die Kanto-
Anpassungsstrategie und der Aktionsplan setzen ne die Bundesstrategie auf ihr Gebiet herunter-
den Rahmen zur Erfüllung dieses Auftrags. Die brechen können. Mehrere Kantone haben diesen
beiden Dokumente sind partizipativ mit meh- Ball aufgenommen (siehe Seite 8 ff.).
reren Partnerämtern in der Bundesverwaltung
erarbeitet worden. Am Anfang verwendeten wir Welche Rolle spielten die 8 in der ganzen Schweiz
relativ viel Zeit, um ein gemeinsames Verständnis durchgeführten Risikostudien zu den Folgen des
zu entwickeln. Dadurch fand auch ein Sensibili- Klimawandels?
sierungsprozess statt. Die Studien sind so angelegt, dass sie die ganze
Schweiz in ihrer Vielfalt abdecken. Die Risiko-
Welche Themen deckt die Anpassungsstrategie ab? analysen trugen in den Kantonen wesentlich
In dieser Strategie sind 9 Sektoren und Politik- zur Sensibilisierung bei. Oft waren Kantone
felder abgebildet, angefangen bei der Wasser- beteiligt, die bezüglich der Auswirkungen des
wirtschaft über die Land- und Waldwirtschaft Klimawandels und der damit verbundenen Ri-
bis zur Raumentwicklung. Zusätzlich zu den siken und Chancen bisher wenig bis gar nichts
Sektorstrategien sind 12 sektorenübergreifende unternommen hatten. Dank der Studien wurde
Herausforderungen beschrieben. 8 knüpfen ein Prozess angestossen, der Klimawandel wurde
direkt an Folgen des Klimawandels an – etwa zu einem Thema.
11umwelt 3/2017 > DOSSIER ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL
Führten diese Studien auch zu konkreten Projekten? Wahrscheinlich sind Bergkantone und städtische
Zum Teil ja. Dafür ist aber vor allem auch das Kantone vom Klimawandel stärker betroffen als
Pilotprogramm «Anpassung an den Klimawandel» eher ländliche Gebiete in etwas erhöhter Lage.
gedacht. Wir möchten damit Impulse setzen, und Deshalb muss jeder Kanton, jede Region eigene
dabei helfen, Fragen zu beantworten: Wie lässt Antworten auf die neuen Herausforderungen
sich die Umsetzung initiieren? Wie entstehen finden. Die gesetzlichen Vorgaben des Bundes
Projekte auf lokaler, regionaler oder kantonaler verpflichten die Kantone grundsätzlich nicht,
Ebene?
Ist das Pilotprogramm zur «Anpassung an den Klima «Im CO2-Gesetz ist der Auftrag an
wandel» auf Interesse gestossen?
Nach der Ausschreibung im Jahr 2013 erhielten den Bund formuliert, Anpassungen
wir über 100 Projektanträge; davon konnten wir an den Klimawandel zu koordinieren
schliesslich 31 unterstützen. Die Projekte dau-
erten 2 bis 3 Jahre. Die Hälfte der Projektkosten
und dafür zu sorgen, dass die dafür
finanzierten Bundesstellen, die andere Hälfte nötigen Grundlagen bereitgestellt
steuerten Kantone, Gemeinden oder die Regionen werden.» Roland Hohmann, BAFU
bei. Derzeit evaluieren wir das Programm. Und
es finden Gespräche für eine Fortsetzung statt.
Für Anfang 2018 ist eine Ausschreibung geplant.
Läuft alles wie vorgesehen, erfolgt die Auswahl selber aktiv zu werden. Wir spürten bei vielen
der neuen Projekte bis Ende 2018, ab 2019 beginnt Kantonen aber stets ein grosses Interesse. Dank
dann deren Realisierung. eines Vertrauensverhältnisses zu den Akteuren
auf den verschiedenen Ebenen wurden in den
Können Sie einige Beispiele aus der ersten Phase letzten Jahren beachtliche Erfolge erzielt. Und
nennen? das ist eine gute Voraussetzung für eine erfolg-
Im Kanton Aargau ist erkannt worden, dass die reiche Zusammenarbeit. Letztlich geht es darum,
Biodiversität noch stärker unter Druck gerät. dass die Kantone, Regionen und Gemeinden den
Ein Pilotprojekt beschäftigte sich deshalb mit Wandel bewältigen können.
der Frage, wie im Naturschutz auf lokaler Ebene
damit umgegangen werden kann. Ein Projekt im Was braucht es, damit sich die Gesellschaft den Um mit den Folgen des
Berner Oberland fokussierte auf Murgänge und Anpassungsfragen stellt? Klimawandels fertig zu
Felsstürze im Grimselgebiet. Treibende Kraft war Wenn etwas geschieht, passen wir uns sowieso an. werden, muss die Natur
neben den Naturgefahrenfachleuten die Regio- Doch es gibt bessere und schlechtere beziehungs- möglichst widerstandsfä-
nalkonferenz Oberland-Ost. Die gemeinsam ent- weise schmerzvollere Wege der Anpassung. Wir hig sein – auch in über-
wickelte Klimaanpassungsstrategie geht deutlich wollen mögliche Probleme frühzeitig erkennen, bauten Gebieten. Grün-
über die Naturgefahren hinaus: Sie berücksichtigt aber auch die Chancen nutzen, die sich da und räume und Wasserflächen
die nachhaltige Entwicklung im Grimselgebiet dort bieten. Dabei handelt es sich primär um eine im Siedlungsgebiet
unter den Vorzeichen eines sich ändernden Kli- politische Aufgabe. Wenn die Menschen jedoch bieten vielfältige Nischen
mas. In Davos entstanden unter dem Titel «Davos für den Klimawandel und die damit verbundenen für Pflanzen und Tiere;
+ 1,7 Grad» kurze Filmsequenzen. In 2 Minuten Probleme sensibilisiert werden, erreicht man entsprechend gross ist
werden klimabedingte Änderungen, die in der vielleicht auch, dass sie selber einen Beitrag dort die Artenvielfalt. Der
Landschaft Davos bereits heute sichtbar sind, zum Klimaschutz leisten und ihre Treibhausgas- Kanton Aargau hat einen
aufgezeigt – mit dem Ziel, die Menschen für emissionen reduzieren. Der Kanton Solothurn Klimawandel-Check entwi-
den Klimawandel zu sensibilisieren. Auch die beschreitet bei der Kommunikation diesbezüglich ckelt, der den Gemeinden
lokalen Politikerinnen und Politiker reagierten neue Wege, die ich sehr spannend finde. dabei hilft, klimagerechtes
positiv auf das Projekt. Biodiversitätsmanagement
zu betreiben. Wie hier in
Weiterführende Links zum Artikel:
Wie weit fortgeschritten ist die Arbeit Villmergen sollen künftig
www.bafu.admin.ch/magazin2017-3-03
in den Kantonen? an möglichst vielen Orten
Die Kantone sind unterschiedlich weit. Zum Flächen zur Förderung der
Teil widerspiegelt dies auch den Umstand, dass KONTAKT Artenvielfalt im Siedlungs-
nicht alle Kantone gleich stark exponiert sind. Siehe Seite 10. raum geschaffen werden.
12DOSSIER ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL < umwelt 3/2017
13umwelt 3/2017 > DOSSIER ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL
HITZE IN DEN STÄDTEN
Mehr Grün und Blau
als Grau
Städte und Agglomerationen leiden besonders unter der Klimaerwärmung. Immer mehr von ihnen ergreifen aber
Massnahmen, um die Auswirkungen dieser Entwicklung zu mildern. Im Wallis ist die Stadt Sitten/Sion ganz
speziell von diesem Phänomen betroffen. Sie hat ein ehrgeiziges Projekt mit dem Namen ACCLIMATASION lanciert
und will andere Städte von ihren Erfahrungen profitieren lassen. Text: Cornélia Mühlberger de Preux
Sitten ist die Schweizer Stadt, in der sich das jekt am Pilotprogramm «Anpassung an den
Klima am stärksten erwärmt. Innerhalb von Klimawandel» des Bundes teilgenommen hat.
20 Jahren ist die Temperatur im Kantonshauptort Dieses unterstützte zwischen 2014 und 2016
um 1 °C gestiegen, während die Niederschläge 31 Projekte, um die besten Ansätze zur Mini-
um 10 Prozent abgenommen haben. «Im Stadt- mierung der klimabedingten Schäden und zur
zentrum, wo Beton und Asphalt am dichtesten Erhaltung der Lebensqualität der Bevölkerung zu
sind, erstickt man im Sommer fast. Hier manifes- eruieren. Die Projekte dieses Programms beschäf-
tiert sich das berühmte Phänomen der urbanen tigten sich auch mit Themen wie Biodiversität,
Hitzeinseln», erklärt Lionel Tudisco. Der junge landwirtschaftliche Produktion oder Funktionen
Sittener Stadtplaner vergleicht diesen Effekt des Waldes in einem sich verändernden Klima.
mit der Wirkung eines Specksteinofens, der die Sitten wurde für die Umsetzung eines Projekts im
Temperatur speichert und bis am Abend auf- Bereich klimaangepasste Stadtentwicklung aus-
rechterhält. Die Klimaerwärmung verwandelt gewählt. Das Credo des Projekts ACCLIMATASION
Agglomerationszentren tatsächlich in Glutöfen. fasst Lionel Tudisco wie folgt zusammen: «Mehr
Dichte Bebauung, wenig Vegetation, ein hoher Grün und Blau als Grau.»
Deshalb fördert die Stadt die Vegetation auf
ihrem Gebiet, und zwar nicht nur im öffentlichen
Die Stadt fördert die Vegetation auf ihrem Raum, sondern auch durch die Unterstützung
privater Vorhaben. Jedes Jahr werden über
Gebiet, und zwar nicht nur im öffentlichen 100 Bäume und Büsche ersetzt und gepflanzt.
Raum, sondern auch durch die Unterstützung Indem sie Wasser verdunsten und Schatten
spenden, kühlen sie die Luft. Mehrjährige Pflan-
privater Vorhaben. zen und Grasflächen stehen ebenfalls hoch im
Kurs, so etwa rund um die Kindertagesstätte von
St-Guérin. Hügelbeete, auf denen Iris, Federgräser
Anteil an versiegelten Flächen, Luftschadstoffe, und Sonnenhut gedeihen, haben dort einen Teil
Abwärme von Gebäuden und Verkehr sowie des ehemaligen betonierten Parkplatzes ersetzt.
immer häufigere Hitzewellen verstärken das Phä- Neben der Kirche wurde eine Böschung neu be-
nomen zusätzlich. Dies alles kann dazu führen, pflanzt und das Dach eines kleinen Gebäudes be-
dass die Temperatur in städtischen Zonen bis zu grünt. Rundherum wachsen heute diverse Bäume
6 °C höher ist als in den umliegenden Regionen. wie etwa Fichten, Eiben oder auch Judasbäume.
Die Stadt Sitten ist allerdings bereits vor dem
Grün und Pflanzen, wo es nur geht Projekt ACCLIMATASION aktiv geworden. Dies
Angesichts seiner klimatischen Geschichte beweist die Strasse Espace des Remparts direkt
erstaunt es nicht, dass Sitten mit einem Pro- vor dem Stadthaus, wo auch das Städtische Amt
14DOSSIER ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL < umwelt 3/2017
für Raumplanung angesiedelt ist. Wo früher ein ebene ist eine eigentliche Kiesgrube, es steht nur
Parkplatz war, breitet sich heute eine eigentliche wenig Boden zur Verfügung, und die Zone ist von
städtische Lounge aus – mit Bäumen, Sitzgele- zwei Mikroklimata geprägt: einem kontinentalen
genheiten, einem Wasserspiel und einem hellen, und einem mediterranen am Sonnenhang. Hinzu
durchlässigen Boden. Dieser Platz diente zudem kommt der Stress aufgrund des Klimawandels.
als Modell für andere Gestaltungen wie etwa den Philippe Quinodoz musste feststellen, dass einige
Boulevard Cours Roger Bonvin, wie Lionel Tudis- der vorhandenen Arten leiden. Deshalb führt
co betont. Wir schwingen uns auf unsere Velos er nun zahlreiche Tests durch, um genau die
und machen uns auf Entdeckungstour. Pflanzen zu finden, die unter den aktuellen
Wir pedalen in Richtung westlicher Stadtrand Bedingungen überleben können.
zur Landwirtschaftsschule Châteauneuf, wo «Wir siedeln beispielsweise die Hopfenbuche
zwei neue Einrichtungen entstanden sind: ein an – einen Baum aus der Provence, der Hitze,
japanischer Garten auf dem Dach der Schule Trockenheit und kalkreiche Böden sehr gut er-
und ein Teich, der in einer grossen Wiese vor trägt – und führen Versuche mit verschiedenen
dem Nordeingang des Gebäudes angelegt wurde. Eichenarten, wie zum Beispiel Steineiche, Zerr-
«Mehrere Studien zeigen, dass eine Kombination Eiche oder auch Ungarischer Eiche, durch.» Den
verschiedener Massnahmen wie Wasserquellen, richtigen Baum am richtigen Ort zu pflanzen, be-
Schatten, Begrünung, angepasster Materialien deutet zudem weniger Unterhalt und damit auch
oder Wiederherstellung der Durchlässigkeit die weniger Kosten. Für den Place du Midi wurden
Hitze in Städten deutlich vermindern kann», Gleditschien gewählt. Sie haben den Vorteil, dass
erklärt Melanie Butterling vom Bundesamt für sie sommergrün sind, ihre Blattentwicklung erst
Raumentwicklung (ARE). spät im Frühling einsetzt und sie ihre Blätter im
Herbst rasch verlieren. «Hinsichtlich Vegetation
Wasser und Albedo hat jede Stadt ihre Besonderheiten. Was für Sitten
Was uns bei unserer Tour quer durch Sitten gilt, ist nicht unbedingt auch für Genf, Zürich
ebenfalls auffällt, sind die Anstrengungen zum oder Bern richtig», bemerkt Melanie Butterling.
Schutz und zur Optimierung des Wasserkreislau- In Bern hat die Studie Urban Green & Climate
fes. Dazu gehört nicht nur die Einrichtung von Bern – ebenfalls ein Pilotprojekt des Programms
Brunnen, Wasserflächen und Versickerungsmul- «Anpassung an den Klimawandel» – die extre-
den oder die Freilegung eingedolter Wasserläufe. men Bedingungen deutlich gemacht, denen der
Wo immer möglich wird auch der Boden durch- städtische Baumbestand unterworfen ist, so etwa
lässiger gemacht, damit das Regenwasser besser Bodenversiegelung, Streusalz, Luftverschmut-
versickern kann und der Hochwasserabfluss bei zung oder auch mangelnder Wurzelraum. Zudem
Starkniederschlägen vermindert wird. Die Stadt wurde der Gesundheitszustand von mehr als der
setzt deshalb beim Bau von neuen Parkflächen Hälfte der inventarisierten Strassenbäume als
auf Rasengitter. Auf Plätzen oder rund um Bäume schlecht beurteilt. Diese Studie identifiziert die
kommt heller Kies statt Beton zum Einsatz, und klimatischen Ansprüche verschiedener Arten,
bei Neugestaltungen wird heller Asphalt dem formuliert Empfehlungen und schlägt neue
gewohnten dunklen Bodenbelag vorgezogen. Finanzierungsmöglichkeiten etwa durch Paten-
«Eine schwarze Strasse speichert viermal mehr schaften für «klimafitte Baumarten» vor.
Wärme als eine helle», erklärt Lionel Tudisco und
weist zudem darauf hin, dass eine hohe Albedo – Bessere Durchlüftung
das heisst ein hohes Rückstrahlvermögen einer Zahlreiche Ansätze und Empfehlungen gelten
Fläche – zu einer Temperatursenkung beiträgt. aber für alle Städte und Agglomerationen. Das
ARE hat dazu eine Arbeitshilfe für Planerinnen
Der richtige Baum am richtigen Ort und Planer mit dem Titel «Klimawandel und
Beim Place du Midi legen wir einen Halt ein Raumentwicklung» erarbeitet. Sie behandelt
und treffen uns mit dem Stadtgärtner Philippe die Integration von Klimafragen in den Pla-
Quinodoz. «Unser Ziel besteht darin, den Baum- nungsprozess, Anreizstrukturen zur Sicherung
bestand zu erhalten, zu schützen und (neu) auf- von Freiräumen oder auch die Anpassung der
zubauen und im selben Zug die Biodiversität zu Bepflanzung an das Klima und das Wasserange-
fördern», erklärt er gleich zu Beginn. Nur sind die bot. Daneben nennt die Arbeitshilfe zwei weitere
hiesigen Bedingungen nicht einfach. Die Rhone- wichtige Aspekte: die Anpassung der raumpla-
15umwelt 3/2017 > DOSSIER ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL 16
DOSSIER ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL < umwelt 3/2017
nerischen Instrumente an die klimatischen In Genf hat das Projekt CityFeel, das von der
Herausforderungen und die Verbesserung der Gruppe Laboratoire, Energie, Environnement,
Durchlüftung. Sitten hat auch diese Aspekte Architecture (leea) der Hochschule für Land-
berücksichtigt. schaft, Ingenieurwissenschaften und Architek-
Um eine nachhaltige Wirkung zu gewähr- tur (hepia) erarbeitet wurde, einen «microcli-
leisten, plant die Walliser Stadt, die Prozesse matmètre» entwickelt. Dieses Messgerät erfasst
und Lösungen im kommunalen Richtplan, und quantifiziert die verschiedenen Faktoren,
im Zonenplan, in den Quartierplänen und im die auf Fussgängerinnen und Fussgänger
Baureglement zu verankern. Ausserdem will in der Stadt einwirken. Es wurde bis anhin
sie eine maximale Fassadenlänge festlegen, in Basel, Zürich, Genf und wiederum in Sitten
eingesetzt. Die Ergebnisse der Analysen stehen
noch bevor.
«Man muss die Menschen be-
rühren, sie mit Projekten sen- Ein Gewinn für die Lebensqualität
Unsere Sitten-Rundfahrt führt uns schliesslich
sibilisieren, welche sie anregen auf die andere Seite der Rhone. Wir folgen
und die Geselligkeit und das der Avenue du Bietschhorn, die sich neuer-
Wohlbefinden fördern.» dings dank grosszügiger Pflanzenstreifen, auf
welchen Mohnblumen, Roggen und andere
Lionel Tudisco, Stadtplaner Sitten Feld- und Wiesenpflanzen spriessen, je nach
Jahreszeit anders präsentiert. Die letzte Etappe
endet auf der Cours Roger Bonvin, dem Vor-
damit keine zu langen Häuserblöcke gebaut zeigeobjekt von ACCLIMATASION. Hier ist auf
werden, die die natürliche Durchlüftung der der Autobahn und auf einem einen Hektar
Stadt behindern. Interessant ist diesbezüglich grossen Areal ein ausgedehnter Treffpunkt
das Beispiel des Erlenmatt-Areals in Basel. entstanden, mit flossartigen Behältern, die
Hier wurde bereits vor dem Bau des neuen mit Ahornbäumen bepflanzt wurden, Holz-
Quartiers die Ausrichtung der Bauten speziell decks, die als Bänke dienen, Wasserspielen
untersucht, damit Frischluft aus dem Wiesen- und einem Pétanque-Platz. Lionel Tudisco ist
tal von Norden in das Areal strömen und den sich sicher: «Man muss die Menschen berüh-
Hitzestau im Sommer mildern kann. ren, sie mit Projekten sensibilisieren, welche
Im Rahmen des Projekts «Klimaangepasste sie anregen und die Geselligkeit und das
Stadtentwicklung» setzen sich das BAFU und Wohlbefinden fördern.» Melanie Butterling
das ARE dafür ein, dass die Innenstädte auch pflichtet ihm bei: «Die Eingriffe in Sitten sind
in einem wärmeren Klima eine angenehme Win-win-Lösungen. Sie bekämpfen nicht nur
Aufenthalts- und Wohnqualität bieten. Das die Klimaerwärmung, sondern erhöhen auch
Ziel besteht darin, einen Überblick über die Lebensqualität in der Stadt.»
Grundlagen, mögliche Massnahmen sowie
Ein Baum trägt gleich viel zur Vorgehen zur Bewältigung der zunehmen-
Kühlung einer hitzegeplagten den Hitzebelastung und insbesondere der
Stadt bei wie fünf Klimaanlagen. Hitzeinseln in Städten und Agglomerationen
Weiterführende Links zum Artikel:
Deshalb schafft Sitten/Sion grüne zu erarbeiten. Um die Vertreterinnen und
www.bafu.admin.ch/magazin2017-3-04
Inseln in der Landschaft. Positiv Vertreter städtischer Räume für dieses Thema
auf das Mikroklima wirken sich zu sensibilisieren und Beispiele vorzustellen,
nicht nur heller Kies, sondern organisieren die beiden Bundesämter Tagun-
auch Wasserflächen und feuchte gen und Workshops. Mehrere Schweizer Städ-
Böden aus, denn der Verduns- te haben den Stier bereits bei den Hörnern
tungseffekt hat eine kühlende gepackt, so etwa Zürich mit der Klimaanalyse
Wirkung. In Sitten wurden aus KLAZ, Basel oder eben Sitten. Zahlreiche wei- KONTAKT
diesem Grund Böden «entsiegelt», tere interessieren sich für diese Problematik. Melanie Butterling
Sektion Siedlung und Landschaft
das heisst, undurchlässige Ober- Parallel dazu werden die Parameter, die
Bundesamt für Raumentwicklung (ARE)
flächen wurden beispielsweise unser Wohlbefinden im städtischen Umfeld +41 58 462 40 64
durch Rasengitter ersetzt. beeinflussen, immer intensiver erforscht. melanie.butterling@are.admin.ch
17umwelt 3/2017 > DOSSIER ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL
TROCKENHEIT
Was tun, wenn das Wasser
knapp wird?
Im Kanton Basel-Landschaft müssen bereits heute Bäche abgefischt werden, wenn es im Sommer heiss und
trocken wird. Auch die Landwirtschaft spürt die Verknappung. Als Folge des Klimawandels dürfte das Wasser
in den nächsten Jahrzehnten auch andernorts zeitweise Mangelware werden. Ein Baselbieter Pilotprojekt
zeigt, wie sich dieser Entwicklung langfristig entgegentreten lässt. Text: Pieter Poldervaart
«Ziemlich überrascht» sei er gewesen, sagt Ad- im Hochsommer ganz versiegen. Solche Hitzewel- Die Anpassung an den
rian Auckenthaler, als er im letzten Herbst die len fallen just in die Periode, in der auch in der Klimawandel lässt sich
Untersuchung «Handlungsempfehlungen zur Landwirtschaft das Wasser zum Teil knapp wird. nur gemeinschaftlich
Nutzung von Fliessgewässern unter veränderten Gegenwärtig muss im Baselbiet noch nicht so viel meistern. Vielerorts
klimatischen Bedingungen» studiert habe. Grund bewässert werden. So verfügt denn auch bloss ein braucht es dazu die
für das Erstaunen des kantonalen Chefbeamten halbes Dutzend Landwirte über eine Konzession, Zusammenarbeit über die
waren Szenarien zum künftigen Wasserstand um das kostbare Nass wenn nötig direkt aus Flüs- Kantonsgrenzen hinweg.
der Fliessgewässer im Baselbiet: Je nach Szena- sen und Bächen abzupumpen – unter anderem Umweltfachleute aus
rio ist denkbar, dass im Jahr 2085 in der Ergolz, zur Bewässerung von Obstkulturen. Doch sollten der Innerschweiz sind
dem neben Rhein und Birs wichtigsten Fluss des die Sommer zunehmend heisser und trockener in einem Pilotprojekt
Kantons Basel-Landschaft, an 20 bis 109 Tagen werden, dürfte in der Landwirtschaft der Bewäs- die Herausforderungen
ein sogenanntes Wasserdefizit herrschen wird. serungsbedarf deutlich steigen. von Sommertrockenheit
Von einem solchen spricht man, wenn der Was- Für Adrian Auckenthaler, den Leiter Wasser und steigender Schnee-
serstand derart tief sinkt, dass die Entnahme und Geologie im Amt für Umweltschutz und fallgrenze gemeinsam
von Wasser zum Schutz der Wasserlebewesen Energie des Kantons Basel-Landschaft, sind die angegangen.
eingeschränkt oder gar verboten werden muss. Resultate des Pilotprojekts Anlass, bereits geplan-
Zum Vergleich: Zwischen 1984 und 2013 kam es te Anstrengungen für ein besseres Wasserma-
an der Ergolz bloss an durchschnittlich 3 Tagen nagement zu intensivieren. Der Schlussbericht
zu einem Wasserdefizit. Weniger Wasser bedeu- des Projekts, das im Rahmen des Pilotprogramms
tet auch höhere Wassertemperaturen. Und diese «Anpassung an den Klimawandel» des Bundes
sorgen bei Fischen als wechselwarmen Tieren für realisiert wurde, listet über 20 Massnahmen auf,
Stress und führen im Extremfall zum Tod. mit denen sich der zunehmenden Wasserknapp-
heit auf verschiedenen Ebenen begegnen liesse.
Steigender Bewässerungsbedarf «Diese Empfehlungen bestätigen uns darin»,
Grund für die besorgniserregenden Aussichten erklärt Auckenthaler, «dass die Gesetze, die der
im Baselbiet ist die voranschreitende Klimaerwär- Kanton in diesem Bereich beschlossen hat, nun
mung. Mit dem Wandel dürften sich in unseren auch konsequent umgesetzt werden müssen.»
Breiten nicht nur die Temperaturen erhöhen,
sondern im Sommer auch die Niederschläge Regenwasser möglichst versickern lassen
abnehmen. Im Kanton Basel-Landschaft sind Um die negativen Effekte des Klimawandels auf
die Folgen dieser doppelten Entwicklung bereits die Wasserlebewesen abzudämpfen, sind Akteu-
heute spürbar: In heissen und trockenen Phasen re in verschiedenen Bereichen gefragt. Bei der
erwärmen sich die grösseren Flüsse um mehrere Vergabe neuer Fischereipachten etwa wird im
Grad, und die Wassermenge von kleineren Bä- Baselbiet künftig vermehrt darauf geachtet, dass
chen geht so stark zurück, dass einige von ihnen die Gewässer nur zurückhaltend mit gezüchte-
18DOSSIER ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL < umwelt 3/2017
19umwelt 3/2017 > DOSSIER ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL
ten Fischen besetzt werden. Eine Massnahme, so sie reagieren widerstandsfähiger auf Veränderun-
Auckenthaler, die zur Förderung der Biodiversität gen. Ganz unabhängig vom Klimawandel sieht
beitrage. Den Bauern wiederum soll in Trocken- die nationale Gewässerpolitik vor, in den nächs-
phasen nur noch unter strengen Auflagen erlaubt ten 80 Jahren landesweit 4000 Kilometer Flüsse
werden, mit Wasser aus Bächen zu bewässern. und Bäche zu revitalisieren und wieder besser
Auflagen, für welche die landwirtschaftliche miteinander zu vernetzen. Mit fortschreitendem
Beratung Verständnis schaffen soll. Gefordert Klimawandel ist es wichtig, die Auswirkungen
sind aber auch die Gemeinden. Sie sollen dafür von Extremereignissen wie Hochwassern oder
sorgen, dass Wasser von versiegelten Flächen – sommerlicher Hitze in der Planung von Mass-
wie heute schon gesetzlich vorgeschrieben, aber nahmen zu berücksichtigen. Um den Fischen bei
nicht immer befolgt – nicht in die Kanalisation hohen Wassertemperaturen überlebenswichtige
eingeleitet wird, sondern wann immer möglich Abkühlung zu verschaffen, braucht es struktur-
versickert oder in Bäche und Flüsse fliesst. reiche Gewässer mit tiefen Pools, mehr Schatten
Dass das Pilotprojekt zur zukünftigen Nutzung sowie einen verbesserten Grundwasseraustausch.
der Fliessgewässer in der Nordwestschweiz durch-
geführt wurde, ist nicht etwa Zufall: «Weil der Richtige Wahl der Kulturen
karstige Untergrund das Regenwasser besonders Der haushälterische Umgang mit dem Wasser
schnell abfliessen lässt, ist der Kanton Basel-Land- betrifft unter anderem die Bauern. Je nach
schaft bereits heute überdurchschnittlich von landwirtschaftlicher Kultur und Boden variiert
Wasserknappheit betroffen», sagt Samuel Zahner der Wasserbedarf nämlich enorm. «Bei Wasser-
von der Abteilung Wasser des BAFU. Komme dazu, entnahmen für die Landwirtschaft gibt es noch
dass die Region über keine hohen Berge verfüge, viel Verbesserungspotenzial», erklärt Samuel
wo Wasser in Form von Schnee oder Gletschereis Zahner, der sich im BAFU mit der Planung von
für den Sommer zwischengespeichert würde. «Aus Wasserressourcen befasst. Um den Wasserbedarf
diesen Gründen lässt sich im Baselbiet heute bei langfristig zu senken, sollte bei der Wahl der
der Verfügbarkeit von Wasser eine Entwicklung Kulturen noch stärker als heute berücksichtigt
beobachten, die langfristig in zahlreichen ande- werden, wie viel Wasser in der entsprechenden
ren Kantonen ebenfalls eintreten wird.» Region überhaupt zur Verfügung stehe. Unter-
Die Ergebnisse der Baselbieter Studie sind daher stützung bei solchen Überlegungen bieten die
auch für andere Kantone eine gute Grundlage im Auftrag des BAFU erstellten «Praxisgrundlagen
bei der Entwicklung von Anpassungsprojekten. zum Wasserressourcenmanagement», die im
Eine wichtige Voraussetzung ist die systematische Kanton Thurgau im Rahmen eines Pilotversuchs
Aufnahme und Auswertung von Datenmateri- getestet wurden. «Die Erkenntnisse aus den Kan-
al. Dieses Monitoring umfasst unter anderem tonen Thurgau und Basel-Landschaft zeigen, wie
die Ermittlung der exakten Bodenfeuchtigkeit wichtig es ist, sich abzeichnende Nutzungskon-
von unterschiedlichen Bodentypen. Die Studie flikte ums Wasser bereits heute anzugehen und
schlägt auch vor, alle 3 bis 5 Jahre den Fisch- die Fliessgewässer noch besser zu schützen», sagt
und Nährtierbestand der Gewässer zu erheben. Samuel Zahner.
Und schliesslich gilt es, die Abflussmengen der
einzelnen Flüsse und Bäche sowie die Wassertem-
Weiterführende Links zum Artikel:
peraturen kontinuierlich zu messen. Das BAFU
www.bafu.admin.ch/magazin2017-3-05
ist derzeit gemeinsam mit den Kantonen daran,
das Monitoring der Wassertemperaturen diesen
neuen Anforderungen anzupassen.
Die Bedeutung von Revitalisierungen
Aus Sicht des BAFU stehen 2 Handlungsfelder im
Vordergrund, um den Folgen des Klimawandels
für Bäche und Flüsse zu begegnen: die Revitali- KONTAKT
sierung von Gewässern und ein haushälterisches Samuel Zahner
Sektion Revitalisierung und
Wassermanagement. Gewässerbewirtschaftung, BAFU
Revitalisierungen sind wichtig, da Gewässer in +41 58 465 31 78
naturnahem Zustand resilienter sind. Das heisst, samuel.zahner@bafu.admin.ch
20Sie können auch lesen