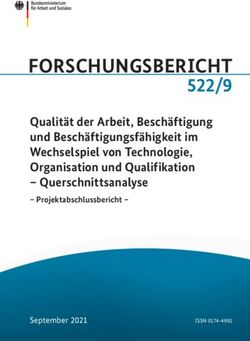# 77 Frisch draufgeschaut - KOPS Uni Konstanz
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
das Magazin der Universität Konstanz
Oktober 2022
– uni.kn/unikon
# 77
Müssen wir Zeit macht
den Tod fürchten?
Ein Interview über verdrängte Furcht, draufgeschaut Frisch den Unterschied
Wenn Länder des Globalen Südens
zukunftsgerichtete Wesen einander helfen, begegnen sie
und ein selbstbestimmtes Leben. sich auf Augenhöhe. So die Theorie.
Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS)
URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-2-saz08j4pt8i41Wintersemester
2022/2023
Studium
Generale –
Wissenschaft
für alle
montags 18.15 –19.45 Uhr, Audimax und Livestream
31.10.2022 28.11.2022 16.01.2023
Lenin, Stalin … Putin. Führerregime: Mythen und Realität über Methanhydrate der Meeresböden,
Tradition und Bruch in der politi- Mehrsprachigkeit Gefahren und/oder Potentiale für
schen Kultur Russlands Prof. Dr. Theo Marinis, das Leben auf der Erde
Dr. Benno Ennker, Universität Konstanz Prof. Dr. Gerhard Bohrmann,
Universität Tübingen marum - Universität Bremen
05.12.2022
07.11.2022 Das rätselhafte Gewebe der 23.01.2023
Fleisch aus dem Labor: Eine Wirklichkeit. An den Grenzen des Ethik der Translationalen Medizin
gesunde Alternative ohne Tierleid? Wissens und darüber hinaus. Prof. Dr. Nicola Biller-Adorno,
Prof. Dr. Petra Kluger, Prof. Dr. Gerd Ganteför, Universität Zürich
Hochschule Reutlingen Universität Konstanz
30.01.2023
14.11.2022 12.12.2022 Papillomviren, Gebärmutterhals-
Die Europäische Währungsunion in Wann ist der Mann ein Mann? krebs und Angelman-Syndrom
Krisenzeiten Geschlechterrollen in der englisch- oder: Was wir von Viren über
Prof. Dr. Almuth Scholl, sprachigen Literatur zum Ersten Erkrankungen lernen können
Universität Konstanz Weltkrieg Prof. Dr. Martin Scheffner,
uni.kn · wwa-grafik · wwa-druck · Foto: © Inka Reiter · 9/2022
Prof. Dr. Silvia Mergenthal, Universität Konstanz
21.11.2022 Universität Konstanz
Differenzierte Integration –
Chance und Herausforderung 09.01.2023
für die Europäische Union Der Ort der Religion in einer
Prof. Dr. Dirk Leuffen, offenen Gesellschaft
Universität Konstanz Reinhard Kardinal Marx,
Kardinal von München und Freising
– uni.kn/studiumgenerale# 77
Frisch
draufgeschaut(Computer-) Spiele als
Forschungsobjekt
Für die Mitarbeiter*innen des GameLab gehört Spielen zum Arbeitsalltag:
Sie beschäftigen sich aus wissenschaftlichem Interesse mit Spielen,
Spielverhalten und Spielemechaniken.
GameLab – Seite 46
Schule in den Zeiten der
Augmented Reality Wie etwas, das
Johannes Huwer nimmt in seiner Didaktik-Forschung die Themenbereiche
es eigentlich
Digitalisierung und Nachhaltigkeit in den Fokus. Die Schüler*innen sollen
nicht nur mit digitalen Medien, sondern auch über digitale Medien lernen.
nicht geben
Fachdidaktik der Naturwissenschaften – Seite 32
dürfte, neue
Möglichkeiten
schafft
Bei der Forschung zum kontrollierten
Kristallwachstum von Biomineralien
wurden in der Arbeitsgruppe von Helmut
Cölfen Pränukleationscluster entdeckt,
die klassisches Lehrbuchwissen
ergänzen und obendrein ganz neue
Wege eröffnen.
Physikalische Chemie – Seite 52
Mit Avataren
dem Charisma
auf der Spur
Testläufe für ein
besseres Leben Ein interdisziplinäres Projekt erforscht,
wie politisches Charisma bei Politi-
ker*innen mit gesellschaftlich margina-
lisiertem Hintergrund wahrgenommen
Für Anne Kwaschik ist die kurze Lebensdauer der frühsozialistischen wird. Diese Gruppe mit niedrigem
Siedlungskommunen kein Beweis für ihr Scheitern. Im Gegenteil: Die Historikerin Status ist in der Politik immer noch
betrachtet die gelebten Zukunftsentwürfe als Sozialexperimente. unterrepräsentiert.
Geschichte – Seite 7 The Politics of Inequality – Seite 18Schwerpunkt: Frisch draufgeschaut 4
Online-
Für ein besseres Leben 7 Version
Kunststoffe neu gedacht 13
von uni’kon
#77
Dem Charisma auf der Spur 18
unter:
Müssen wir den Tod fürchten? 25
„Mehr-Ärzte-für-Brasilien-Programm“ im Test 28
Lernen mit Augmented Reality 32
Sozialsysteme: Verteilungs- versus Effizienzfragen 38
Schwarmforschung in virtueller Umgebung 42
– uni.kn/broschueren/unikon/77
Spielend forschen 46
Werkstatt für Kreativprojekte 50
Weiter geht’s im Netz 51
Mit Pränukleationscluster gegen den Zahnbohrer 52
Im Schlaglicht 56
Personalia 58 Zum
Online-
Nachruf auf Friedrich Kambartel 61
Magazin
Diversity: Power der Vielfalt 62 campus.kn
Otl Aicher zum 100. Geburtstag 65
VEUK zum 25. Geburtstag 66
Ambivalenzen des Emeritus 68
Impressum 72
– uni.kn/campusSchwerpunkt
Frisch
draufgeschaut
Kunststoff nicht als Umweltbelastung,
sondern als nachhaltiges Material verstehen.
Die Siedlungskommunen der früh
sozialistischen Bewegung nicht als
gescheiterte Projekte, sondern als Zukunfts
entwürfe betrachten. Charisma nicht
als magische Fähigkeit, sondern als Status-
abhängige Zuschreibung wahrnehmen.
Den Tod nicht als das Nichts, vor dem wir
uns fürchten müssen, sondern als nichts,
vor dem wir uns fürchten müssen,
begreifen. Oder einfach Lehrbuchwissen
neu schreiben. Einen frischen Blick zu
riskieren kann auch wissenschaftlich neue
Gebiete erschließen. In uni’kon 77
stellen wir beispielhaft Projekte an der
Universität Konstanz vor, die neue
Sichtweisen eröffnen.
45
Geschichte 6
Ein besseres Leben
Testläufe für
ein besseres Leben
Für Anne Kwaschik ist die kurze
Lebensdauer der frühsozialistischen Siedlungs-
kommunen kein Beweis für ihr Scheitern,
wie sie in der Geschichtswissenschaft mehrheitlich
gedeutet wird. Im Gegenteil: Die Historikerin
betrachtet die gelebten Zukunftsentwürfe als
Sozialexperimente.
Es gibt Utopien, und es gibt das reale Leben. Menschen, die von den 1830er bis 1860er
Als die Frühsozialisten aus Lyon im Jahr 1846 Jahren diese genossenschaftlichen Gemein
mit ihren Vorstellungen von einem alternati schaften gründeten, wollten genau das: eine
ven Leben und einer alternativen Form von neue Gesellschaft, die auf bestimmten Prin
Gemeinschaft in Algerien ankamen, waren zipien beruhte. Die Tatsache, dass sie ihre
dort schon andere: arabische Stämme in Vorstellungen auf einer Art Testgelände ver
ihren Zelten. Die Kolonisierung Algeriens sachlichten und über die Schwächen in der
durch Frankreich war noch keine zwei Jahr Umsetzung ausführlich diskutierten, spricht
zehnte im Gange. Was geschah nach der An für Anne Kwaschik gegen die spätere Lesart,
kunft der Fremden vor Ort? Wie lebten die die mit Friedrich Engels begann: der „Utopie“
beiden Gruppen zusammen? Was passierte als abstrakter Idee, die in „reine Phantasie“
mit der Utopie? Fragen, die Anne Kwaschik abdrifte.
interessieren.
Interessant ist die Konstellation zunächst Die Kommunen waren
auch in begrifflicher Hinsicht. „Utopie“ be
deutet im Altgriechischen so viel wie „kein Sozialexperimente
Ort“. Seit Thomas Mores Roman „Utopia“
von 1516 meint eine Utopie eine Gesellschaft, Die Professorin für Wissensgeschichte setzt
die durch ideale soziale, religiöse und wirt dem ihren Forschungsansatz entgegen:
schaftliche Beziehungen definiert ist. Die Diese frühsozialistischen Siedlungsprojekte –
7Geschichte
Kommunen, wie sie auch aus den 1970er in der Nähe der Küstenstadt Oran dient ihr
Jahren bekannt sind – waren Sozialexperi als gutes Beispiel, um neue Wissenssysteme
mente im Rahmen eines wissenschaftlichen zwischen den Vertreterinnen und Vertretern
Reformprogramms, die vielerorts über den des neuen Denkens und ihrer kolonialen Um
Globus verteilt stattfanden. Dabei interessie welt bzw. die Beziehungen zwischen Europä
ren Anne Kwaschik insbesondere die Grün er*innen und Araber*innen zu untersuchen.
dungen in Algerien, Neukaledonien und
Lateinamerika. Im Untersuchungsabschnitt Die Organisationsform war eine
zu Algerien gehen diese Experimente einher
mit der Kolonialisierung Algeriens durch Aktiengesellschaft
Frankreich. Kolonien boten die Infrastruktu
ren und eine Arena, um die neuen Theorien Die Französinnen und Franzosen, die in
der sozialen Organisation zu erproben. Nordafrika ankamen, hatten zum Teil zu
Die Siedlungen testeten damit nicht nur Hause eine gediegene gesellschaftliche Stel
eine neue Gesellschaftsordnung aus, son lung. Ärzte und Rechtsanwälte waren dar
dern gleichzeitig auch alternative Formen unter, die sich in einer Art Aktiengesellschaft
der Kolonisierung. Die Mitglieder hatten eine organisiert hatten. Jedes Mitglied besaß An
Mission und waren überzeugt, dass ihr Ver teile, und die Satzung legte fest, wie hoch die
ständnis von Kolonialismus besser sei als die Aktienanteile für eine Mitgliedschaft sein
vom französischen Staat ausgeübte Form. mussten – nicht sehr hoch, um die Arbeiter
Nicht perfekt, aber besser. schaft nicht auszuschließen. Mit dem Geld
Anne Kwaschik zeigt am Beispiel der 1846 kauften sie beim französischen Kriegsminis
gegründeten landwirtschaftlichen Sied terium das Land in Algerien.
lungsgemeinschaft von Saint-Denis-Du-Sig, Da kamen sie also an mit ihren neuen
wie die Ideen einer neuen Lebensform in Vorstellungen von einer Gesellschaftsord
die Praxis umgesetzt wurden. Die Siedlung nung, die das Privateigentum ablehnte und
Das Familistère ist
ein Gebäudekomplex
aus der Mitte des 19.
Jahrhunderts, der von
dem Fabrikanten Jean-
Baptiste André Godin
für seine Arbeiter
und ihre Familien in
Guise (Nordfrankreich)
gebaut wurde. Godin
war ein Anhänger
von Charles Fouriers
Theorien zu Produkti-
ons- und Wohngenos-
senschaften. Das hier
abgebildete Haupt-
gebäude folgt Fouriers
Entwürfen für einen
Sozialpalast. Es wurde
seit 1865 bewohnt und
gilt als einzigartiges
Zeugnis der Um-
setzung der sozialen
Utopien und einer
der ersten sozialen
Wohnungsbauten der
Moderne.
© Kwaschik
8Ein besseres Leben
die Gleichberechtigung der Frauen, die freie Franzosen das Leben der algerischen Frauen
Liebe und die vergemeinschafteten Formen erleichtern, die traditionell für das Kornmah
des sozialen Lebens befürworteten. „Für die len zuständig waren.
se Mikro-Geschichten vor Ort gibt es gute
Quellen, wenn man danach sucht“, sagt die Lokales Wissen
Historikerin. Die Neuankömmlinge beschlos
sen, die ansässigen arabischen Stämme war wichtig
nicht zu vertreiben, „weil es ihrer Vorstellung
von einer modernen Gesellschaftsordnung Der Wissenstransfer funktionierte aber auch
widersprach. Sie haben ihnen zu einem ge umgekehrt. Die arabischen Bauern bearbei
ringen Preis Land verpachtet und hielten das teten ihre Felder mit einem einfachen Holz
für fortschrittlich.“ pflug, der nicht so tief pflügte, wie die teuren
Gleichzeitig waren die Siedler natür Metallpflüge aus Frankreich. Die Neuen, die
lich überzeugt von der Höherwertigkeit der ohnehin wenig Ahnung von Landwirtschaft
europäischen Kultur: Sie wollten die Einhei hatten, waren bereit dazuzulernen. Sie taten
mischen „zivilisieren“. Kinder sollten in die es den Einheimischen gleich und stornierten
Schule gehen, die Stämme sollten sesshaft die Bestellung der Hightech-Gerätschaft.
werden, Brunnen graben und Bäume pflan Die Geschichtswissenschaft hat sich in
zen. Und: Vielleicht könnte man danach in der Vergangenheit wenig für diese zeitlich
einem nächsten Schritt auch über die Reali und örtlich begrenzten Phänomene interes
sierung des gemeinschaftlichen Eigentums siert. Zumal die Experimente unterm Strich
nachdenken? auch nicht von großem Erfolg gekrönt wa
Insbesondere lag den Kommunen die ren. „Das kann man so sehen“, sagt Anne
Verbesserung der Stellung der Frauen am Kwaschik, „andererseits kann man aber auch
Herzen. Anne Kwaschik: „Die Anhänger fragen, was bedeutet Erfolg als Kriterium
von Charles Fourier, dem französischen So für Geschichtswissenschaft? Woran lässt er
zialtheoretiker, waren der Meinung, dass sich überhaupt messen? Auf diesen kleinen
die Stellung, die die Frau in der Gesellschaft Flächen wurden die Themen definiert, die
einnimmt, etwas darüber aussagt, wie fort später in der Geschichte der Moderne wich
schrittlich diese Gesellschaft ist.“ So waren tig wurden: neue Besitzverhältnisse, die De
diese frühsozialistisch inspirierten Einge finition von Arbeit und die Organisation von
wanderten von Saint-Denis-Du-Sig beispiels Freizeit, neue Formen des Zusammenlebens
weise stolz darauf, dass die einheimische und die Auslotung des Verhältnisses von
Bevölkerung die Mühle annahm, die sie kurz Individuum und Kollektiv, Emanzipation
nach ihrer Ankunft bauten. So konnten die von Mann und Frau und die Bedeutung von
9Geschichte
Der Frühsozialist Charles Fourier
plante einen Sozialpalast, in dem die
Wege so angelegt werden sollten,
dass sich die Bewohner*innen immer
begegnen müssten. Der Gedanke
dahinter: Wenn sich die Menschen
öfter über den Weg laufen, wirken die
Gesetze des Kapitalismus nicht mehr
so stark. Auf dem Bild steht Anne
Kwaschik im Foyer der Universität
Konstanz, das ebenfalls als Begeg-
nungsstätte konzipiert ist, in der die
Universitätsmitglieder auf dem Weg
zur Mensa zusammentreffen.
Anne Kwaschik forscht aktuell zur
Verwissenschaftlichung des Kolonia-
len im 19. und 20. Jahrhundert und
zur Geschichte von Gesellschafts-
experimenten und Gegenwartsdiag-
nostik seit 1800. Sie ist Präsidentin
des Deutsch-Französischen Histori-
kerkomitees.
Sexualität, Vorstellungen von sozialen Wis sen. Der Autor Hawthorne war Gründungs
senschaften und ihrer Verbindung zum mitglied der Brook Farm.
Leben.“ Neben den Statuten, die sich die Gemein
Nicht erst in den Kommunen der 1970er schaften gaben, und Jahresberichten mit
Jahren kehrten solche Lebensformen wie den Einnahmen und Ausgaben, sind die
der. Die Zukunftsentwürfe der frühsozia Theorie-Diskussionen, zu denen Berichte
listischen Bewegung zeigten bereits unter vorliegen, aber auch theoretische Schriften
den Zeitgenossen Wirkung. Die dem neuen wichtige Quellen für Anne Kwaschik. „Pol
Gemeinschaftsmodell zugrundeliegende nische Unabhängigkeitskämpfer oder belgi
Ideen, die auf die frühen sozialistischen sche Feministinnen engagierten sich in die
Denker Robert Owen, Henri de Saint-Simon sem Milieu und formulierten Fouriers Ideen
und Charles Fourier zurückgehen, wurden um, damit sie besser verständlich wurden
– angereichert durch die Erfahrung in den und als Handlungsanweisung unter die
Siedlungen – zurück nach Europa getragen. Leute gebracht werden konnten. Zahlreiche
Dort wurden sie in Salons und Abendver Übersetzungen und Propagandabroschüren
anstaltungen verbreitet. Sie beeinflussten wurden in diesen internationalen Netzwer
Marx und Engels und waren für die Genos ken produziert.“ Die intellektuellen Einflüsse
senschaftsbewegung maßgeblich. Auch die sind weitreichend: Selbst einzelne Militärs
Entstehung sozialwissenschaftlicher Diszi unterstützten die Kolonisierung Algeriens
plinen ist von frühsozialistischen Denkfigu nach dem Vorbild der kleinen Siedlungsge
ren geprägt. meinschaft.
Auch die Einflüsse der Umwelt spielten
Die Brook Farm war Vorbild für für die Kommunen eine große Rolle. Die Na
tur und mit ihr alternative Medizin in Form
„The Blithedale Romance“ von Studios für Magnetismus oder Homöo
pathie standen damals hoch im Kurs, eben
Die Brook Farm, eine Kommune in den USA, so wie spiritualistische Erfahrungen. Die
brachte es sogar zum Vorbild für einen Ro Theorieentwürfe Fouriers selbst wurde von
man. „The Blithedale Romance“ von Natha der Außenwelt weitgehend abgelehnt, nicht
niel Hawthorne, 1852 erschienen, themati so die praktische Umsetzung. „Dass man
siert die Konflikte der Menschen zwischen Einkommen und Ausgaben teilt, Arbeit neu
ihren Idealen und ihren privaten Bedürfnis regelt, galt als extrem fortschrittlich und spä
10Ein besseres Leben
ter auch als realistischer als kommunistische großen Einfluss. Und Theodor Herzl hat sie
Vorstellungen“, berichtet die Hstorikerin. für seine Kibbuzim rezipiert. Scheitern sieht
„Was aber als absolut verrückt galt, war die anders aus.
Frauenemanzipation. Das wissen wir aus den Für die Aktivistinnen und Aktivisten im
Reaktionen auf frühe Vorträge der Fourieris 19. Jahrhundert war Scheitern ohnehin kein
ten: Die Gleichberechtigung der Frau skanda Thema. Ihre Einstellung war experimentell.
lisierte die Öffentlichkeit zunächst mehr als Sie waren sich sicher, dass sie mit der Um
die Abschaffung des Privateigentums.“ setzung einer Kommune, egal wie vorläu
Tatsächlich sah der Alltag, was die Gleich fig diese war, die generelle Machbarkeit der
berechtigung der Frauen betraf, nicht ganz Theorie beweisen würden. Denn dass sich
so utopisch aus. Immerhin aber sind Quellen die Theorie nicht eins zu eins umsetzen ließ,
überliefert, dass Frauen und Männer in den war eigentlich von Anfang an klar. Genau
Kommunen doch anders miteinander um hier sollte die Umsetzung ja offene Punkte
gegangen seien als im Rest der Gesellschaft. oder Schwächen offenlegen.
„Und es ist selbstverständlich auch nicht so, „Das ist ein wichtiger Punkt: Die Praxis
dass um 1840 in den Siedlungen die freie Lie sollte die Theorie korrigieren“, formuliert es
be praktiziert worden wäre“, so Kwaschik. Anne Kwaschik, die noch etwas anderes an
den Menschen von Saint-Denis-Du-Sig fas
„Die neue Welt der Liebe“ ziniert: „der Elan und die Energie, den eige
nen Wohlstand und die eigene Gesellschaft
wurde erst im 20. Jahrhundert zu verlassen, dahin zu gehen, wo es stickig
zur Kenntnis genommen und heiß ist, wo Krieg und Krankheiten herr
schen, um eine neue Gesellschaftsordnung
Tatsächlich wurde Fouriers Schrift „Die neue auszutesten.“
Welt der Liebe“ von den Anhängern auch zu msp.
rückgehalten und erst in der Zeit der neuen
Kommunen im 20. Jahrhundert zur Kennt
nis genommen und in Teilen auch ins Deut Weitere
sche übersetzt. Für die USA lassen sich aller Informationen
dings konkrete Wege von den Siedlungen in
die Emanzipationsbewegung nachweisen.
„Blithedale Romance“ mit der emanzipier
ten Protagonistin gehört zur Pflichtlektüre
in den USA.
Anne Kwaschik ist dabei, eine „kleine
Weltkarte“ der global verteilten Kommu
nen zu erstellen. Neben Nordafrika waren
die USA, Lateinamerika und Osteuropa sehr
wichtige Standorte. Auch im Habsburger
Reich hatten die Ideen vom neuen Menschen – t1p.de/hlc63
„Was aber als absolut verrückt galt, war
die Frauenemanzipation.
Die Gleichberechtigung der Frau
skandalisierte die Öffentlichkeit
zunächst mehr als die Abschaffung des
Privateigentums.“
Anne Kwaschik 1112
Eine starke Verbindung
Kunststoffe neu
gedacht:
vom Rohstoff bis zum
Recycling
Stefan Mecking, Professor für Chemische Material-
wissenschaft, entwickelt und erforscht mit
seiner Arbeitsgruppe am Fachbereich Chemie der
Universität Konstanz katalytische Verfahren,
die auf mehreren Ebenen die Umweltverträglichkeit
von Kunststoffen steigern.
Die weltweite Kunststoffproduktion hat in Vor allem geringe Herstellungskosten
den vergangenen Jahrzehnten rasant zuge und Beständigkeit haben jedoch auch eine
nommen, von 1,5 Millionen Tonnen im Jahr Schattenseite. So haben Bilder von im Meer
1950 auf über 360 Millionen Tonnen im schwimmenden Plastiktüten und Müllber
Jahr 2020. Damit zählen Kunststoffe heute gen aus Wegwerfartikeln zuletzt stark am
zu den weltweit wichtigsten industriellen Image des Werkstoffs gekratzt. Teils zu Un
Werkstoffen. Der Grund für diesen Sieges recht, denn in vielen Fällen sind Kunststoffe
zug liegt auf der Hand: Kunststoffe sind sogar die umweltverträglichere Wahl – bei
äußerst flexibel, nicht nur in ihrer Form, spielsweise, wenn Kunststoffkomponenten
sondern auch in ihren Materialeigenschaf in der Fahrzeugindustrie zu geringeren
ten. Sie sind außerdem leicht, langlebig und Fahrzeuggewichten und damit zu dauer
kostengünstig. haft geringerem Energieverbrauch führen.
13Chemische Materialwissenschaft
„Tatsächlich gibt es viele alltägliche
und technische Anwendungen,
in denen bei genauer Betrachtung
Kunststoffe die nachhaltigste
Lösung sind.“
Stefan Mecking
„Tatsächlich gibt es viele alltägliche und sant, da ihnen auf diesem Weg neue Eigen
technische Anwendungen, in denen bei ge schaften verliehen werden können. „Leider
nauer Betrachtung Kunststoffe die nachhal sind jedoch viele traditionelle Katalysato
tigste Lösung sind“, so Mecking. ren für diesen Bereich extrem empfindlich
gegenüber polaren Reagenzien und werden
Entwicklung katalytischer durch diese zerstört, anstatt sie umzusetzen“,
schildert Mecking eine grundlegende Her
Verfahren als Schlüsselschritt ausforderung.
Zusammen mit seiner Arbeitsgruppe ver
folgt Mecking daher den Ansatz, die Kunst
stoffe selbst umweltverträglicher zu ma
chen, und zwar in sämtlichen Phasen ihres
Lebenszyklus: von der Rohstoffgewinnung
und Synthese bis zum Abbau oder Recycling.
Einer der Schwerpunkte der Arbeitsgruppe
liegt deshalb auf der Erforschung katalyti
scher Systeme zur Herstellung innovativer
Kunststoffe. Ihre methodische Bandbreite
beinhaltet sowohl grundlegende mechanis
tische Untersuchungen zum Verständnis der
Systeme als auch die Herstellung und Entde
ckung von neuen Katalysatoren und deren
Einsatz in der Materialerzeugung.
„Wir interessieren uns vor allem dafür,
Katalysatoren zu entwickeln oder zu entde
cken, die in der Lage sind, auch polare Rea
genzien umzusetzen“, präzisiert Mecking.
Dazu muss man wissen, dass viele der in
dustriell wichtigen Kunststoffe, wie zum
Beispiel Polyethylen (PE), ausschließlich aus
langen Kohlenwasserstoffketten bestehen
und daher unpolar sind – ein Grund, warum
sie so reaktionsträge und langlebig sind. Die
Einführung polarer Gruppen in derartige,
unpolare Kunststoffe ist besonders interes
14Kunststoffe neu gedacht
Von besserer Abbau- und
Rezyklierbarkeit
Und doch gelang der Arbeitsgruppe kürzlich
ein großer Erfolg in diese Richtung. So wur
de ein katalytisches Verfahren entdeckt, das
den Einbau von kleinen Mengen hochreak
tiven Kohlenmonoxids in PEs erlaubt. Dabei
entstehen sogenannte Ketogruppen. „Durch
die maßvolle Erzeugung dieser Ketogrup
pen bleiben die vorteilhaften mechanischen
Eigenschaften von PE in dem modifizierten
Kunststoff erhalten, er erhält aber gleichzei
tig neue wünschenswerte Eigenschaften“,
beschreibt Mecking. So ist der modifizierte
Kunststoff unter anderem photoabbaubar.
„Wir konnten im Labor beobachten, dass
unser Kunststoff unter künstlichem Son
nenlicht langsam zerfällt. Würden Produkte
aus diesem Kunststoff also ungewollt in die
Natur gelangen, würden sie dort um ein Viel
faches schneller verwittern als Produkte aus
herkömmlichem PE“, erklärt Mecking.
Besser wäre es natürlich, würden Kunst
stoffe gar nicht erst den Weg in die Umwelt
finden, sondern effektiv recycelt werden.
Auch hier bieten die katalytischen Verfah
ren der AG Mecking potentielle Ansätze, um
die teils noch schlechten Recyclingoptionen
von Kunststoffen zu verbessern. So gelang
Der chemisch recycel-
bare Kunststoff der AG
ihnen – ebenfalls durch den katalytisch kon
Mecking eignet sich trollierten Einbau funktioneller Gruppen in
gut für additive Verfah- PE-artige Kunststoffe – ein weiterer Clou. In
ren wie den 3D-Druck. diesem Fall fungieren die eingebauten Grup
Hier wird eine Handy-
pen als chemische „Sollbruchstellen“, mithil
hülle gedruckt.
© AG Mecking fe derer Produkte aus dem Kunststoff nach
Ablauf ihres Lebenszyklus per chemischem
Recycling nahezu vollständig in ihre Aus
gangsbausteine zurückzerlegt werden kön
nen. „Auch hier war die genaue Einstellung
der Dichte an funktionellen Gruppen im
Kunststoff essentiell, um keine Kompromis
se bei den Materialeigenschaften eingehen
zu müssen“, erläutert Stefan Mecking.
Auf diese Weise konnte ein weiterer mo
difizierter Kunststoff hergestellt werden, der
dem Ausgangsmaterial nicht nur ebenbürtig
ist, sondern neben der neugewonnenen che
mischen Rezyklierbarkeit – die deutlich effek
tiver und energieeffizienter ist als bestehende
Verfahren für PE – noch weitere Vorteile hin
zugewonnen hat. So eignet er sich zum Bei
spiel gut für additive Fertigungsverfahren,
15Chemische Materialwissenschaft
wie den 3D-Druck. „Natürlich geht es uns gewünschte chemische Reaktion bewirkt.
bei unserer Forschung nicht nur darum, die Dieses Erweitern der natürlichen Zellma
Umweltverträglichkeit von Kunststoffen zu schinerie ist einer von verschiedenen Bioraf
verbessern. Wir möchten auch weitere Ma finerie-Ansätzen, welche wir verfolgen, um
terialeigenschaften erreichen, sei es wie hier auch die für die Synthese von Kunststoffen
die Eignung für additive Verfahren oder – als benötigten Bausteine nachhaltiger zu gewin
weiteres Beispiel – die Kompatibilität mit an nen“, berichtet Mecking.
deren Materialien“, so Mecking. ds.
Bioraffinerien
und Mikroalgen
Entwickelt hat die AG Mecking ihr chemi
sches Recycling-Verfahren an PE-artigen
Kunststoffen auf Basis nachwachsender Fet
te und Öle statt Erdöl – auf lange Sicht ein
weiterer wichtiger Schritt in Richtung inno
vativer, zukunftsträchtiger Kunststoffe. Neue Weitergehende
katalytische Ansätze könnten hierbei auch Informationen
die Verwendung von Abfallfetten oder Al
genölen als Rohstoff ermöglichen. „Ähnlich
wie höhere Pflanzen betreiben viele Algen
Photosynthese. Sie nutzen also Sonnenlicht
als Energiequelle für die Synthese komple
xer Kohlenstoffverbindungen aus atmo
sphärischem Kohlenstoffdioxid“, erläutert
Mecking. Nachwachsende Fette und Öle auf
Algen-Basis bergen deshalb das Potential zur
emissionsarmen Produktion von Bausteinen
für Kunststoffe und Chemikalien. Anstatt – t1p.de/4zu2d
aber solche Rohstoffe als Erdöl-Ersatz für
herkömmliche petrochemische Raffinerien
einzusetzen, sind neue, maßgeschneiderte
katalytische Ansätze wünschenswert.
„Um die Raffinierung nachwachsender
Rohstoffe effizienter zu gestalten, wäre ein
möglicher Ansatz, die in der chemischen
Industrie benötigten Bausteine oder Che Video des
mikalien direkt in der Quelle selbst zu er Forschungsprojekts
zeugen und sie dann schonend aus dieser zu
extrahieren“, so Mecking. Gerade ist seiner
Gruppe erstmalig ein wichtiger Meilenstein
in Richtung solcher lebenden Bioraffinerien
gelungen: Durch das Einschleusen eines Ka
talysators für eine industriell hochrelevante
chemische Reaktion – die Olefinmetathese –
in die Lipidspeicher von Mikroalgen konnten
sie das natürliche Synthesespektrum dieser
einzelligen Organismen künstlich erwei
tern. „Tatsächlich konnten wir nachweisen, – t1p.de/er8tf
dass unser Katalysator im Lipidspeicher der
Algen trotz der chemisch hochkomplexen
Umgebung stabil bleibt und die von uns
16Stefan Mecking ist
seit 2004 Professor für
Chemische Material-
wissenschaft am Fach-
bereich Chemie der
Universität Konstanz.
Er erforscht mit seiner
Arbeitsgruppe kata-
lytische Verfahren, die
auf mehreren Ebenen
die Umweltverträglich-
keit von Kunststoffen
steigern.
„Wir konnten im Labor beobachten, dass
unser Kunststoff unter künstlichem
Sonnenlicht langsam zerfällt. Würden
Produkte aus diesem Kunststoff
also ungewollt in die Natur gelangen,
würden sie dort um ein Vielfaches
schneller verwittern als Produkte aus
herkömmlichem Polyethylen.“
Stefan Mecking
17The Politics of Inequality
Mit
Avataren
dem
Charisma
auf
der Spur
Ein interdisziplinäres Projekt erforscht, wie
politisches Charisma bei Politiker*innen
mit gesellschaftlich marginalisiertem Hintergrund
wahrgenommen wird.
18Charisma
Bei den Avataren lassen sich einzelne Aspekte wie die Hautfarbe verändern.
Quelle: Unreal® Engine, © 1998-2022, Epic Games, Inc. All rights reserved.
19The Politics of Inequality
Über Charisma wird bislang vor allem Politikwissenschaft wird Charisma gerne
im amerikanischen Raum geforscht, in als eine magische Fähigkeit beschrieben,
Deutschland betritt das interdisziplinäre Einfluss auf andere zu nehmen“, sagt So
Projekt „Wahrnehmungen von politischem ziolinguistin Judit Vári. „In unserem Pro
Charisma bei Sprecher*innen mit niedrigem jekt wollen wir jedoch von dieser Idee weg
Status“ noch weitgehend Neuland. Das mag kommen und strukturell ein paar konkrete
daran liegen, dass man hierzulande „Cha Puzzleteilchen finden, die wir isolieren
risma“ auch historisch bedingt mit Skepsis und testen können, um das Bild genauer
begegnet und die Frage mitschwingt: Gibt es zu zeichnen.“
auch so etwas wie „böses“ Charisma? Ein erstes Stimmungsbild darüber, wel
che Eigenschaften charismatischen Men
Was ist eigentlich schen zugeschrieben werden, holten die
Wissenschaftler*innen bei einer Umfrage
Charisma? in der Langen Nacht der Wissenschaft in
Konstanz ein. Charismatisch assoziierten
Charisma wird abhängig von der Fachdis die teilnehmenden Besucher*innen mit „re
ziplin recht unterschiedlich definiert. Der degewandt“, „kompetent“ und „wissend“,
kleinste gemeinsame Nenner: Charisma er was Ergebnissen von angloamerikanischen
zeugt bei uns den Glauben, dass die charis Studien ähnelt. „Da wir sehr offen gefragt
matische Person eine gewisse Kompetenz hatten, wurden auch neue Eigenschaften
hat. Die oder der Charismatische schafft genannt, insbesondere ‚authentisch‘, was in
es, andere Menschen zu motivieren und anderen Charisma-Studien keine Rolle spiel
ihre Handlungen zu beeinflussen. „In der te“, erzählt die Wissenschaftlerin.
Von vielen als charismatisch wahrgenommen:
Barack Obama
20Charisma
„Kann es sein, dass sich
Wahrnehmungen von Charisma
bei Menschen mit
unterschiedlichem Status
unterscheiden?“
Judit Vári
Das vom Exzellenzcluster „The Politics of In len die Forschenden sowohl die bewussten
equality“ geförderte Projekt interessiert sich Charisma-Zuschreibungen als auch die un
besonders dafür, wie politisches Charisma bewussten herausfinden. Und sie arbeiten
bei Politiker*innen mit gesellschaftlich mar dabei mit Stimuli, bei denen nur eine Stim
ginalisiertem Hintergrund wahrgenommen me gehört, nur ein Bild präsentiert oder bei
wird. Denn diese Gruppe mit niedrigem de kombiniert werden.
Status ist in der Politik immer noch unter Um herauszufinden, was Menschen be
repräsentiert. Frauen beispielsweise oder wusst denken und fühlen, erhalten die Teil
Menschen mit einer anderen sozialen oder nehmenden Fragebögen und bekommen
ethnischen Herkunft als die Mehrheitsge genügend Zeit, um diese auszufüllen. „Die
sellschaft kommen unverhältnismäßig sel unbewussten Wahrnehmungen ermitteln
ten oder nur in bestimmten Funktionen vor. wir anhand von Experimenten, die von
„Ein paar Studien untersuchen Charisma den Teilnehmern nicht beeinflusst werden
in Verbindung mit Wahlergebnissen. Wir können. Welche Verbindungen oder Asso
fragen jetzt weiter: Kann es sein, dass sich ziationen im Kopf bestehen, können wir
Wahrnehmungen von Charisma bei Men uns dabei über sehr kurze Reaktionszeiten
schen mit unterschiedlichem Status unter herleiten“, erklärt Vári und fährt fort: „So
scheiden? Dies könnte eventuell zu diesen können Antworten, die von der sozialen Er
Unterrepräsentationen führen“, meint Vári. wünschtheit gesteuert werden, herausgefil
tert werden.“
Wie findet man mehr Die äußere Erscheinung, so weiß man
aus Studien, spielt bei Charisma-Wahrneh
über Charisma heraus? mung generell eine große Rolle. Damit das
Projekt-Team einzelne Puzzleteile isolieren
Mit Projektleiterin Tamara Rathcke und kann, verwendet es keine echten Personen
Judit Vári, beide Soziolinguistinnen, sowie in den Experimenten, sondern Avatare.
Diego Frassinelli, spezialisiert auf KI in der Hier bringt Duangkamol Srismith Kompe
Computerlinguistik, ist es ein schwerpunkt tenzen aus der kognitiven Psychologie ein,
mäßig sprachwissenschaftliches Projekt. wenn sie zusammen mit dem Informatiker
Sein Aufbau ist so ehrgeizig wie komplex: Stephan Streuber die Avatare entwirft.
Drei Arten von niedrigerem Status werden Diese sollen nicht nur natürlich aussehen,
untersucht, hinsichtlich sozioökonomischem sondern sich auch naturecht animieren
(Klasse und Bildung) und ethnischem Hin lassen. Mithilfe der Avatare können die For
tergrund sowie Geschlecht. Außerdem wol scher*innen einzelne Faktoren isolieren,
21The Politics of Inequality
indem sie nur einen Aspekt wie die Haut benutzen die gleichen Wörter, werden jedoch
farbe verändern. Sie können die Avatare anders im Charisma eingeschätzt, weil eben
auch androgyn gestalten, also männliche Merkmale des niederen Status doch heraus
und weibliche biologische Merkmale ver zuhören sind.“
schmelzen.
Bei den auditiven Stimuli testet das Team Wer kommt wie
Variationen im Akzent und Dialekt. Bei
spielsweise wird bei einer Rede ein regiona beim Publikum an?
ler Dialekt oder der Akzent eines Nicht-Mut
tersprachlers eingebaut. Menschen können Doch auch die Zuhörerschaft selbst beein
erstaunlich viel aus einer Stimme heraus flusst, wie Charisma-Merkmale bewertet
hören oder herleiten, etwa einen ethnischen werden, was noch kaum erforscht ist. Das
Hintergrund. In der Soziolinguistik spricht Projekt-Team legt daher einen Schwer
man von „social profiling“. Die Sprechweise, punkt auf Variationen im Publikum: Bei
wie schnell, hoch oder tief gesprochen wird, wem kommt jemand anderes als charisma
spielt hier ebenso herein wie Inhaltliches: tisch an und wovon hängt das ab? Die Al
Wie viele emotionale Wörter benutze ich? tersgruppe und ihre mediale Prägung kann
Inwiefern beziehe ich den Zuhörer in meine einen Unterschied machen, aber auch die
Rede mit ein? eigene politische Orientierung oder der so
Viel wird auch in eine Stimme hineinin zioökonomische Hintergrund inklusive Bil
terpretiert, weiß Vári, das jedoch in nachvoll dungsgrad. Die Wissenschaftlerin erwartet
ziehbaren Mustern. Zum Beispiel höre sich hier sozialpsychologische Effekte wie den
ein regionaler Dialekt manchmal nicht ganz der In- und Out-Group: Die eigenen Grup
so intelligent an wie Hochdeutsch. Sie sagt: penzugehörigen werden tendenziell positi
„Uns interessiert besonders die Kombination ver bewertet als die anderen. „Interessant
der Elemente, ob dieses Charisma auch noch wird es dann, wenn das nicht passiert oder
gehört wird, wenn die Person anders aus wenn sich hier Unterschiede feststellen las
sieht. Und möglicherweise sprechen zwei sen. Nehmen wir an, jemand spricht selbst
Personen gleich schnell, gleich hoch oder tief, bayerisch und findet den eigenen Dialekt
„Und möglicherweise sprechen
zwei Personen gleich schnell, gleich hoch
oder tief, benutzen die gleichen
Wörter, werden jedoch anders im
Charisma eingeschätzt, weil
eben Merkmale des niederen Status
doch herauszuhören sind.“
Judit Vári
22Charisma
Judit Vári arbeitet als Postdoc im Projekt „Wahrnehmungen von politischem Charisma bei Sprecher*innen mit
niedrigem Status“, das der Exzellenzcluster „The Politics of Inequality“ fördert. 2021 promovierte sie an der Bangor
University in Wales, Großbritannien, über die bewusste und unbewusste Wahrnehmung und Akzeptanz von
Sprecher*innen sprachlicher Varianten.
bei einem männlichen Politiker charisma Wenn es um die eigene Einschätzung von
tisch, nicht aber bei einer weiblichen Politi charismatischen Personen geht, lässt Judit
kerin“, so Vári. Vári doch eher Skepsis walten. Sie gibt aber
Damit nicht genug. Das Projekt wird in zu, dass sie ein ähnliches Votum wie die Be
Deutschland und Großbritannien durchge sucher*innen der Langen Nacht der Wissen
führt und vergleicht die Ergebnisse. „Allein schaft getroffen hätte. Diese hatten Barack
schon wegen der unterschiedlichen Organi Obama als charismatische öffentliche Per
sation der politischen Systeme erwarten wir sönlichkeit am häufigsten genannt.
uns große Unterschiede. Die Wahrnehmung cmv.
der politischen Debatten läuft ja ganz anders
ab“, meint Vári und freut sich, Politikwissen
schaftler Susumu Shikano mit im Boot zu
haben. Aufgrund des Ländervergleichs, zu
mal jeweils verschiedene Dialekte einbezo
gen werden, wird das Projekt-Team sehr vie
le Teilnehmer*innen benötigen. Sie suchen
diese gerade auch außerhalb der Universität,
um eine möglichst vielfältig politisch orien
tierte Zuhörerschaft abzudecken.
23Praktische Philosophie 24
Umgang mit dem Tod
Müssen
wir den Tod
fürchten?
Die Philosophin Susanne Burri hinterfragt
unseren Umgang mit dem Tod.
Ein Interview über verdrängte Furcht,
zukunftsgerichtete Wesen und ein
selbstbestimmtes Leben.
uni’kon: Geht unsere Gesellschaft ratio- Schmerz sich darin findet und wie viel Freu
nal mit dem Tod um, Frau Burri? de sich in diesem Leben „abzählen“ lässt. In
Susanne Burri: Wir verdrängen den Tod und kurz: Je mehr Freude und gute Gefühle, je
unsere eigene Sterblichkeit zu sehr. Zwar sind weniger Schmerz und negative Gefühle, des
es nicht wirklich Tabuthemen, aber sie sind to besser sei ein Leben.
nahe dran. Es ist immer noch seltsam, über
den Tod zu sprechen, und das kann nur scha Wie kommt der Tod in diese Gleichung
den. Wir müssen alle sterben – und wir sollten hinein?
offener damit umgehen. Das kann wichtige Der Tod ist das Ende unserer Existenz. Wenn
Vorteile bringen, gerade bei Themen wie der man tot ist, kann man keinen Schmerz mehr
Sterbehilfe. Das Schlimmste am modernen empfinden – zwar auch keine Freude, aber
Umgang mit dem Tod ist das Verdrängen. eben auch keinen Schmerz. Nach Sicht der
Epikureer bedeutet das: Wenn wir nicht
Müssen wir den Tod denn fürchten? mehr existieren, kann uns auch kein Leid
Das ist eine Frage, mit der sich die alten mehr befallen. Daher sei es irrational, wenn
Griechen – insbesondere die Epikureer – sehr man sich vor dem Tod fürchte.
intensiv beschäftigt haben. Die Epikureer
waren überzeugt: Wenn wir uns der Angst Trotzdem ist es für uns das Natürlichste
vor dem Tod stellen und uns fragen: „Wovor auf der Welt, dass wir uns vor dem Tod
fürchten wir uns eigentlich?“ – dann ginge fürchten – oder ihn zumindest vermei-
die Angst weg. Denn der Zustand, tot zu sein, den wollen.
sei an sich nicht schlimm und der Tod damit Deswegen habe ich begonnen, mich damit
nichts Bedrohliches. philosophisch zu befassen. Weil ich mit den
Die Epikureer hatten eine hedonistische Epikureern zwar grundsätzlich einig war,
Weltsicht. Das bedeutet: Für sie bemisst sich dann aber fand: Mein eigenes Verhalten
die Qualität des Lebens danach, wie wenig passt nicht zu dieser Meinung.
25Praktische Philosophie
Ich hatte ein ganz simples Aha-Erlebnis: Ich „Das schauerlichste Übel also, der Tod,
stand an einem Fußgängerstreifen, habe
geht uns nichts an;
nach links und rechts geschaut und dann
überlegt: Wenn der Tod kein Übel ist – war denn solange wir existieren, ist der Tod
um schaue ich dann nach links und rechts, nicht da, und wenn der Tod
bevor ich über die Straße gehe?
da ist, existieren wir nicht mehr.“
Ich habe das dann natürlich sofort ratio
nalisiert: Klar, ich will keinen Unfall haben,
ich will keine Schmerzen erleiden. Aber ich
Epikur, 3. Jahrhundert v. Chr.
fand: Das trifft den Kern nicht. Ich will, ehr
lich gesagt, insbesondere auch den Tod ver
meiden.
Mittlerweile finde ich die Idee, dass der
Tod nichts bedeute, fast unmöglich zu ak
zeptieren. Was daraus folgen würde, ist auch
eine Entwertung des Lebens. Man nimmt sie daran denken, dass sie irgendwann (und
dem Tod seinen Stachel, aber nur, indem bald!) nicht mehr existieren werden. Dass
man das Leben wertlos macht – ihm seinen man die eigene Nicht-Existenz als etwas
Reiz nimmt. sieht, das furchteinflößend ist, ist aus meiner
Sicht irrational, auch wenn das Gefühl vie
Warum entwertet es das Leben? le Menschen kennen. Denn: Ich bin dann ja
Das Idealbild der Epikureer vom guten Le nicht mehr da, was fürchte ich dann also? Da
ben ist die Seelenruhe (Ataraxie), dass man kommt auch das Symmetrieargument von
gleichmütig und sorgenlos in den Tag hinein Lukrez ins Spiel: Es gab ja auch mal eine Zeit,
lebt. Das ist für mich eine flache Existenz. bevor wir geboren wurden – und dies emp
Martha Nussbaum sagt: Als Menschen finden wir ja auch in keiner Weise als furcht
sind wir zukunftsgerichtete Wesen. Wir füh einflößend.
len nicht nur Freude und Schmerz, und die
Güte eines Lebens berechnet sich nicht nur Also eher ein „gesunder Respekt“ vor
aus der Nettosumme von Freude und Leid. dem Tod.
Als Handelnde haben wir Pläne, Projekte. Wir Im Prinzip ja. Der Tod ist ein Übel, denn er
leben in die Zukunft hinein. Ein Beispiel: Man nimmt uns das Leben, und das Leben ist et
hat Kinder und will, dass es ihnen gut geht, was Gutes. Aber das war es dann auch schon.
teilweise auch deswegen, weil man für sie da Er ist nichts Seltsames, Unbegreifliches, Un
ist und Zeit mit ihnen verbringt. Oder man heimliches. Und unsere Konsequenz daraus
verfolgt ein Projekt, das einem wichtig ist – sollte vielmehr sein: Wenn unser Leben end
das Teil der eigenen Identität ist. lich ist, dann leben wir es doch so gut wie
Der Tod bedroht diese Projekte. Er be möglich. Wir sollten rational mit dem Tod
droht uns, weil wir zukunftsgerichtete umgehen als etwas, was zwar zu vermeiden
Wesen sind, die nicht einfach in den Tag ist, aber nicht at all costs – nicht auf Kosten
hineinleben. Weil wir unser Leben zukunfts eines gut gelebten Lebens.
gerichtet leben, ist der Tod ein Übel, das zu
Recht gefürchtet werden kann. Diese These Nicht auf Kosten des Lebens – können
finde ich sehr überzeugend. wir Leben und Tod denn gegenrechnen?
Was ich immer an Extrem-Bergsteigern be
Dann ist es wichtig, dass wir den Tod wundere: Sie gehen offener mit dem Tod um.
fürchten? Sie betrachten ihn als kalkuliertes Risiko.
Die Grundannahme teile ich: Der Tod muss Sie fürchten den Tod ebenfalls – sie wollen ja
eine Bedrohung bleiben, weil das ein siche nicht sterben. Aber sie fürchten ihn nicht als
res Anzeichen dafür ist, dass unser Leben ein absolutes Übel. Es wäre für sie auch ein
gut und lebenswert ist. Wenn er wirklich Übel, nicht auf den Berg zu klettern.
keine Bedrohung mehr ist, ist unser Leben Das muss die Grundidee sein: Das
vielleicht gar nicht mehr so lebenswert. schlimmste Übel wäre, dass wir das kurze
Aber: Diese tiefe Furcht vor dem Tod, oder Leben, das wir haben, nicht so leben, wie wir
dass man ihn als etwas Unheimliches emp es eigentlich möchten. Man muss dafür na
findet, finde ich falsch. Es gibt Menschen, türlich nicht gleich auf Berge klettern oder
die einen absoluten Terror verspüren, wenn unnötige Risiken eingehen.
26Umgang mit dem Tod
Wie sähe eine Gesellschaft aus, die ratio- man noch ein paar Monate Lebenszeit her
naler mit dem Tod umginge? ausholt. Wenn hier ein Umdenken stattfin
Einer der wichtigsten Bereiche ist für mich, den würde, könnte die Medizin noch mehr
wie unsere Medizin mit dem Tod umgeht. für den Menschen tun.
Eine Gesellschaft, die offener mit dem Tod
umgehen würde, wäre zum Beispiel der Ster Geht es letzten Endes um Selbstbestim-
behilfe gegenüber weniger abgeneigt. mung? Um das Recht, für sich selbst zu
Das Thema Sterbehilfe kommt immer noch entscheiden, wie wir leben möchten –
mit einem Stigma, was ich falsch finde. Eine und wann wir nicht mehr leben wollen?
Person wird häufig nur deshalb, weil sie die Autonomie und Selbstbestimmung sind für
Sterbehilfe wählt, als verwirrt oder nicht zu mich grundlegend, ja. Da gehört für mich mit
rechnungsfähig betrachtet. Dabei kann es dazu, dass wir grundsätzlich die Annahme
durchaus vernünftig sein, wenn eine schwer treffen, dass jemand zurechnungsfähig ist.
kranke Person sich sagt: Ich möchte unter Auch wenn unsere Meinung, was für diese
den Bedingungen, die zu erwarten sind, Person gut ist, von ihrer eigenen abweicht.
nicht mehr leben. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen
davon, was wichtig ist im Leben. Das gilt es
Selbst in der Medizin ist der Tod also in zu respektieren – auch bei Abwägungen hin
gewisser Weise ein Tabu? sichtlich des Todes. Wenn der Tod ins Spiel
Wir haben in der Medizin eine ungute kommt, dann kommt heute leider immer
Grundannahme, dass es um unbedingte Le schnell auch der Paternalismus daher, und es
bensverlängerung geht. Wenn etwas getan wird über die Köpfe anderer Menschen hin
werden kann, was unser Leben verlängert, weg entschieden. Wie eben bei der Sterbehil
dann wird das grundsätzlich auch getan. fe: Wir sollten nicht für andere bestimmen,
Man braucht sehr gute Gründe, dass ein Arzt dass sie ihr Leben maximal zu verlängern
nicht diese maximal lebensverlängernde haben, nur weil uns das ein gutes Gefühl gibt.
Maßnahme wählt. Wir müssen offener über den Tod spre
Das scheint mir in vielen Fällen verfehlt: chen. Dann können wir auch diese schwie
Im Endeffekt geht es doch um Lebensquali rigen Abwägungen mit kühlerem Kopf und
tät. Wir sind in der Medizin zu wenig offen, zugleich menschenfreundlicher treffen.
dass bestimmte Interventionen die Lebens Das Gespräch führte Jürgen Graf.
qualität zu arg beeinträchtigen, auch wenn
Susanne Burri ist Juniorprofessorin
für Praktische Philosophie unter
besonderer Berücksichtigung der
politischen Philosophie und der
Sozialphilosophie an der Universität
Konstanz. Zu ihren Forschungs-
schwerpunkten zählen die normative
Ethik und die Philosophie des Todes.
27Ethnologie
Zeit macht
den Unterschied
Wenn Länder des Globalen Südens einander helfen,
kennen sie die Ausgangslagen besser,
weil sie denen im eigenen Land ähneln, und
begegnen sich auf Augenhöhe. So die Theorie,
die die Ethnologin Maria Lidola am
„Mehr-Ärzte-für-Brasilien-Programm“ überprüft.
28Die Ethnologin Maria Lidola arbeitet als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin für Lehraufgaben
(Lecturer) zu den Schwerpunkten „Migration
und Transnationalismus“ und „Ethnographische
Methoden“ an der Universität Konstanz. Nach ihrer
Promotion an der FU Berlin war sie Gastwissen-
schaftlerin an der Bundesuniversität Rio de Janeiro
(UFRJ) in Brasilien. Ihre aktuellen Forschungen
über Süd-Süd-Beziehungen, gerade in humanitä-
ren und medizinischen Settings, gehören einem
noch kleinen, aber wachsenden Forschungsfeld in
der Ethnologie an.
Im August 2013 landet die erste Delegation ein linkes Projekt der Regierung zur kom
von Ärzt*innen aus Kuba in Brasilien als Teil munistischen Unterwanderung Brasiliens.
des „Mehr-Ärzte-für-Brasilien-Programms“. Die Professionalität der Ärzt*innen wird in
Dieses hat die brasilianische Regierung ein Frage gestellt: Wie könne es sein, dass so ein
geführt, um den Notstand im öffentlichen kleines Land wie Kuba so viele Ärzt*innen
Gesundheitssektor zu lindern; insbesondere hervorbringe, um sie nach Brasilien senden
kubanische Mediziner*innen sollen in den zu können? Diese Inhalte werden auch über
nächsten Jahren unterstützen. Doch brasili Memes, satirische Bilder, auf Social Media
anische Ärzt*innen begrüßen die Kolleg*in verbreitet, die von den mittleren und unte
nen aus Kuba, darunter viele nicht-weißer ren Bevölkerungs-Schichten stark konsu
Hautfarbe, mit Buhrufen. Viele werfen den miert werden.
Neuankömmlingen diskriminierende und Viele in der brasilianischen Ärzteschaft,
rassistische Äußerungen entgegen. Das die sich weitgehend im privaten Sektor loka
Bild geht in den brasilianischen Medien vi lisiert oder in Mittelschichtsgegenden tätig
ral. „Für mich war das ein einschneidender ist, stützen diese Darstellungen. Dabei sind
Moment“, sagt Ethnologin Maria Lidola, „der sie selbst nicht bereit, im schlecht bezahlten,
mich dazu bewegt hat, mich mit diesem Pro desolaten öffentlichen Gesundheitssektor zu
gramm und seiner Umsetzung vor Ort aus arbeiten. In den Familienkliniken weigern
einanderzusetzen.“ sich einige Patient*innen, sich von „schwar
Viele der kubanischen Ärzt*innen haben zen“ Ärzt*innen untersuchen zu lassen. Eine
bereits einschlägige Erfahrung in interna kubanische Ärztin beschreibt diese für sie
tionalen Missionen gesammelt. Die medizi schmerzhafte Erfahrung: „Ich hätte nie ge
nische Unterstützung für Regionen in Not dacht, dass jemand von mir nicht behandelt
ist bis heute eine Art Aushängeschild der ku werden möchte, der die gleiche Hautfarbe
banischen Regierung – humanitär motiviert, wie ich hat. Ich bin doch eine Ärztin wie alle
aber auch aus politischen, wirtschaftlichen anderen auch.“
und nicht zuletzt ideologischen Gründen.
Obwohl ihnen auch andernorts politischer Forschungsaufenthalt
Gegenwind entgegenwehte, glauben viele
der Ankommenden, dass in den brasiliani in aufgeheiztem Klima
schen Einsatzgebieten Rassismus kein The
ma sei, zumindest dort, wo Menschen hilfs In diesem aufgeheizten Klima tritt Maria
bedürftig sind. Brasilien hat nach außen Lidola 2014 ihren ersten Forschungsaufent
lange den Mythos einer „Rassendemokratie“ halt in Rio de Janeiro an. In zwei Favelas mit
gepflegt. Weit gefehlt. den dortigen Familienkliniken begleitet sie
Es kommt zu heftigen Diskussionen in die kubanischen Ärzt*innen und das bra
konservativen Mediensendern, die sehr prä silianische Personal in ihrem Alltag, führt
sent in Brasilien sind. Dem „Mehr-Ärzte-für- zahlreiche Interviews und arbeitet mit teil
Brasilien-Programm“ wird unterstellt, es sei nehmender Beobachtung. „In diesem sehr
29Ethnologie
politisierten Kontext war es eine große He Einsätze vor Ort sind belastend
rausforderung, Vertrauen aufzubauen. Im und nicht ungefährlich
merhin fand ich als Außenstehende einen
besseren Zugang zu den Kubaner*innen,
zumal ich aus Ost-Deutschland komme und Zweimal pro Woche brechen die kubanischen
eine Mama habe, die noch in der DDR im Mediziner*innen von den am Rande der Fave
Gesundheitswesen als Krankenpflegerin ge la gelegenen Familienkliniken auf, um Haus
arbeitet hat“, erzählt die Wissenschaftlerin. besuche zu machen und dadurch ihr Viertel
Anfangs stellt sie ein allgemeines Unbe und seine Bewohner*innen kennenzulernen.
hagen der Bevölkerung gegenüber den Ku „Der Schritt in die Favela hinein bedeutet, sich
baner*innen fest. Anders als erwartet seien erst mal mit den sehr heterogenen sozialen
Süd-Süd-Kooperationen nicht nur von mehr Realitäten dort auseinanderzusetzen“, meint
Verständnis für die medizinischen Notstän Lidola. So setzen sie den präventiven Ansatz
de geprägt, sondern auch von Vorurteilen. der Familienmedizin um, die Familien auch
„Die kubanischen Ärzt*innen hatten jedoch in ihrem sozio-ökologischen Umfeld – Wohn
sehr schnell heraus, woran es in den Fami situation, sanitäre Einrichtungen, Hygiene –
lienkliniken fehlte“, erklärt die Ethnologin, kennenzulernen. Auch etwas, wozu sich die
„nämlich Zeit. So nahmen sie sich Zeit für brasilianischen Kolleg*innen keine Zeit neh
ihre Patient*innen, was für diese eine neue men, zumal Einsätze vor Ort oft körperlich
Erfahrung war. Zuvor hatten Ärzt*innen sie und emotional belastend und nicht immer
nur kurz gesehen, kaum berührt, geschwei ungefährlich sind.
ge denn etwas erklärt. Angesichts der über „Allein der Umstand, dass jemand zu ih
lasteten Kapazitäten ging es den brasilia nen nach Hause kommt, zeigt den Patient*in
nischen Ärzt*innen darum, möglichst viele nen: Da ist jemand da, der kümmert sich,
Fälle in kurzer Zeit abzuarbeiten und Medi sorgt sich um dich. So wird ein Gefühl der
kamente zu verschreiben.“ Wertschätzung vermittelt, das sie zuvor nicht
Ärztlicher Hausbesuch
in einer Favela in Rio
de Janeiro
© Maria Lidola
30Sie können auch lesen