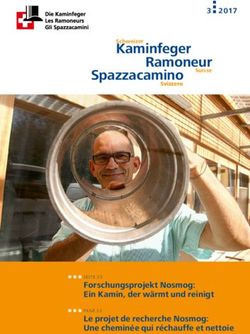Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik - Année politique Suisse
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik Suchabfrage 21.12.2018 Thema Keine Einschränkung Schlagworte Keine Einschränkung Akteure Appenzell Innerrhoden Prozesstypen Keine Einschränkung Datum 01.01.1988 - 01.01.2018 ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.88 - 01.01.18
Impressum Herausgeber Année Politique Suisse Institut für Politikwissenschaft Universität Bern Fabrikstrasse 8 CH-3012 Bern www.anneepolitique.swiss Beiträge von Ackermann, Marco Ackermann, Nadja Barras, François Benteli, Marianne Bernath, Magdalena Bernhard, Laurent Bieri, Niklaus Brändli, Daniel Burgos, Elie Bühlmann, Marc Clivaz, Romain Denz, Andrea Frick, Karin Gerber, Marlène Giger, Nathalie Guignard, Sophie Heidelberger, Anja Hirter, Hans Hohl, Sabine Mosimann, Andrea Müller, Eva Porcellana, Diane Rinderknecht, Matthias Strohmann, Dirk Unbekannt, Autor Zumbach, David Zumofen, Guillaume Bevorzugte Zitierweise Ackermann, Marco; Ackermann, Nadja; Barras, François; Benteli, Marianne; Bernath, Magdalena; Bernhard, Laurent; Bieri, Niklaus; Brändli, Daniel; Burgos, Elie; Bühlmann, Marc; Clivaz, Romain; Denz, Andrea; Frick, Karin; Gerber, Marlène; Giger, Nathalie; Guignard, Sophie; Heidelberger, Anja; Hirter, Hans; Hohl, Sabine; Mosimann, Andrea; Müller, Eva; Porcellana, Diane; Rinderknecht, Matthias; Strohmann, Dirk; Unbekannt, Autor; Zumbach, David; Zumofen, Guillaume 2018. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Appenzell Innerrhoden, 1989 - 2017. Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 21.12.2018. ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.88 - 01.01.18
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Chronik 1
Grundlagen der Staatsordnung 1
Politische Grundfragen 1
Verfassungsfragen 1
Landes- und Weltausstellungen 2
Stimmung in der Bevölkerung 4
Rechtsordnung 4
Bürgerrecht 4
Strafrecht 5
Stimm- und Wahlrecht 5
Öffentliche Ordnung 6
Institutionen und Volksrechte 7
Organisation der Bundesrechtspflege 7
Föderativer Aufbau 7
Beziehungen zwischen Bund und Kantonen 7
Wahlen 8
Wahlen in kantonale Parlamente 8
Wahlen in kantonale Regierungen 12
Kantonale Ersatzwahlen 15
Eidgenössische Wahlen 16
Wirtschaft 17
Landwirtschaft 17
Jagd 17
Tierhaltung, -versuche und -schutz 18
Öffentliche Finanzen 18
Direkte Steuern 18
Finanzhaushalt der Kantone und Gemeinden 19
Infrastruktur und Lebensraum 19
Energie 19
Erdöl und Erdgas 19
Verkehr und Kommunikation 20
Verkehrspolitik 20
Eisenbahn 21
Raumplanung und Wohnungswesen 21
Wohnungsbau und -eigentum 21
Umweltschutz 21
Naturschutz 21
Naturgefahren 22
Gewässerschutz 22
Allgemeiner Umweltschutz 22
Klimapolitik 23
Sozialpolitik 25
Bevölkerung und Arbeit 25
Bevölkerungsentwicklung 25
Arbeitsmarkt 28
Löhne 29
Arbeitszeit 31
Arbeitnehmerschutz 31
Gesundheit, Sozialhilfe, Sport 32
Medikamente 32
Sozialversicherungen 32
Krankenversicherung 32
Soziale Gruppen 33
ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.88 - 01.01.18 IMigrationspolitik 33
Frauen und Gleichstellungspolitik 34
Bildung, Kultur und Medien 35
Bildung und Forschung 35
Grundschulen 35
Hochschulen 35
Kultur, Sprache, Kirchen 35
Sprachen 35
Parteien, Verbände und Interessengruppen 36
Parteien 36
Grosse Parteien 36
ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.88 - 01.01.18 IIAbkürzungsverzeichnis
EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
EFTA Europäische Freihandelsassoziation
SECO Staatssekretariat für Wirtschaft
UREK-NR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates
SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
BFS Bundesamt für Statistik
EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
EU Europäische Union
EnDK Konferenz Kantonaler Energiedirektoren
BPUK Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz
BIF Bahninfrastrukturfonds
NEAT Neue Eisenbahn-Alpentransversale
LSVA Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherungen
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
WBF Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung
KKJPD Konferenz der Kantonalen Justitz- und Polizeidirektorinnen und
-direktoren
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
IAO Internationale Arbeitsorganisation
FABI Finanzierung und Ausbau der Eisenbahninfrastruktur
FinöV Bundesbeschluss über Bau und Finanzierung von Infrastrukturvorhaben
des öffentlichen Verkehrs
STEP Strategisches Entwicklungsprogramm Bahninfrastruktur
EHS Emissionshandelssystem
SBV Schweizerischer Bauernverband
KSK Konkordat der Schweizerischen Krankenkassen
SBV Schweizerischer Baumeisterverband
SSV Schweizerischer Städteverband
kfmv kaufmännischer Verband
VSGP Verband Schweizer Gemüseproduzenten
suissetec Schweizerisch-Liechtensteinische Gebäudetechnikverband
ISOLSUISSE Verband Schweizerischer Isolierfirmen
Swissoil Dachverband der Brennstoffhändler in der Schweiz
EV Erdöl-Vereinigung
Aerosuisse Dachverband der schweizerischen Luft- und Raumfahrt
SIAA Swiss International Airport Association
spbh Schweizerische Paritätische Berufskommission Holzbau
Swissmem Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie
FER Fédération des Entreprises Romandes
CPPREN Gemeinsame Fachkommission für den Reinigungssektor der
Westschweiz
DFJP Département fédéral de justice et police
AELE Association européenne de libre-échange
SECO Secrétariat d'Etat à l'économie
CEATE-CN Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de
l'énergie du Conseil national
CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil
national
OFS Office fédéral de la statistique
CDIP Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
UE Union européenne
CDEn Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie
DTAP Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de
l'aménagement du territoire et de l'environnement
ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.88 - 01.01.18 IIIFIF Fonds d'infrastructure ferroviaire
NLFA Nouvelle ligne ferroviaire à traverser les Alpes
RPLP Redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
LAMal Loi fédérale sur l'assurance-maladie
USS Union syndicale suisse
DEFR Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche
CCDJP Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux
de justice et police
USAM Union suisse des arts et métiers
BIT Bureau International du Travail
FAIF Financement et aménagement de l'infrastructure ferroviaire
FTP Fonds de financement des transports publics
PRODES Programme de développement stratégique de l’infrastructure ferroviaire
SEQE Système d'échange de quotas d'émission
USP Union Suisse des Paysans
CAMS Concordat des assureurs-maladie suisses
SSE Société Suisse des Entrepreneurs
UVS Union des Villes Suisses
secsuisse Société des employés de commerce
UMS Union maraîchère suisse
suissetec Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment
ISOLSUISSE Association suisse des maisons d'isolation
Swissoil association nationale des négociants en combustibles
UP Union Pétrolière
Aerosuisse Fédération faîtière de l'aéronautique et de l'aérospatiale suisse
SIAA Swiss International Airport Association
spbh Schweizerische Paritätische Berufskommission Holzbau (Commission
paritaire professionnelle liée à la construction en bois)
Swissmem L'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des
métaux
FER Fédération des Entreprises Romandes
CPPREN Commission professionnelle paritaire pour le secteur du nettoyage pour
la Suisse romande
ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.88 - 01.01.18 1Allgemeine Chronik
Grundlagen der Staatsordnung
Politische Grundfragen
Verfassungsfragen
KANTONALE POLITIK In Appenzell Innerrhoden wurde eine Strukturreform eingeleitet, die der Bedeutung
DATUM: 27.11.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT
einer Verfassungstotalrevision gleichkommt; insbesondere will der kleinste Schweizer
Kanton die Gewaltentrennung in seinen politischen Institutionen einführen. Die
Mitglieder der Regierung haben gegenwärtig im Grossen Rat ein Stimmrecht, und die
Sitzungen werden nicht von einem Grossratspräsidenten, sondern vom regierenden
Landammann geleitet. Ausserdem sollen in Zukunft die Aufgaben und Kompetenzen der
Gemeinden klarer definiert werden. Die mit der Überprüfung der politischen Strukturen
beauftragte Kommission und der Regierungsrat konnten sich im Berichtsjahr noch auf
kein Reformmodell einigen. Immerhin wurde die Verfahrensfrage geklärt. Demnach soll
die Landsgemeinde 1992 einen Grundsatzentscheid über die Fortführung der Reform
fällen; erst danach wird die Kommission über die Weiterbearbeitung eines der Modelle
entscheiden. 1
KANTONALE POLITIK In Innerrhoden nahm die Landsgemeinde am 24. April als ersten Schritt der unter dem
DATUM: 25.11.1994
DIRK STROHMANN
Begriff "Appio" zusammengefassten Verfassungsänderungen die Einführung der
Gewaltentrennung unter den politischen Behörden an. Damit wird die automatische
Mitgliedschaft der Exekutiven von Kanton und Bezirken im Grossen Rat aufgehoben,
dieser von 65 auf 46 Mitglieder verkleinert, und der regierende Landammann verliert
das Privileg der Leitung des Parlaments. Als nächster Schritt ist die Reform der
Verwaltungsstrukturen sowie eine Verkleinerung der Regierung auf sieben Mitglieder
vorgesehen, wie sie vom Grossen Rat Ende November beschlossen worden ist. 2
BUNDESRATSGESCHÄFT Der Ständerat gewährleistete in der Frühjahrssession die Verfassungsänderungen der
DATUM: 02.11.1995
DIRK STROHMANN
Kantone Glarus, Solothurn, Appenzell Innerrhoden und Wallis. In letzterem Falle hatte
die zuständige Kommission zunächst erwogen, den Beschluss über die Volksrechte und
die öffentliche Gewalt, der in der Volksabstimmung vom 24. Oktober 1993 von 78% der
stimmberechtigten Walliser Bevölkerung angenommen worden war, nur unter Vorbehalt
gewährleisten zu lassen. Grund zur Skepsis sah die Kommission zum einen in dem
weiten Umfang der Teilrevision, welcher die Frage nach der Einheit der Materie
aufwerfe. Zum anderen ist bei einem der behandelten Verfassungsartikel die
grundsätzliche Revidierbarkeit nicht ausdrücklich gewährleistet. Da sich die
Eidgenössische Verwaltung vom Staatsrat des Kantons Wallis die in der Botschaft
festgehaltenen Zusagen hatte geben lassen, verzichtete die Kommission auf die
Einreichung eines Vorbehalts. Die Verfassungsänderungen wurden dergestalt vom
Plenum und in der Sommersession auch vom Nationalrat ohne Gegenstimme
angenommen. 3
BUNDESRATSGESCHÄFT In der Sommersession genehmigte der Ständerat sowohl die Totalrevision der
DATUM: 16.09.1996
DIRK STROHMANN
Ausserrhoder Verfassung wie die Verfassungsänderungen in den Kantonen Zürich,
Luzern, Glarus, Schaffhausen, Appenzell Innerrhoden, Aargau, Genf und Jura. Der
Nationalrat folgte ihm darin im Herbst. 4
BUNDESRATSGESCHÄFT In den Kantonen selbst befürwortete die Innerrhoder Landsgemeinde die Auflösung
DATUM: 19.11.1996
DIRK STROHMANN
der Institution des Inneren Landes und die Übertragung von deren Kompetenzen an den
Kanton. Eine Initiative der christlichsozialen Gruppe für die Revision der Bezirksgrenzen
des Inneren Landes scheiterte. In Neuenburg wurde die Einleitung zur Totalrevision der
bestehenden Verfassung aus dem Jahre 1858 in der Volksabstimmung vom 10. März von
83% der Stimmenden gutgeheissen. Der Grosse Rat wurde mit knapper Mehrheit zum
Ausführungsorgan bestimmt. In Schaffhausen nahm der Grosse Rat den Beschluss über
die Inangriffnahme der Gesamtrevision der Kantonsverfassung und das dazugehörige
Ausführungsgesetz an. 5
ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.88 - 01.01.18 2Landes- und Weltausstellungen
GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE Gleich zwei Projekte für Landesausstellungen wurden im Berichtsjahr diskutiert. Die
DATUM: 27.12.2010
MARC BÜHLMANN
Kantone rund um den Gotthard (TI, UR, VS, GR) vertieften ihre Pläne für Gottardo 2020
und die Kantone der Bodenseeregion (TG, SH, SG, AI, AR) regten eine Expo Bodensee-
Rhein frühestens im Jahr 2027 an. Die Gotthard-Kantone, die ihre Expo zur Neat-
Eröffnung planten, haben im Berichtsjahr je 50 000 Franken für eine
Machbarkeitsstudie gesprochen. Die laue Begeisterung, Streitigkeiten zwischen dem
Projektleiter Marco Solari und dem Bündner Regierungsrat Stefan Engler (CVP), aber
auch Termindruck liessen das Vorhaben jedoch sterben. Die Kantone einigten sich
immerhin auf ein Programm, mit welchem die Region gestärkt werden soll. Mit dem Aus
von Gottardo 2020 wurde die Diskussion für eine Landesausstellung in der Bodensee-
Region, zu der sich die involvierten Kantone grundsätzlich positiv zeigten, wieder
intensiviert. 6
GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE Nachdem die Pläne für eine Expo 2020 in der Gotthard-Region an den Streitigkeiten
DATUM: 18.03.2011
MARC BÜHLMANN
zwischen den Planern und aufgrund der insgesamt eher lauen Begeisterung gescheitert
waren, äusserten sich die Kantone der Ostschweiz (TG, SH, SG, AI, AR) positiv zu einer
Landesausstellung im Bodenseeraum. Allerdings würde eine Expo frühestens 2027
durchgeführt. Als erstes Etappenziel formulierten die Kantone die Schaffung von
Grundlagen für eine „Expo Bodensee-Ostschweiz 2027“, die Ende 2012 den
Parlamenten zwecks Entscheids über ein Vorprojekt unterbreitet werden sollen. Der
Enthusiasmus ist allerdings nicht in allen beteiligten Kantonen gleich gross. So sicherten
etwa Schaffhausen und Appenzell Innerrhoden lediglich ideelle Unterstützung zu. 7
GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE Landesausstellungen sollen dazu dienen, sich mit der eigenen Identität
DATUM: 21.06.2014
MARC BÜHLMANN
auseinanderzusetzen. Die Organisation eines solchen für eine Willensnation nicht
unwichtigen Anlasses ist jedoch häufig mit viel Mühsal verbunden. Dies scheint auch für
die für 2027 geplante Expo Bodensee-Ostschweiz nicht anders zu sein. Zwar nahm der
von drei Kantonen (AR, SG, TG) angetriebene und mit rund CHF 600'000 finanzierte
Ideenwettbewerb im Berichtjahr Gestalt an, der Bund hatte bisher aber noch keine
Unterstützung sondern lediglich grundsätzliches Interesse signalisiert. Die Regierung
verkündete, erst Anfang 2015 Stellung nehmen zu wollen. Die Kantonsregierungen der
restlichen vier Ostschweizer Kantone (GR, AI, SH, GL) sowie der Kanton Zürich als
assoziiertes Mitglied bekannten sich Mitte März in einer gemeinsamen Erklärung zur
Expo 2027. Allerdings stiess insbesondere das Abseitsstehen des Kantons Appenzell
Innerrhoden auf Kritik. Der mit St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden stark verzahnte
Kanton wollte zuerst Fragen über den Nutzen, die Kosten und die Nachhaltigkeit des
Grossprojektes geklärt haben, bevor ein Entscheid vor die Landsgemeinde gebracht
werde. Beim vom 9. Mai bis Mitte September laufenden Ideenwettbewerb wurden
Grobkonzepte von 60 interdisziplinären Teams eingereicht – erwartet worden waren
ursprünglich mehr als hundert Eingaben. Bis Ende 2014 wurden zehn Projekte zur
Weiterbearbeitung empfohlen, die von den Offerenten weiter vertieft werden sollen.
Ziel ist es, eine tragfähige Idee bis Ende Mai zu küren und bis 2017 einen
Machbarkeitsbericht auszuarbeiten. Die Landesausstellung soll dezentral zwischen
Bodensee, Rhein und Säntis stattfinden. Geprüft werden soll dabei auch eine
Ausweitung der Landesausstellung nach Österreich und Deutschland. Der weitere
Fahrplan sieht die Beratung eines Bundesbeschlusses über die Durchführung und die
sich auf mindestens CHF 1 Mrd. belaufende Finanzierung für eine Expo 2027 im Jahr
2018 vor. Konkurrenz erwuchs den Ostschweizer Plänen aus dem Aargau. Der
Aargauische Gewerbeverband, angeführt von seiner Vizepräsidentin und Nationalrätin
Sylvia Flückiger (svp, AG), wollte den eigenen Kanton als selbstbewussten Teil der
Schweiz ins Rampenlicht stellen. Der Bundesrat beantwortete die diesbezüglich
eingereichte Interpellation mit dem Hinweis, dass es allen Kantonen freistehe, Projekte
für Landesausstellungen zu organisieren. Bis jetzt sei aber lediglich der Ostschweizer
Plan bekannt und dieser werde von allen Kantonen, einschliesslich des Kantons Aargau,
unterstützt. Tatsächlich hatten sich die Kantone im Rahmen der Plenarversammlung der
Konferenz der Kantonsregierungen in einer gemeinsamen Erklärung Mitte Juni hinter
das Projekt einer Expo 2027 im Bodenseeraum und der Ostschweiz gestellt. 8
ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.88 - 01.01.18 3VERWALTUNGSAKT Ende Januar gab der Bundesrat bekannt, die Vorbereitungsarbeiten für die Idee einer
DATUM: 28.01.2015
MARC BÜHLMANN
Ostschweizer Expo 2027 unterstützen zu wollen. Allerdings war damit keine finanzielle
sondern vielmehr strategische Hilfe gemeint: Einsitz in die Wettbewerbsjury, Hilfe beim
Aufbau von Organisationsstrukturen sowie die Begleitung einer Machbarkeitsstudie. Der
Rückenwind aus Bern wurde bei den Verantwortlichen sehr positiv kommentiert und
auch als Anerkennung der bisherigen Vorbereitungsarbeiten interpretiert. Mit der
Unterstützung aus Bern und der bereits 2014 erfolgten Zustimmung der Konferenz der
Kantonsregierungen waren wichtige Stakeholder an Bord. Das Lobbying bei den
kantonalen Behörden wurde in der Folge weiter intensiviert. Unklar blieb aber, wie
gross die Unterstützung in der Bevölkerung war.
Auch der finanzielle Rahmen wurde von der Bundesregierung vorsorglich abgesteckt.
Der Anteil des Bundes soll maximal 1 Mrd. CHF betragen, was höchstens die Hälfte der
Gesamtkosten sein darf. Der Rest soll durch Sponsoring, Eintritte und Kantonsbeiträge
finanziert werden. Freilich muss das Parlament diese Pläne noch absegnen, was
frühestens 2019 der Fall sein wird. Die Kosten für die Vorarbeiten tragen die
Trägerkantone. Diese dürften sich auf rund 10 Mio. CHF belaufen.
Das Signal aus Bern wurde im Kanton Aargau als Absage an die eigenen Pläne
interpretiert. Der kantonale Gewerbeverband hatte bereits 2014 signalisiert, dass man
sich eine Landesausstellung auch im Kanton Aargau vorstellen könnte. 9
GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE Ende April informierten die drei Trägerkantone der geplanten Expo 2027, St. Gallen,
DATUM: 24.04.2015
MARC BÜHLMANN
Thurgau und Appenzell Ausserrhoden, über den Stand des Projektes. Angestrebt werde
eine Professionalisierung der Organisationsstruktur, was etwa mit der Schaffung einer
Geschäftsstelle für 2016 umgesetzt werden soll. Diese soll mit rund 500
Stellenprozenten ausgerüstet werden. Bis 2019 rechnen die drei Expo-Kantone mit
Ausgaben von rund 9.5 Mio. CHF, um 2018 beim Bund ein überzeugendes
Bewerbungsdossier einreichen zu können. Für das im Herbst 2015 zu kürende
Siegerprojekt soll deshalb auch eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden. Zuerst
müssen aber die Parlamente der drei Kantone die jeweiligen Beiträge für diese
Planungsphase bewilligen. Die 5 Mio. CHF in St. Gallen, die 3 Mio. CHF im Kanton
Thurgau und die 0.8 Mio. CHF im Kanton Appenzell Ausserrhoden unterstanden jeweils
knapp nicht dem obligatorischen Referendum; in den Kantonen St. Gallen und Thurgau
war allerdings ein fakultatives Referendum möglich. Nicht wenige Stimmen warnten
allerdings vor einer Volksabstimmung in diesem frühen Stadium, da noch zu wenig
Fakten vorlägen. Die Bevölkerung solle erst 2018 befragt werden.
Für die Gesamtkosten gaben die Regierungsräte der drei Kantone Schätzungen
zwischen 1.5 bis 2 Mrd. CHF an, wovon der Bund etwa die Hälfte übernehmen werde.
Auch wenn mittels Sponsoring und Eintritte Mittel generiert werden sollen, müssten die
Trägerkantone einen substanziellen Beitrag selber leisten. 10
KANTONALE POLITIK Die Parlamente aller drei Trägerkantone sprachen sich im Herbst für die Kredite für die
DATUM: 01.12.2015
MARC BÜHLMANN
Vorbereitungen einer Expo2027 aus. Allerdings gaben die Anträge und insbesondere die
Frage, ob die Kredite der Stimmbevölkerung vorgelegt werden sollen oder nicht, einiges
zu reden. Die zu erwartenden hohen Kosten waren im Kanton Thurgau Anlass für Kritik
am Vorgehen der Regierung. Den Betrag – von den insgesamt rund 9 Mio. CHF hatte der
Kanton der Nordostschweiz 3 Mio. CHF zu stemmen – just so anzusetzen, dass damit
kein obligatorisches Finanzreferendum nötig ist, stiess einigen
Kantonsparlamentmitgliedern sauer auf. Man müsse ein so teures Projekt möglichst
früh von der Stimmbevölkerung legitimieren lassen, sonst seien die Kosten einst so
hoch, dass es nicht mehr gestoppt werden könne - so der Vorwurf. Das Thurgauer
Parlament hiess den Kredit letztlich mit grosser Mehrheit – konkret mit 103 zu 11
Stimmen – gut. Gleichzeitig beschloss der Rat allerdings auch, die Vorlage von sich aus
der Stimmbevölkerung vorzulegen. Eine Minderheit argumentierte vergeblich, dass die
Möglichkeit eines fakultativen Finanzreferendums ja gegeben sei und dass es auch
angesichts der noch nicht vorhandenen Informationen zur Landesausstellung verfrüht
sei, die Bevölkerung entscheiden zu lassen. Mitentscheidend war das vor allem von der
SVP vorgebrachte Argument, dass mit den bisher bereits bewilligten Krediten die
Obergrenze für ein obligatorisches Finanzreferendum von 3 Mio. CHF sowieso bereits
überschritten sei und entsprechend die Verfassung verletzt würde, wenn man das
Begehren der Bevölkerung nicht vorlege. Die grosse Ratsmehrheit sah in der Expo eine
Chance für die Region. Es waren aber auch kritische Stimmen zu vernehmen. Es sei
nicht klar, was die Expo den Kanton letztlich kosten werde und welchen Nutzen sie
bringe. Zudem wurden Bedenken hinsichtlich des Umweltschutzes und der
Nachhaltigkeit laut. Kritisiert wurde auch, dass sich der Kanton Appenzell Innerrhoden
ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.88 - 01.01.18 4nicht an den Kosten beteilige.
Auch im Kanton St. Gallen war der beantragte Kredit umstritten. Obwohl die SVP bereits
im Sommer laut über die Ergreifung eines fakultativen Referendums nachdachte – in St.
Gallen liegt das Kreditlimit für ein obligatorisches Finanzreferendum bei 15 Mio. CHF –
beantragte die Kommission hier keine rasche Volksabstimmung. Die Bevölkerung solle
erst befragt werden, wenn das Vorhaben Expo 2027 konkreter sei. Freilich kündigte die
SVP an, das Ratsreferendum zu beantragen – der rascheste Weg für eine
Volksabstimmung. Vergeblich wurde von den Befürwortern einer Expo, die der
Ostschweiz neue Impulse verleihen werde, davor gewarnt, dass mit einem solchen
Referendum ein Spaltpilz in die Expo gesetzt werde. Man sei weder bereit, fünf
Millionen in den Sand zu setzen, noch die Katze im Sack zu kaufen, argumentierten SVP-
Exponenten, die sich grundsätzlich gegen eine Expo stellten. Die 57 Stimmen für ein
Ratsreferendum – nötig wären 40 – kamen schliesslich auch dank der Unterstützung
der FDP und einigen CVP-Räten zusammen. Die Liberalen wollen mit einem
Volksentscheid ein frühes Bekenntnis der Bevölkerung für eine Landesausstellung. Das
Volk müsse von Anfang an mit dabei sein. Zuvor hatte das Parlament dem Sonderkredit
mit 80 zu 23 (22 SVP, 1 SP) Stimmen bei 10 Enthaltungen (alle SVP) gutgeheissen.
Ende November entschied schliesslich auch der Ausserrhoder Kantonsrat mit 55 zu 7
Stimmen, dass der Halbkanton einen Beitrag an das Planungsbudget für die Expo2027
entrichten will. Über den beschlossenen Kredit von CHF 800'000 wird es keine
Abstimmung geben, da es hier das Instrument eines fakultativen Finanzreferendums
oder eines Ratsreferendums nicht gibt.
Nach wie vor abseits stand der Kanton Appenzell Innerrhoden. Die Regierungsräte der
drei bisherigen Kantone signalisierten aber, dass der sich mitten im geplanten Expo-
Gebiet befindende Halbkanton immer noch auf den fahrenden Zug aufspringen könne. 11
Stimmung in der Bevölkerung
GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE Interessante kantonale Unterschiede hinsichtlich des Vertrauens in die Judikative
DATUM: 16.03.2014
MARC BÜHLMANN
lieferte eine Mitte März publizierte Nationalfondsstudie, in der rund 100 Personen pro
Kanton nach ihrer Meinung zu den kantonalen Gerichten befragt wurden. Nicht nur die
Beurteilung von Unabhängigkeit und Fairness durch die Gerichte, sondern auch das
Vertrauen in die Richterinnen und Richter variieren stark zwischen den Kantonen. Es
sind dabei die Kantone Wallis, Jura, Neuenburg, Genf, Obwalden und Schwyz, die durch
schlechte Beurteilung auffallen, während die beiden Appenzell und Basel-Stadt die
Rangliste anführen. Die Studie machte neben dem Wahlmodus der Richterinnen und
Richter hauptsächlich die Anzahl Laienrichterinnen und -richter, aber auch Justiz-
Affären für die Unterschiede verantwortlich. 12
Rechtsordnung
Bürgerrecht
PARLAMENTARISCHE INITIATIVE Mit 60,4 Prozent Ja- gegenüber 39,6 Prozent Nein-Stimmen nahm das Schweizer
DATUM: 12.02.2017
KARIN FRICK
Stimmvolk am 12. Februar 2017 die erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten
Ausländergeneration deutlich an. Die Stimmbeteiligung lag schweizweit bei 46,8
Prozent und schwankte zwischen 39 Prozent im Kanton Uri und rund 66 Prozent in
Schaffhausen. Eher überraschend war das ebenfalls deutliche Ständemehr: 17 von 23
Ständen stimmten der Vorlage zu. Die auf frühere Abstimmungsergebnisse zur
erleichterten Einbürgerung zurückgehenden Befürchtungen der Befürworter, am
Ständemehr zu scheitern, wurden damit klar widerlegt. In den im Vorfeld des
Urnengangs noch als „Swing States“ bezeichneten Kantonen resultierte überall ein Ja.
Verglichen mit der Abstimmung von 1994, als das Anliegen am Ständemehr gescheitert
war, wechselten somit die acht Kantone Luzern, Nidwalden, Solothurn, Aargau,
Schaffhausen, Appenzell-Ausserrhoden, Tessin und Wallis auf die Befürworterseite,
wobei es in Nidwalden, Appenzell-Ausserrhoden und Tessin ein enges Rennen war (NW
50,4%, AR 50,9%, TI 50,2% Ja-Stimmen). Die knappste Entscheidung überhaupt fiel im
Kanton Thurgau, wo lediglich 24 Stimmen für die ablehnende Standesstimme
ausschlaggebend waren. Ein ebenfalls hauchdünnes Nein resultierte in Glarus und St.
Gallen mit Nein-Stimmenanteilen von 50,4 Prozent bzw. 50,2 Prozent. Demgegenüber
stiess die Vorlage in sämtlichen Westschweizer Kantonen auf überdurchschnittlich
hohe Zustimmung. Am deutlichsten stimmte der in Ausländerfragen ohnehin sehr offen
ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.88 - 01.01.18 5eingestellte Kanton Neuenburg mit einem Ja-Stimmenanteil von 75,1 Prozent zu. Die
höchste Ablehnung hingegen erfuhr die Vorlage in Appenzell-Innerrhoden, dessen
Stimmbevölkerung zu 56,4 Prozent ein Nein einlegte. Augenfällig ist bei den
Ergebnissen zudem das Gefälle zwischen Stadt und Land; so stimmte die Stadt Zürich
zu 76 Prozent Ja (Kanton ZH: 63,2%) und die Stadt St. Gallen zu 65 Prozent (Kanton SG:
49,8%).
Bundesrätin Simonetta Sommaruga liess nach dem Urnengang verlauten, die Regierung
nehme das Ergebnis „mit grosser Genugtuung“ zur Kenntnis und es stimme
zuversichtlich „für weitere, ebenso umstrittene Vorlagen“. Darüber hinaus ermunterte
sie junge Ausländerinnen und Ausländer der dritten Generation, nun „die Chance zu
nutzen und ihre Heimat mitzugestalten“, und fügte an, die Erleichterung der
Einbürgerung sollte voraussichtlich spätestens in einem Jahr in Kraft treten. Freude
über den Entscheid herrschte auch beim SGB und bei der Operation Libero. Während
Ersterer von einer überfälligen Reform sprach und ankündigte, nun auch die
Anforderungen für andere Einbürgerungswillige senken zu wollen, sah Letztere in dieser
Abstimmung einen „ersten, wichtigen Schritt zu einem liberalen Bürgerrecht“. Daran
müsse man jetzt anknüpfen und beispielsweise auch die erforderliche Aufenthaltsdauer
senken oder die Mindestwohnsitzfristen in den Gemeinden abschaffen. Wenig erfreut
zeigte sich die SVP, die nach der Durchsetzungsinitiative und dem Asylgesetz mit dieser
Abstimmung die dritte Niederlage in der Ausländerpolitik innerhalb eines Jahres
hinnehmen musste. Als Kopf des Gegenkomitees und Initiator der umstrittenen Plakate
machte Andreas Glarner (svp, AG) besonders die bereits Eingebürgerten für das
Resultat verantwortlich und forderte die Abschaffung des Doppelbürgerrechts. Die SVP
erklärte aber auch, das Verdikt von Volk und Ständen zu akzeptieren und die noch
offenstehende Möglichkeit, das Referendum gegen die in dieser Sache beschlossene
Gesetzesänderung zu ergreifen, nicht wahrnehmen zu wollen.
Abstimmung vom 12. Februar 2017
Beteiligung: 46,84%
Ja: 1'499'627 (60,4%) / Stände: 15 4/2
Nein: 982'844 (39,6%) / Stände: 5 2/2
Parolen:
– Ja: SP, FDP (1*), CVP (1*), Grüne, GLP, BDP (1*), EVP, Städteverband, Eidgenössische
Migrationskommission, SGB, Travail.Suisse
– Nein: SVP, EDU (1*)
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 13
Strafrecht
GERICHTSVERFAHREN Ein in Appenzell Ausserrhoden zu einer Busse von 100 Franken verurteilter
DATUM: 18.11.2011
NADJA ACKERMANN
Nacktwanderer wurde mit seiner Beschwerde beim Bundesgericht abgewiesen. Dieses
besagte in seinem Urteil, dass Freikörperkultur auf Wanderungen in der Schweiz von
den Kantonen eigenständig geregelt werden dürfe. In Appenzell Innerrhoden zieht
Nacktwandern künftig eine Busse nach sich. 14
Stimm- und Wahlrecht
KANTONALE POLITIK Nachdem 1972, 1976, 1979 und 1984 entsprechende Anläufe gescheitert waren, stimmte
DATUM: 30.04.1989
HANS HIRTER
am 30. April die Landsgemeinde von Appenzell-Ausserrhoden der Einführung des
kantonalen Stimm- und Wahlrechts für Frauen mit knapper Mehrheit zu. Dieser
Beschluss bewog die Regierung von Appenzell-Innerrhoden, die Beseitigung der
politischen Diskriminierung der Frauen auch in dieser letzten Bastion des
Männerstimmrechts vorzuschlagen. Der Grosse Rat stimmte dem Vorschlag ohne
Gegenstimmen zu, der endgültige Entscheid über die Einführung des
Frauenstimmrechts in Appenzell-Innerrhoden wird allerdings an der Landsgemeinde
vom Frühjahr 1990 zu fällen sein. 15
ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.88 - 01.01.18 6KANTONALE POLITIK Die Männer Appenzell-Innerrhodens lehnten an der Landsgemeinde vom 29. April die
DATUM: 29.04.1990
HANS HIRTER
von Regierung und Parlament empfohlene Einführungdes kantonalen Frauenstimm-
und wahlrechts nach 1973 und 1982 zum dritten Mal deutlich ab. Als Reaktion darauf
erhoben Appenzeller Bürgerinnen und Bürger beim Bundesgericht staatsrechtliche
Beschwerde. Im weitern reichten sie eine Volksinitiative für die politische
Gleichberechtigung ein; die Regierung kündigte im Herbst an, dass sie das Begehren
mit einer zustimmenden Empfehlung an der Landsgemeinde vom nächsten Frühjahr zur
Abstimmung bringen werde. 16
GERICHTSVERFAHREN Das Bundesgericht befasste sich am 27. November mit den Beschwerden und kam
DATUM: 27.11.1990
HANS HIRTER
einstimmig zum Entscheid, dass der Kanton Appenzell-Innerrhoden den Frauen ab
sofort das vollumfängliche aktive und passive Stimm- und Wahlrecht zugestehen
muss. Das Richterkollegium begründete sein Urteil mit dem Gleichberechtigungsartikel
der Bundesverfassung (Art. 4.2 BV). Dieser sei direkt anwendbar und den Bestimmungen
von Art. 74.4 BV über die kantonale Regelung des Wahlrechts übergeordnet. 17
MOTION Der negative Entscheid der Landsgemeinde führte auch zu parlamentarischen
DATUM: 14.12.1990
HANS HIRTER
Vorstössen auf Bundesebene. Mit Motionen forderten die Fraktionen der CVP und der
GP sowie die Freisinnige Nabholz (ZH) Verfassungsänderungen, welche die politische
Gleichberechtigung auch für die Kantone zwingend vorschreiben. Der Bundesrat
beantragte anfangs Oktober, die Motionen bloss in Postulatsform zu überweisen, da
nach dem Bundesgerichtsurteil über die erwähnten staatsrechtlichen Beschwerden auf
eine aufwendige Verfassungsänderung eventuell verzichtet werden könne. Falls das
Urteil negativ ausfalle und auch die Landsgemeinde die Einführung des kantonalen
Frauenstimmrechts 1991 nochmals ablehne, werde er unverzüglich die geforderte
Verfassungsrevision einleiten. 18
ANDERES Der positive Ausgang dieser Abstimmung liess auch die Zahl der Kantone, welche das
DATUM: 09.12.1991
HANS HIRTER
Stimmrechtsalter in kantonalen Belangen noch nicht gesenkt haben, rasch
schrumpfen. Ende Jahr verblieben in dieser Gruppe nur noch St. Gallen und Appenzell-
Innerrhoden, wo entsprechende Vorlagen 1992 dem Volk vorgelegt werden sollen. 19
Öffentliche Ordnung
INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT Die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) verabschiedete am
DATUM: 02.02.2012
NADJA ACKERMANN
2. Februar 2012 das verschärfte Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich
von Sportveranstaltungen, kurz Hooligan-Konkordat. Dieses sieht neu u.a. eine
Verlängerung des Rayonverbots von einem auf ein bis drei Jahre und verschärfte
Meldeauflagen vor. Personenkontrollen sollen von der Polizei und nur bei konkretem
Verdacht durchgeführt werden können. Privaten Sicherheitsfirmen kann das Abtasten
nach verbotenen Gegenständen über den Kleidern erlaubt werden. Neu ist zudem, dass
die Behörden eine Bewilligungspflicht für Eishockey- und Fussballspiele der Männer der
obersten Liga einführen können. Diese Bewilligung kann mit Auflagen an die privaten
Veranstalter, etwa betreffend die Anreise der auswärtigen Fans, verbunden werden.
Eine Koordinationsgruppe verabschiedete am 16. November 2012 ein Muster einer
Rahmenbewilligung, um eine einheitliche Umsetzung der Bewilligungspflicht zu
erreichen. Einige Punkte dieser Rahmenbewilligung gaben Anlass zur Diskussion. So
etwa, dass bei Hochrisikospielen im und um das Stadion ein Alkoholverbot gelten und
durch elektronische Zutrittskontrollen ein Abgleich der ID mit der Hooligan-Datenbank
Hoogan gemacht werden sollen. Ende 2012 hatten bereits die Kantone St. Gallen,
Aargau, Zug, Neuenburg, Appenzell Innerroden, Uri, Zürich und Luzern das Konkordat
ratifiziert und in Appenzell Innerroden und St. Gallen ist es bereits in Kraft getreten. 20
ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.88 - 01.01.18 7Institutionen und Volksrechte
Organisation der Bundesrechtspflege
BUNDESRATSGESCHÄFT Gegen Jahresende beantragte der Bundesrat dem Parlament die Schaffung eines
DATUM: 07.12.2007
HANS HIRTER
eidgenössischen Patentgerichtes. Dieses würde anstelle der kantonalen Gerichte
erstinstanzlich über alle patentrechtlichen Streitigkeiten entscheiden. Rekursinstanz
bliebe das Bundesgericht. Der Bundesrat begründete die angestrebte Zentralisierung
mit den sehr hohen und infolge des technologischen Fortschritts noch weiter
ansteigenden fachlichen Anforderungen an die Richter und Richterinnen in diesem
Bereich. Die kantonalen Gerichte seien, auch wegen der in vielen Kantonen sehr
geringen Zahl von zu beurteilenden Fällen, nicht mehr in der Lage, die nötigen
juristischen und vor allem technischen Kenntnisse zu erwerben und auf dem neuesten
Stand zu halten. In der Vernehmlassung war diese Neuerung auch von fast allen
Kantonen und von den interessierten Berufsorganisationen begrüsst worden. Einzig
Appenzell-Innerrhoden sprach sich aus föderalistischen Gründen dagegen aus. 21
Föderativer Aufbau
Beziehungen zwischen Bund und Kantonen
BUNDESRATSGESCHÄFT In aller Regel wirft die Gewährleistung der kantonalen Verfassungsänderungen nach
DATUM: 11.03.2015
MARC BÜHLMANN
Abstimmungen durch das nationale Parlament keine hohen Wellen. Aufgrund
umstrittener Volksentscheide in den Kantonen Bern und Tessin herrschte aber in der
Frühlingsession insbesondere im Nationalrat grosser Diskussionsbedarf. Im Kanton Bern
hatte im November 2013 eine Initiative der jungen SVP, die ein Verbot von
Einbürgerungen für Kriminelle, Sozialhilfeempfänger und Personen ohne
Aufenthaltsbewilligung forderte, überraschend eine Mehrheit erhalten.
Im Kanton Tessin war im September 2013 ein kantonales Vermummungsverbot
gutgeheissen worden, das Burka- und Niqabträgerinnen als Zielgruppe anvisierte. Der
Bundesrat hatte in seiner Botschaft in beiden Fällen eine Gewährleistung empfohlen.
Eine links-grüne Minderheit der SPK-NR argumentierte jedoch, dass die Verweigerung
der Einbürgerung von Sozialhilfeempfängern eine Diskriminierung darstelle und ein
generelles Verhüllungsverbot der Religionsfreiheit widerspreche und
unverhältnismässig sei. In der Debatte erinnerte Bundesrätin Simonetta Sommaruga
daran, dass die Aufgabe des eidgenössischen Parlaments lediglich sei, zu beruteilen, ob
eine kantonale Verfassung bundesrechtskonform umgesetzt werden könne – und nicht,
ob man mit der Änderung einverstanden sei oder diese gut finde. Der Bundesrat sei
sowohl im Falle des Kantons Tessin als auch des Kantons Bern zum Schluss gekommen,
dass eine sorgfältige Umsetzung der von der Mehrheit der kantonalen Bevölkerung
angenommenen Verfassungsänderungen durchaus im Sinne des Bundesrechts möglich
sei. Aus diesem Grund seien die kantonalen Verfassungen zu gewährleisten. Die beiden
Minderheitenanträge wurden in der Folge mit 131 zu 42 Stimmen (bei 13 Enthaltungen)
im Falle des Kantons Bern bzw. mit 117 zu 56 Stimmen (bei 12 Enthaltungen) im Falle des
Kantons Tessin abgelehnt und alle Verfassungen gewährleistet.
Im Ständerat stand – neben den Verfassungsänderungen in den Kantonen Bern und
Tessin – noch eine weitere kantonale Änderung im Fokus. Bei der Abstimmung vom
November 2013 über die Aufnahme eines Verfahrens für eine Zusammenarbeit
zwischen dem Kanton Jura und Gemeinden aus dem Berner Jura wurde im Kanton Jura
ein neuer Verfassungsartikel angenommen, mit dem die Aufnahme eines
Fusionsprozesses angestossen werden soll. Weil aber die Stimmbevölkerung im Berner
Jura zeitgleich ein solches Verfahren ablehnte, wäre der Artikel in der jurassischen
Verfassung eigentlich hinfällig. Die Frage war nun, ob ein solcher hinfälliger Artikel
gewährleistet werden soll. Bundesrätin Simonetta Sommaruga legte in der
ständerätlichen Beratung dar, dass die Gewährleistung formaljuristisch nicht daran
gebunden sei, ob ein Artikel umgesetzt werde oder nicht, sondern lediglich bedeute,
dass eine Änderung mit der Bundesverfassung konform sei. Die Tatsache, dass die
Regierung des Kantons Jura in einem Schreiben signalisiert habe, dass dieser Artikel
nicht zur Anwendung kommen werde, stehe einer Gewährleistung nicht im Wege.
Anders als im Jahr 1977, als ein ähnlicher Artikel nicht gewährleistet worden war, gehe
es im zur Diskussion stehenden Artikel ja nicht um die Idee, Berner Gebiete in das
Gebiet des Kantons Jura einzubinden, sondern eben lediglich um den Anstoss eines
Prozesses. Die Regierung des Kantons Jura habe deutlich signalisiert – unter anderem
auch mit der Sistierung des jährlichen Berichts über die Wiederherstellung des Juras an
das jurassische Parlament –, dass es den neuen Artikel als gegenstandslos betrachte
und keine Ansprüche daraus ableite. Eine Nicht-Gewährleistung dieses Artikels, so
ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.88 - 01.01.18 8Sommaruga weiter, käme einer Negierung des jurassischen Volkswillens gleich, für die
es keine rechtliche Begründung gäbe. Auch im Ständerat wurden in der Folge alle
Kantonsverfassungen gewährleistet. Keinen Anlass zu Diskussionen hatten die
Verfassungsänderungen in den Kantonen Uri, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft,
Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und Waadt gegeben. 22
BUNDESRATSGESCHÄFT Nachdem kantonale Verfassungsänderungen aufgrund umstrittener angenommener
DATUM: 03.03.2016
MARC BÜHLMANN
Initiativen in den Kantonen Tessin und Bern im Vorjahr noch zu einigen Debatten
geführt hatten, entsprach das jährlich wiederkehrende Geschäft in der
Frühjahrssession 2016 in beiden Kammern wieder dem Courant normal. Keine der
Änderungen in den Kantonsverfassungen von Luzern, Schwyz, Glarus, Solothurn, Basel-
Stadt oder Appenzell Innerrhoden gaben Anlass zu Beanstandungen. Beide Räte
gewährleisteten die neuen Verfassungen diskussionslos. 23
Wahlen
Wahlen in kantonale Parlamente
WAHLEN Zu den alljährlich an der Landsgemeinde stattfindenden Erneuerungswahlen des
DATUM: 29.05.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT
Parlaments lassen sich keine Zahlen zur parteipolitischen Zusammensetzung angeben,
wie in Ausserrhoden treten auch hier nicht verschiedene Parteien gegeneinander an.
Da es in Appenzell-Innerrhoden neben der CVP keine anderen Parteien gibt, darf
angenommen werden, dass auch die grosse Mehrheit der Parlamentarier dieser Partei
zumindest nahesteht. Auf die Einführung des kantonalen Frauenstimm und -wahlrechts
wird an anderer Stelle eingegangen. 24
WAHLEN Bei den alljährlich eine Woche nach der Innerrhoder Landsgemeinde stattfindenden
DATUM: 05.05.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT
Erneuerungswahlen des Parlaments wurde – nachdem 1990 das Frauenstimm- und
Wahlrecht eingeführt worden war – erstmals eine Frau ins 61köpfige Parlament
gewählt. Da es im Innerrhoder Parlament keine Fraktionen gibt können nur ungefähre
Angaben zur parteipolitischen Zusammensetzung des Parlaments gemacht werden. Die
grosse Mehrheit der Parlamentsmitglieder gehört der CVP an oder steht ihr zumindest
nahe. 25
WAHLEN Bei der alljährlich eine Woche nach der Innerrhoder Landsgemeinde stattfindenden
DATUM: 02.05.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT
Erneuerungswahl des Innerrhoder Parlaments, in welchem neben der CVP offiziell keine
anderen Parteien existieren, wurden vier Frauen neu in den 65köpfigen Rat gewählt,
womit deren Vertretung auf sieben anstieg. 26
WAHLEN Der Innerhoder Grosse Rat kennt noch immer keine Fraktionen, weshalb die
DATUM: 13.06.1999
DANIEL BRÄNDLI
Parteienzugehörigkeit nicht offiziell bekanntgegeben wird. Im kleinsten Kanton der
Schweiz werden die Kandidierenden traditionsgemäss von Vereinigungen und
Interessengruppen portiert. Erstmals versuchte nun die neu gegründete SVP mit einem
parteipolitischen Wahlkampf Einsitz in den Rat zu nehmen. Die Bezirksversammlungen
in Appenzell und Rüte, die immer noch unter freiem Himmel abgehalten werden,
goutierten den Vorstoss der SVP offenbar nicht. Der Grossrat blieb in festen Händen
der CVP-nahen Kräfte. Weil in Oberegg als einzigem Bezirk an der Urne gewählt worden
ist, war hier im Juni ein zweiter Wahlgang notwendig. Die Frauen konnten ihre
bisherigen neun Sitze im 46köpfigen Rat halten. 27
WAHLEN Die Grösse des Innerrhoder Parlaments hängt von der Bevölkerungszahl ab. Im
DATUM: 04.05.2003
ROMAIN CLIVAZ
Berichtsjahr wurde die Anzahl Sitze aufgrund der Ergebnisse der Volkszählung 2000 von
46 auf 49 erhöht. Der Grosse Rat kennt immer noch keine Fraktionen; deshalb ist es
schwierig, zuverlässige Angaben über die parteipolitische Zusammensetzung zu
machen. Die Kandidierenden werden traditionsgemäss von Vereinigungen und
Interessengruppen portiert. Bei den diesjährigen Wahlen kandidierten mehr Personen
als 1999. Gemäss NZZ konnten die Gewerbler ihre starke Stellung behaupten und
verfügen über gut die Hälfte der 49 Sitze. Der Frauenanteil sank auf 16,3% (1999:
19,6%). 28
ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.88 - 01.01.18 9WAHLEN Das Parlament des Kantons Appenzell Innerrhoden, der Grosse Rat, hat 49 Mitglieder.
DATUM: 29.04.2007
SABINE HOHL
Es gibt keine Fraktionen, die Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind deshalb zwar
verschiedenen Interessengruppen, etwa dem Gewerbe oder den Bauern, nicht aber
Parteien zuzuordnen. Eine Aussage darüber, welche Kräfte bei den Wahlen im April
gestärkt wurden, ist deshalb schwierig. Der sehr tiefe Frauenanteil im Parlament des
Kantons Appenzell Innerrhoden stieg bei den Wahlen leicht an, von 16,3% auf 20,4%,
die Frauen halten damit neu 10 von 49 Sitzen.
WAHLEN In sieben Kantonen (AI, AR, BL, FR, LU, TI und ZH) wurden die Wählerinnen und Wähler
DATUM: 01.01.2011
MARC BÜHLMANN
nicht nur zur Wahl der nationalen, sondern auch der kantonalen Repräsentanten
aufgerufen. Die im Frühjahr durchgeführten kantonalen Wahlen wurden dabei als
wichtige Gradmesser und Testläufe im Hinblick auf die nationalen Wahlen betrachtet.
Nur im Kanton Freiburg fanden die Wahlen nach den Nationalrats- und
Ständeratswahlen statt. Rückblickend erwiesen sich die kantonalen Wahlen allerdings
nur bedingt als Prognoseinstrumente für die nationalen Wahlen, zu stark sind die
kantonalen Eigenheiten. So kündigte sich zwar der herbstliche Vormarsch der neuen
Mitte bereits in den Kantonen an, aber eben nur in jenen Kantonen, in denen GLP und
BDP überhaupt antraten (BL, FR, LU, ZH). Anders als auf nationaler Ebene konnten die
SVP und die Grünen in einigen Kantonen zudem Gewinne verzeichnen. Deutlich waren
hingegen in fast allen Kantonen die Verluste der alten Mitteparteien FDP und CVP.
Kantonale Besonderheiten zeigten sich besonders deutlich im Tessin, wo ein veritabler
Rechtsrutsch zu verzeichnen war. Freilich feierte die Lega nicht nur kantonale Erfolge,
sondern konnte auch bei den nationalen Wahlen einen zusätzlichen Sitz gewinnen.
Die insgesamt erfolgreichste Partei bei den kantonalen Parlamentswahlen in den sieben
Kantonen war die GLP mit total 20 gewonnenen Mandaten. In denjenigen Kantonen, in
denen sie neu antrat (BL, FR, LU), konnte sie insgesamt elf Sitze besetzen und in Zürich,
in dem Kanton also, in dem sie vor vier Jahren zum ersten Mal überhaupt aufgetreten
war, schaffte sie fast eine Verdoppelung ihrer Sitze von 10 auf 19. Auch die zweite Partei
der neuen Mitte, die BDP, war unerwartet erfolgreich. Sie war in den Kantonen Basel
Landschaft, Freiburg, Luzern und Zürich zum ersten Mal angetreten und konnte in drei
Kantonen insgesamt zwölf Sitze für sich beanspruchen. Einzig in Luzern ging sie leer
aus. Der Antritt der BDP schadete der SVP, von der sie sich abgespaltet hatte, wider
Erwarten nicht. Im Gegenteil, die SVP konnte insgesamt ebenfalls zwölf neue Mandate
verbuchen. Einzig in Zürich verlor sie zwei ihrer 56 Sitze, blieb aber dennoch mit
Abstand stärkste Partei. Die nationalen Verluste der Volkspartei zeichneten sich in den
kantonalen Wahlen also nur sehr bedingt ab. Die kantonalen Gewinne und Verluste der
SP hielten sich in etwa die Waage. Die Sozialdemokraten konnten in den Kantonen
Appenzell Ausserrhoden, Freiburg und Luzern insgesamt acht Sitze zulegen, mussten
aber gleichzeitig in den Kantonen Basel Landschaft (-1), Tessin (-4) und Zürich (-1)
Sitzverluste in Kauf nehmen. Grosse Verluste in allen Kantonen (mit Ausnahme von AI)
mussten die CVP und die FDP hinnehmen. Gleich in drei Kantonen (BL, LU und ZH)
musste der Freisinn jeweils sechs Mandate abgeben. Zudem verlor die FDP je zwei Sitze
in Appenzell Ausserrhoden und im Kanton Freiburg. Im Tessin blieb sie mit vier
Sitzverlusten nur noch sehr knapp die stärkste Partei im kantonalen Parlament.
Insgesamt büsste die FDP im Berichtjahr also nicht weniger als 26 kantonale
Legislativmandate ein. Die CVP musste in den sechs Kantonsparlamenten (ohne AI)
insgesamt 22 Sitzverluste verkraften. Darunter fanden sich herbe Verluste in ihren
Stammlanden Luzern (-7 Sitze) und Freiburg (-6 Sitze). In beiden Kantonen blieben die
Christdemokraten allerdings stärkste Fraktion. Die Grünen konnten hingegen Erfolge
feiern. Während die GP in den Kantonen Zürich, Luzern und Freiburg zwar ihre
Wähleranteile, nicht aber ihre Sitzanteile ausbauen konnte, eroberte sie im Kanton
Basel-Landschaft einen und im Tessin gleich drei neue Mandate. Vielerorts wurden die
Erfolge der Grünen und der GLP mit einem Fukushima-Effekt, also mit der Sensibilität
der Wählerschaft für umwelt- und energiepolitische Fragen nach der Atom-Katastrophe
in Japan erklärt. Der grosse Erfolg der Grünen in den Kantonen – auch bei den
Regierungswahlen konnte die GP gleich in drei Regierungen einziehen (siehe unten) –
fand jedoch auf nationaler Ebene keine Entsprechung.
Bei den kleineren Parteien hielt die Niederlagenserie der Schweizer Demokraten weiter
an. Die SD verloren ihren Sitz in Basel und sind jetzt schweizweit nur noch im Kanton
Aargau in einer kantonalen Legislative vertreten. Die EDU konnte ihre fünf Sitze in
Zürich halten und half im Tessin auf einer Mischliste mit, die fünf Sitze der SVP zu
verteidigen. In den Kantonen Basel-Landschaft und Freiburg war die Union allerdings
nicht mehr angetreten. Die EVP musste insgesamt fünf Mandate abgeben. In Zürich
verlor sie drei Sitze (neu: 7) und in Appenzell Ausserrhoden und in Freiburg jeweils
ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.88 - 01.01.18 10einen Sitz. Im Kanton Freiburg war sie damit nicht mehr im Parlament vertreten. Im
Kanton Basel-Landschaft konnte sie ihre vier Mandate knapp verteidigen. Einen
Grosserfolg feierte die Lega im Kanton Tessin. Sie gewann sechs Sitze und war mit 21
Mandaten neu zweitstärkste Fraktion im Parlament des Südschweizer Kantons.
Überraschend zog im Tessin zudem die kommunistische Partei zusammen mit dem
„Movimento per il Socialismo“ mit einem Sitz ins Parlament ein. Die CSP konnte ihre vier
Sitze im Kanton Freiburg halten. Im Kantonsparlament von Zürich konnte die Alternative
Liste ihre Sitzzahl auf drei ausbauen (+1 Sitz). Ein Unabhängiger sass im Parlament im
Kanton Freiburg und 22 Unabhängige hatten Sitze in der Legislative des Kantons
Appenzell Ausserrhoden inne.
In drei der fünf Kantone, welche die Wahlbeteiligung ausweisen (nicht in AI und AR),
war diese im Vergleich zu den letzten Gesamterneuerungswahlen zurückgegangen. Im
Kanton Basel-Landschaft betrug der Rückgang 1,9 Prozentpunkte. Nur noch 35,1% der
Baselbieter Bevölkerung beteiligte sich an den Landratswahlen. Etwas höher (38,2%)
war dieser Anteil in Zürich, wo die Wahlbeteiligung im Vergleich zu 2007 (35,9%) leicht
angestiegen war. Leicht zurückgegangen war die Beteiligung hingegen auch im Kanton
Luzern und zwar von 44,8% (2007) auf 43,5% (2011). Fast genauso hoch war die
Wahlbeteiligung im Kanton Freiburg (43,4%). Hier hatte sie im Vergleich zu 2006
allerdings um 2,7 Prozentpunkte zugenommen. Über die Hälfte der Tessiner
Bevölkerung machte von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Die 58,5% bedeuteten aber auch
in der Südschweiz im Vergleich zu den letzten Gesamterneuerungswahlen (62,1%) einen
Rückgang.
Auf die insgesamt 704 Sitze, die in den sieben Kantonsparlamenten zu vergeben waren,
wurden insgesamt 186 Frauen gewählt (26,4%). In drei Kantonen hatte der Frauenanteil
abgenommen. Im Kanton Freiburg verloren die Frauen drei Sitze. Der Anteil an Frauen
in der Freiburger Legislative betrug damit noch 20,9%. Je einen Sitz mussten die
Frauen im Kanton Appenzell Ausserrhoden und im Tessin abgeben. Während die
Appenzellerinnen noch mit 14 Kantonsparlamentarierinnen vertreten sind (21,5%),
waren die Tessinerinnen lediglich noch von neun Frauen repräsentiert (13,3%).
Verbessert hat sich die Frauenrepräsentation hingegen in den anderen vier Kantonen,
welche 2011 kantonale Wahlen abhielten. Rund ein Drittel Frauen sitzen in den
Kantonsparlamenten von Zürich (33,3%; +2 Sitze) und Basel-Landschaft (35,6%, +1 Sitz).
Gleich um sieben Sitze zulegen konnten die Frauen im Kanton Luzern, wo ihr
Repräsentationsgrad von 25% auf 30,8% anstieg. Im Kanton Appenzell Innerrhoden
wurde ebenfalls eine zusätzliche Frau ins Parlament gewählt, wo neu elf Abgeordnete
die Appenzellerinnen vertreten (22,5%). Gesamtschweizerisch war Ende 2011 rund ein
Viertel der kantonalen Parlamentssitze mit Frauen besetzt (25,2%). Im Vergleich zu 2010
(24,9%) und im Gegensatz zum nationalen Parlament war dieser Anteil also wieder leicht
angestiegen (die Vergleiche basieren auf den Resultaten der kantonalen Wahlen 2002
bis 2012; später nachgerückte oder zurückgetretene Frauen wurden zur Berechnung
der Frauenanteile nicht berücksichtigt). 29
WAHLEN An der Landsgemeinde, die wegen Ostern nicht am letzten Wochenende im April,
DATUM: 08.05.2011
MARC BÜHLMANN
sondern am 1, Mai des Berichtjahres stattfand, beschloss die Appenzell Innerrhoder
Stimmbevölkerung, die bisher aufgrund der Bevölkerungsgrösse variierende Zahl der
Mitglieder des Grossen Rates auf 50 zu beschränken. Für die Wahlen ins Parlament,
die im gleichen Monat stattfanden, galt allerdings noch die alte Zahl, welche anhand der
Bevölkerungszahl in den Bezirken bestimmt wurde. Pro 300 Einwohner stand den
Bezirken jeweils ein Sitz zu. Für die Wahlen im Mai lag die Zahl – basierend auf der
Volkszählung aus dem Jahr 2000 – bei 49. In fünf der sechs Bezirke fanden am 8. Mai
die Wahlen in so genannten Bezirksgemeinden – also offen – statt, im Bezirk Oberegg
wurde die Wahl als Urnenabstimmung durchgeführt. Insgesamt kam es zu drei
Ersatzwahlen. Eine allfällige Parteizugehörigkeit der einzelnen Parlamentarier wird in
den offiziellen Dokumenten nicht aufgeführt. Parteikräfte oder -verschiebungen sind
deshalb nicht zu eruieren. Die Politik im Kanton Appenzell Innerrhoden spielt sich
zwischen der dominierenden CVP, einer kleinen SVP, einer „Gruppe für Innerrhoden“
und verschiedenen Verbänden ab. Der Frauenanteil im Grossen Rat lag nach den
Wahlen 2011 bei 22,4%. Die Frauen haben im Vergleich zu 2007 einen Sitz gewonnen.
Die Hauptaufgabe der Abgeordneten, die sich an fünf eintägigen ordentlichen
Sessionen pro Jahr treffen, ist die Vorberatung der Verfassungs- und Gesetzesvorlagen,
die an der Landsgemeinde beraten werden. Der Grosse Rat hat zudem eine
Kontrollfunktion, bewilligt die Jahresrechnung und legt das Budget fest. 30
ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.88 - 01.01.18 11Sie können auch lesen