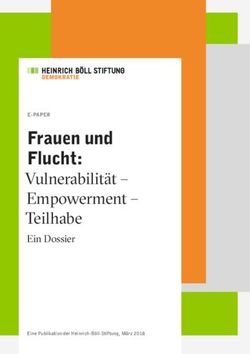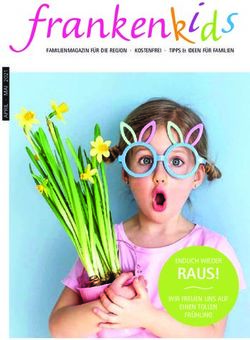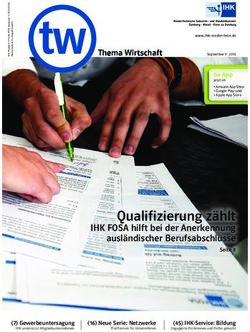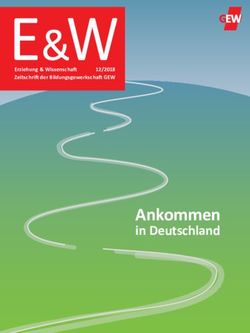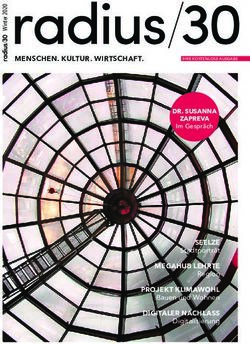Heft 20 / 2021 - Auenzentrum Neuburg-Ingolstadt
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Heft 20 / 2021 Auenmagazin Magazin des Auenzentrums Neuburg a. d. Donau In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Umwelt
INHALT
INHALT
Perspektiven
Gewässerentwicklungsflächen. .................................................................................................................................... 4
Christoph Linnenweber, Uwe Koenzen, Joachim Steinrücke
Berichte und Projekte
Zustand der Flussauen in Deutschland 2021...........................................................................................................10
Janika Heyden, Bernd Neukirchen, Thomas Ehlert
Erfolgskontrolle der Wiederherstellung des Biotopverbunds
am Rhein mithilfe von Fernerkundungsdaten..........................................................................................................15
Nikola Schulte-Kellinghaus
Biozönotische Auenzustandsbewertung zur Erfolgskontrolle...........................................................................20
Kathrin Januschke et al.
„Alpenflusslandschaften – Vielfalt leben von Ammersee bis Zugspitze“...........................................................29
Wolfgang Hug
Im Gespräch
Wildnisgebiete für die Flussauen in Bayern.............................................................................................................36
Siegfried Geißler
Auenbewohner
Störarten in der Donau.................................................................................................................................................42
Jakob Neuburg, Thomas Friedrich, Jutta Jahrl, Beate Striebel-Greiter
Fischökologische Hotspots in der Kulturlandschafts-Katakombe......................................................................46
Johannes Schnell
Rückblick
Hydromorphologie-IV-Workshop...............................................................................................................................49
Georg Lamberty & Stephan Naumann
Virtueller Stakeholder Workshop des Projekts IDES ...........................................................................................51
Tim Borgs, Marion Gelhaus & Barbara Stammel
„Biozönotische Auenzustandsbewertung“ – Digitaler Workshop.......................................................................54
Kathrin Januschke, Stefan Brunzel, Daniel Hering, Andrea Rumm, Mathias Scholz, Barbara Stammel
Z ehnter A uenökologischer W orkshop auf der digitalen Burg Lenzen/Elbe..............................................56
Mathias Scholz, Kristin Ludewig, Sonja Biwer, Maria Lindow & Meike Kleinwächter
Aus der Forschung
Auswirkungen der Erlen-Phytophthora (Phytophthora alni)..............................................................................58
Alexandra Bierer, Tamara Sánchez Corcobado, Gregory Egger
Informationen der Redaktion Die zwanzigste Ausgabe des Auenmagazins.....................................................60
Leserstimmen Leserstimmen...............................................................................................................................................62
Termine, Veranstaltungen und Veröffentlichungen Neuerscheinung: „Flüsse der Alpen“..................65
Beiträge, die nicht ausdrücklich als Stellungnahme des Herausgebers gekennzeichnet sind, stellen die persönliche Meinung der Verfasser / innen
dar. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, die Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie für die Beachtung
privater Rechte Dritter. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht in jedem Fall die Meinung der Redaktion wieder; aus der Veröffentli-
chung ist keinerlei Bewertung durch die Redaktion ableitbar!
2 Auenmagazin 20 / 2021VORWORT
Liebe Leserinnen und Leser,
es freut uns, Ihnen die neue Ausgabe des Auenmagazins präsentieren zu können. Die ak-
tuelle Ausgabe Nr. 20 bietet spannenden Lesestoff rund um das Thema Auen.
Passend zu dieser „Jubiläumsausgabe“ berichten die Kollegen des Bundesamtes für Natur-
schutz (BfN) um Janika Heyden in ihrem Übersichtsbeitrag über die Ergebnisse des neuen
Auenzustandsberichts und die neue Software-Anwendung, mit der Akteure künftig ei-
genständige Auenzustandsbewertungen durchführen können. Für die Entwicklung der
Gewässer mit ihren Auen ist der Raumbedarf eine entscheidende Voraussetzung. Chris-
toph Linnenweber und Uwe Koenzen stellen in der Rubrik „Perspektiven“ das fachplaneri-
sche Instrument des „Gewässerentwicklungskorridors“ dar und erläutern aus erster Hand
die für jeden Gewässertyp naturwissenschaftlich abgeleitete Methodik, die von der Bund/
Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) veröffentlicht wurde.
Die biologische Wirksamkeit von Renaturierungsmaßnahmen ist ein wichtiger Baustein der
Erfolgskontrolle, ein Verfahren zur Bewertung für die Ufer und Auen fehlte jedoch bislang.
Ein BfN-gefördertes Forschungs- und Entwicklungsvorhaben hat nun diese Lücke geschlos-
sen: Kathrin Januschke und das Autorenkollektiv stellen das konkrete, standardisierte Ver-
fahren zur biozönotischen Auenzustandsbewertung vor, das bundesweit anwendbar ist.
Der Beitrag von Nikola Schulte-Kellinghaus von der Internationalen Kommission zum
Schutz des Rheins (IKSR) zeigt auf, wie die Methode flächendeckender Fernerkundungs-
daten bei der Wiederherstellung des Biotopverbunds als Erfolgskontrolle eingesetzt wird.
Des Weiteren stellt Wolfgang Hug die Erfolgsbilanz zum Projektabschluss der Alpenfluss-
landschaften vor. Unter Federführung des WWF Deutschland zusammen mit 18 Partner-
organisationen wurden mehr als 500 Maßnahmen und Aktivitäten durchgeführt. Sein an-
schaulicher und lebendiger Bericht zeigt: gemeinsam an einem Strang ziehen, lohnt sich.
In der Rubrik „Auenbewohner“ befasst sich der Beitrag von Jakob Neuburg und Koautoren
mit der aktuellen Situation der Störarten in der Donau und erläutert, warum der Bestand
dieser eindrucksvollen Langstreckenwanderer besonders bedroht ist und welche Aufgabe
die Task Force im Rahmen der Donauraumstrategie hat.
Auf zwei Beiträge der etwas anderen Art sei noch hingewiesen: drei profunde Kenner*innen
des Wildnisgedankens stellen sich in einem Gespräch den Fragen unseres Redaktionsmit-
glieds Siegfried Geißler und diskutieren gemeinsam, was Wildnisgebiete für die Fluss-
auen bedeuten und wie sie gestärkt werden können. Und Johannes Schnell vom Landes-
fischereiverband hat einen launig-lesenswerten Essay beigesteuert, der sich mit Fischen
und Auen beschäftigt.
Vier Rückblicke von Veranstaltungen (die im Pandemie-Jahr alle als online-Veranstaltungen
stattfinden mussten) und ein kurzer Forschungsbericht aus dem KIT runden die Ausgabe ab.
Zwanzig Ausgaben des Auenmagazins: ein Anlass für die Redaktion, eine (Zwischen-) Bi-
lanz zu ziehen. Lesen sie dazu bitte den Beitrag und den Auszug der Leserstimmen. Sie sind
uns Ansporn und Richtschnur für die Fortführung und kontinuierliche Weiterentwicklung
des Magazins. Dazu ist auch Ihre Meinung gefragt: Bitte nehmen Sie sich für den Frage-
bogen etwa 10 Minuten Zeit und geben Sie uns Ihr Feedback (https://www.auenzentrum-
neuburg-ingolstadt.de/auenforum/auenmagazin/index.html).
Eine Bitte zu guter Letzt:
Bleiben Sie dem Auenmagazin weiter gewogen!
Das Redaktionsteam
Auenmagazin 20 / 2021 3PERSPEKTIVEN
Linnenweber et al. Gewässerentwicklungsflächen 4-9
GEWÄSSERENTWICKLUNGSFLÄCHEN
Christoph Linnenweber, Uwe Koenzen, Joachim Steinrücke
Im Auftrag der Bund-Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) wurde eine bundesweit anwendbare
Methode entwickelt, die den Flächenbedarf der Gewässerentwicklung zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele
physikalisch und gewässertypspezifisch herleitet. Damit liegt nun eine belastbare naturwissenschaftliche
Grundlage für die Verankerung des Flächenbedarfs in raumrelevanten Planungen und letztlich auch für die
Flächenakquise vor. Der nachfolgende Beitrag vermittelt den fachlichen Hintergrund, gibt einen Überblick
zur Methodik und zeigt anhand von Beispielen die Anwendung der Methode auf.
Einleitung
Unsere Fließgewässer wurden über Jahr-
zehnte vorrangig nutzenorientiert begra-
digt, eingeengt und verbaut. Heute ist das
von physikalischen Gesetzmäßigkeiten ge-
prägte gewässertypische Zusammenspiel
von Abflussregime, Morphologie, Sediment-
haushalt und Ausuferungsvermögen weit-
gehend aus dem natürlichen Gleichgewicht
geraten und wird in vielen Fällen nur wie-
der hergestellt werden können, wenn den
Gewässern angemessen Raum für eine na-
türliche, typspezifische Strukturentwick-
lung und Revitalisierung zurückgegeben
wird. Diese Verbesserung der hydromor-
phologischen Verhältnisse ist wesentliche
Voraussetzung zur Erreichung der gesetz-
lich vorgegebenen Bewirtschaftungsziele.
Ohne Flächenverfügbarkeit ist die Umset- Abb. 1: Funktionsfähiger, renaturierter kleiner Bach in der Kulturlandschaft (Holzbach im Kreis Neuwied,
zung entsprechender Maßnahmen in vie- Rheinland-Pfalz). (Foto: LfU-RP)
len Fällen jedoch nicht möglich.
Der vorliegende Artikel erläutert den fach- abhängig von Gewässerlandschaft und Ge- Funktionsfähige Gewässer
lichen Hintergrund des Flächenbedarfs für wässergröße typspezifisch hergeleitet wer- in der Kulturlandschaft
die Gewässerentwicklung und gibt Hin- den. Dafür wurde in den letzten Jahren eine
weise, wie die Fließgewässer zur Erreichung typspezifische und physikalisch fundierte Das Konzept „Raum für Gewässerentwick-
der Bewirtschaftungsziele entwickelt wer- Methodik entwickelt, die im Weiteren er- lung“ verfolgt das Ziel einer Integration
den können. läutert wird. funktionsfähiger Gewässer in die Kultur-
landschaft, so dass sie ihre ökologischen
Dieser Gewässerentwicklungsraum kann Funktionen im Naturhaushalt und im Sinne
Raum für Gewässerentwicklung gleichzeitig auch weiteren wichtigen Zielen der Bewirtschaftungsziele wieder erfüllen
des Allgemeinwohls dienen. Synergieeffekte können. Grundlage zur Ableitung des ge-
Bei der Gewässerbewirtschaftung sind aus können insbesondere beim Hochwasserrück- wässertypspezifischen Raumbedarfs eines
genannten Gründen geeignete planerische halt, beim Niedrigwassermanagement, bei der Fließgewässers ist das fachplanerische In-
und rechtliche Instrumente erforderlich, um Anpassung an den Klimawandel, bei der Re- strument des „Gewässerentwicklungskor-
den Gewässern den erforderlichen Raum für duzierung von Nähr- und Schadstoffeinträ- ridors“.
eine naturnahe Entwicklung zurückzuge- gen, bei der Förderung der Biodiversität sowie
ben. Dieser Raum kann nicht generell de- bei der Nutzung als blau-grüne Infrastruktur
finiert und beziffert werden, sondern muss und als Erholungsraum erzielt werden.
4 Auenmagazin 20 / 2021PERSPEKTIVEN
Linnenweber et al. Gewässerentwicklungsflächen 4-9
Begradigte und eingeengte Gewässer müs- der Gewässerentwicklungsfläche erfüllt eines Dynamikfaktors, die heutige potenzi-
sen fortwährend unterhalten und nach star- bei der Gewässerbewirtschaftung weitere ell natürliche Gewässerentwicklungskorri-
ken Hochwasserereignissen immer wieder Funktionen: dorbreite berechnet werden kann.
repariert werden. Künstliche Einengungen,
Laufverkürzungen oder Verbauungen ste- • Die Gewässerentwicklungsflächen kön- Unter Kenntnis des jeweiligen Gewässertyps
hen der Energie des Hochwassers entge- nen als wasserwirtschaftlicher Planungs- mit seinem spezifischen Formenschatz so-
gen. Sie sind deshalb nicht nachhaltig sta- beitrag auf den verschiedenen Ebenen der wie den örtlichen hydrologischen und to-
bil, verursachen Tiefenerosion und werden Landes- und Regionalplanung, der Bau- pographischen Randbedingungen ist es
ohne kontinuierliche Ausbesserung und Un- leitplanung sowie weiteren Fachplanun- möglich, die Ausdehnung des heutigen po-
terhaltung wieder zerstört. Herkömmlicher gen dienen. tenziell natürlichen Gewässerentwicklungs-
technischer Wasserbau sollte nur dort ein- • Die Gewässerentwicklungsflächen kön- korridors zu berechnen.
gesetzt werden, wo besondere Nutzungen nen als Raumbezug für rechtliche Rege-
oder Infrastruktureinrichtungen, wie bei- lungen sowie für Förderinstrumente von Die Berechnung der heutigen potenziel-
spielsweise Siedlungen, dies zwingend er- EU, Bund, Ländern und kommunalen Ge- len natürlichen Gewässerbreite erfolgt
fordern. bietskörperschaften dienen. mit der empirisch hergeleiteten Fließfor-
mel nach Gauckler-Manning-Strickler, wo-
Diese physikalischen Bedingungen beach- Die zeitliche Inanspruchnahme der Ge- bei nahezu alle benötigten Eingangsdaten
tend, müssen wir den Gewässern angemes- wässerentwicklungsflächen wird durch die zur Berechnung wenn möglich gewässer-
senen Entwicklungsraum bereitstellen, um Entwicklungsdynamik des jeweiligen Fließ- typologisch aus Literaturquellen abgelei-
eine Regeneration der Hydromorphologie gewässers gesteuert und hängt im Wesent- tet wurden. Liegen ortsspezifische Kennt-
und in der Folge einen guten ökologischen lichen von bettbildenden Hochwasserer- nisse vor, können diese vorrangig genutzt
Zustand zu erreichen. eignissen ab. In der Übergangsphase kann werden. Insbesondere das örtliche Talbo-
gegebenenfalls ein Teil der Gewässerent- dengefälle sollte Verwendung finden. Gege-
Mit dem „Gewässerentwicklungskorri- wicklungsfläche weiterhin gewässerver- benenfalls stehen aber auch hier typspezifi-
dor“ wird auf naturwissenschaftlicher träglich genutzt werden. Die Ausgestaltung sche Tabellenwerte zur Verfügung. Bei den
Grundlage der Raumbedarf einer nach- der spezifischen Gewässerentwicklungsflä- hydrologischen Eingangsdaten sollte auf die
haltigen und naturnahen Gewässerent- che erfolgt örtlich im Rahmen entsprechen- heutigen potenziell natürlichen Abflussver-
wicklung zur Erreichung eines guten öko- der Planungsverfahren. hältnisse vor Ort zurückgegriffen werden. In
logischen Zustandes abgeleitet. Folgende Ermangelung bundesweiter hydrologischer
Faktoren sind dabei entscheidend: Referenzbedingungen und Leitbildern der
Das Verfahren zur Ermittlung der heutigen potenziell natürlichen Abflussver-
• Raum für die abflussangepasste Gewässerentwicklungsflächen hältnisse werden vorerst die aktuellen hy-
Gewässerbreite drologischen Abflussverhältnisse herange-
• Raum für die gefälleabhängige Ansatz zogen, die i. d. R. auf Zeitreihen beginnend
Laufentwicklung Zahlreiche empirische Untersuchungen ha- in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
• Raum für typische Vegetation ben sich mit Fließgewässern und der Breite bis heute zurückgehen.
der Gewässerkorridore befasst. Dabei wur-
Diese gewässertypspezifisch physikalisch den die Breite des Gewässerkorridors und Die Berechnungen sind aufgrund der klein-
abgeleiteten „Gewässerentwicklungsflä- weitere Merkmale, wie z. B. Mäanderlänge räumig natürlichen Varianz und des viel-
chen“ sind Grundlage und Instrument ei- und Gewässerbreite, in Bezug zu verschie- fältigen Formenschatzes nicht als exakt im
ner projektspezifischen Flächenbereitstel- denen prägenden Bedingungen wie charak- mathematisch-technischen Sinne, sondern
lung. Sie liefern eine konkrete räumliche teristischen Abflüssen, Gefälleverhältnissen als zu erwartende mittlere Korridorbreiten
Verortung und Quantifizierung des Flächen- oder Talformen gesetzt. In diesen Untersu- zu verstehen.
bedarfs. chungen zeigte sich, dass die Gewässerent-
wicklungskorridorbreite eines Gewässers im Abbildung 2 zeigt die grundsätzliche Vor-
Aufbauend auf ein grundlegendes Projekt Wesentlichen von der heutigen potenziell gehensweise und Herleitung der Gewäs-
des Landes Rheinland-Pfalz wurde seitens natürlichen Gewässerbreite, der Mäander- serentwicklungskorridorbreite im Überblick.
der Bund-Länderarbeitsgemeinschaft Was- länge und dem Windungsgrad eines Gewäs-
ser (LAWA) ein für Deutschland fachlich all- sers abhängt. In einem ersten Schritt werden durch
gemein anerkanntes Verfahren entwickelt, Bildung einer Kombination aus bio-
um die typspezifischen Flächen für einen In den Projekten des Landes Rheinland-Pfalz zönotischem und morphologischem
guten ökologischen Zustand den Gewäs- und der LAWA wurde daher eine Methode Gewässertyp sowie Ermittlung des
sern „anmessen“ zu können. entwickelt und erprobt, bei der aufbau- zugehörigen Lauftyps verschiedene ge-
end auf der heutigen potenziell natürli- wässertypologische Eingangsdaten zur
Dieses physikalisch begründete und nach- chen Gewässerbreite unter Berücksichti- Berechnung ermittelt. Dabei wird auf ei-
vollziehbare Verfahren zur Herleitung gung der Mäanderlänge, der Windung sowie ner ersten Ebene zwischen Gewässerab-
Auenmagazin 20 / 2021 5PERSPEKTIVEN
Linnenweber et al. Gewässerentwicklungsflächen 4-9
schnitten ohne ausgeprägte Talböden,
wie in Kerbtälern und Klammen, sowie Ge-
wässerabschnitten mit Talböden oder ohne
Talbodenbegrenzung unterschieden. Dies
ist darin begründet, dass Gewässer ohne
Talböden natürlicherweise auch wegen
des Talgefälles keine ausgeprägte laterale
Morphodynamik aufweisen. In diesen Fäl-
len wird der zumeist äußerst geringe Win-
dungsgrad mit der heutigen potenziell na-
türlichen Gewässerbreite angesetzt.
Für Gewässer mit Talböden oder ohne Tal-
bodenbegrenzung wird dann in Abhängig-
keit des Lauftyps ein Berechnungsverfahren
angewandt, welches auf die hydromorpho-
logischen Grundlagen der Laufentwicklung
und Laufausprägung zurückgreift. Unter
Berücksichtigung der heutigen potenziell
natürlichen Gewässerbreite und der typ-
spezifischen Windungsgrade werden die
jeweiligen Gewässerentwicklungskorridor- Abb. 2: Schema der Ermittlung der Gewässerentwicklungskorridorbreite in Abhängigkeit von Talform und
breiten hergeleitet. Lauftyp. (Grafik: LAWA 2016)
Vorgehensweise im Überblick Der zweite Hauptteil beschreibt die spe- werden (Abbildung 4). Teilweise parallel
Das Verfahren lässt sich in zwei Hauptteile zifische Anpassung der ermittelten Ge- wurde die Methode 2015/16 in dem Projekt
gliedern (Abbildung 3). Der erste Haupt- wässerentwicklungsfläche aufgrund der der LAWA für die insgesamt in Deutschland
teil beinhaltet die naturwissenschaftlich Vor-Ort-Situation in drei weiteren Arbeits- bedeutenden Gewässertypen erweitert und
ingenieurtechnische Ermittlung der typ- schritten. Zunächst wird der Flächenbedarf im Rahmen eines Praxistestes für die Länder
spezifischen Gewässerentwicklungsfläche für den sehr guten ökologischen Zustand anwendungsreif ausgearbeitet.
über fünf Arbeitsschritte und weitere Teil- bzw. das höchste ökologische Potenzial
arbeitsschritte. (Schritt 6) und der Flächenbedarf für den Die ermittelten natürlichen Gewässerbrei-
guten ökologischen Zustand bzw. das gute ten und Gewässerentwicklungsflächen kön-
Nach der Ermittlung der gewässertypolo- ökologische Potenzial (Schritt 7) abgeleitet. nen als Orientierungswerte bei der Bearbei-
gischen Grundlagen (Schritt 1) erfolgt die Anschließend werden Restriktionsflächen tung von Gewässerentwicklungskonzepten,
Ermittlung der heutigen potenziell natür- ermittelt und berücksichtigt (Schritt 8). Gewässerrückbauprojekten und Gewäs-
lichen Gewässerbreite (Schritt 2) und de- serrenaturierungen dienen. Sie dienen in
ren Plausibilisierung (Schritt 3). Die Ermitt- Rheinland-Pfalz der Bewertung der örtli-
lung der heutigen potenziell natürlichen Beispiele für Anwendungen chen Bedingungen und Restriktionen sowie
Gewässerbreite erfolgt basierend auf hy- des Verfahrens den daraus ableitbaren Entwicklungszielen.
draulischen Kriterien oder wird anhand Zielgruppen sind insbesondere das Personal
von Nomogrammen bestimmt. Sie bildet Ergebnisse in Rheinland-Pfalz der Wasserwirtschaftsverwaltung, der ört-
die Grundlage zur Generierung der Gewäs- Die grundlegende Methodik wurde 2014/15 lichen Maßnahmenträger sowie deren Be-
serkorridorbreite (Schritt 4), die zusammen entsprechend einer Ausschreibung des auftragte. Gewässerentwicklungsmaßnah-
mit dem heutigen potenziell natürlichen Landes Rheinland-Pfalz von den Auftrag- men und Landkauf werden aus Mitteln der
Windungsgrad und einem Dynamikfaktor nehmern „Planungsbüro Koenzen“ und „Aktion Blau Plus“ mit bis zu 90 Prozent der
die Breite des heutigen potenziell natür- „ProAqua“ entwickelt sowie landesweit be- Kosten gefördert (https://aktion-blau-plus.
lichen Gewässerentwicklungskorridors be- rechnend angewendet. Die Ergebnisse stehen rlp-umwelt.de).
stimmt. Als letzter Schritt im ersten Haupt- der Wasserwirtschaftsverwaltung Rhein-
teil wird über die Breite des heutigen land-Pfalz im Flussgebietsinformationssys- Neben der physikalisch abgeleiteten Ge-
potenziell natürlichen Gewässerentwick- tem des Landesamtes für Umwelt sowie in wässerentwicklungsfläche, die den ört-
lungskorridors durch Geodatenverarbeitung einem speziellen WebGis-Informationssys- lichen Bedingungen teilweise angepasst
die typspezifische Gewässerentwicklungs- tem zur Verfügung und können für die Flä- werden kann, hat die ebenfalls abfluss-
fläche generiert. chennutzungsplanung sowie örtliche Pro- und gefällespezifisch berechnete natürli-
jekte als Planungsgrundlage bereitgestellt che Gewässerbreite besondere praktische
6 Auenmagazin 20 / 2021PERSPEKTIVEN
Linnenweber et al. Gewässerentwicklungsflächen 4-9
Bedeutung. Ein Abgleich mit den bei Kar-
tierungen gemessenen Gewässerbreiten hat
Ermittlung gezeigt, dass ein großer Teil der Gewässer in
Schritt 1
gewässertypologische Grundlagen Rheinland-Pfalz ein zu schmales Bett auf-
weist und dadurch oft von unnatürlicher
Ingenieurtechnische Ermittlung
Tiefenerosion betroffen ist. Die berechne-
Gewässerentwicklungsfläche
Ermittlung
I. Naturwissenschaftliche /
Schritt 2 ten Gewässerbreiten sollten deshalb bei Ge-
heutige potenziell natürliche Gewässerbreite
wässerentwicklungsprojekten gleicherma-
ßen beachtet werden, da eine Anpassung
Plausibilisierung ermittelte heutige an die hydrologischen Abflussbedingungen
Schritt 3
potenziell natürliche Gewässerbreite
Voraussetzung für eine erfolgreiche Gewäs-
serentwicklung ist.
Generierung
Schritt 4
Gewässerkorridorbreite
Landesweite Bilanz
Generierung Die landesweite Berechnung hat in Rhein-
Schritt 5 land-Pfalz erstmals in Deutschland eine
typspezifische Gewässerentwicklungsfläche
landesweite Flächenbilanzierung für die
Gewässerentwicklung möglich gemacht.
Bestimmung Dabei ist zu beachten, dass die Gewässer-
Schritt 6
II. Spezifische Anpassung
Flächenbedarf SÖZ / HÖP landschaften hauptsächlich von den Mit-
telgebirgen, der Oberrheinebene sowie den
Flächenbedarf
in die Gebirge eingeschnittenen Gewässern
Bestimmung Mittelrhein, Mosel und Nahe geprägt sind.
Schritt 7
Flächenbedarf GÖZ / GÖP
Bei den kleinen und mittelgroßen Fließge-
wässern sind praktisch alle Talformen vom
Kerbtal bis zum Auetal und auch Flach-
Ermittlung und Berücksichtigung landgewässer auf den Hochebenen der Mit-
Schritt 8
Restriktionen
telgebirge und in der Oberrheinebene ver-
treten.
Abb. 3: Verfahrensübersicht. (Grafik: LAWA 2016) Die Flächengröße des Landes beträgt rund
20.000 Quadratkilometer, das Gewässer-
netz bis ca. 1 Meter Gewässerbreite umfasst
rund 11.000 km. Die Nutzung der Landes-
fläche verteilt sich auf insgesamt 10 Pro-
zent Siedlungs- und Verkehrsflächen, sowie
Landwirtschaft und Forstwirtschaft mit je-
weils 43 Prozent.
Fast 6 Prozent dieser Landesfläche sind
morphologisch Auen, darin sind 1,4 Prozent
Siedlung/Verkehr enthalten. Gemäß ATKIS
sind 0,9 Prozent kartographierte Wasser-
fläche einschließlich Seen und im vorge-
nannten Projekt wurden rund 1,3 Prozent
der Landesfläche als typspezifisch „maxi-
male“ Gewässerentwicklungsfläche iden-
tifiziert. Für die Gewässerentwicklungsflä-
che (GEF) zur Erreichung der Ziele gemäß
EG-WWRL wurde rund 1 Prozent der Lan-
desfläche identifiziert.
Abb. 4: Beispiel aus dem Flussgebietsinformationssystem des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz.
Ausschnitt der Talaue der Nahe mit Nebengewässern oberhalb Bad Kreuznach. Die Gewässerbreiten sind
nicht maßstäblich dargestellt. Die Nahe hat hier eine naturnahe mittlere Gewässerbreite von 50–60 Me-
tern, die Korridorbreite beträgt an den breiteren Stellen 400–500 Meter.
Auenmagazin 20 / 2021 7PERSPEKTIVEN
Linnenweber et al. Gewässerentwicklungsflächen 4-9
Gemäß ATKIS sind insgesamt 16 Prozent
der Gewässerentwicklungsfläche (GEF)
Restriktionsflächen Siedlung/Verkehr, da-
von nur 0,5 Prozent Verkehr. Diese Flä-
chen stehen praktisch nicht zur Disposi-
tion. Rund 7 Prozent sind kartographierte
Wasserfläche. Insgesamt 12 Prozent sind
naturnahe Flächen und rund 15 Prozent
Wald, also etwa 27 Prozent werden eher
gewässerverträglich genutzt. Die rest-
liche Fläche von rund 51 Prozent wird
landwirtschaftlich genutzt: Ackerland 5,4
Prozent, Grünland 45,2 Prozent. Insge-
samt überwiegt folglich die Grünlandnut-
zung sehr deutlich. Für einen Ankauf des
Grünlandes müssten gemäß Bodenricht-
wert ohne Nebenkosten theoretisch rund
90 Millionen Euro investiert werden. Abb. 5: Laufabschnittstypen der Sieg in NRW. (Karte: Bezirksregierung Köln, 2017)
Gewässerentwicklungskorridor
und -flächen an der Sieg
Für die Bezirksregierung Köln (NRW) wurde
das vorangehend beschriebene Verfahren
angewandt und so der Flächenbedarf für
eine typkonforme Entwicklung der Sieg und
ihrer Auen aufgezeigt.
Zunächst erfolgte eine typologische Zu-
ordnung der verschiedenen Laufabschnitt-
typen, die in NRW für die großen Fließge-
wässer flächenhaft vorliegen.
Im Anschluss erfolgte die Bearbeitung aller
vorangehend dargestellten Arbeitsschritte,
von denen einzelne Schritte nachfolgend
beispielhaft in Abbildungen 5 bis 8 darge- Abb. 6: Ermittlung der Talbodengefälle auf Basis des DGM. (Karte: Bezirksregierung Köln, 2017)
stellt werden.
Mit diesen Auswertungen liegt eine hoch-
wertige und belastbare Grundlage für die
Akquise von Gewässerentwicklungsflächen
vor. Ebenso können die Ergebnisse fachpla-
nerisch in künftige Raumplanungsprozesse
und andere raumrelevante Planungen ein-
gebracht werden.
Weitere Informationen:
LfU-RP (2016), LAWA (2018, 2016).
Abb. 7: Ausweisung der morphologischen Aue auf dem DGM1. (Karte: Bezirksregierung Köln, 2017)
8 Auenmagazin 20 / 2021PERSPEKTIVEN
Linnenweber et al. Gewässerentwicklungsflächen 4-9
chenbedarf für die Entwicklung von
Fließgewässern“ LFP Projekt O 4.13.
Anwenderhandbuch. unveröffentl. Ent-
wurf Stand Dezember 2016.
LAWA – Bund-/Länderarbeitsgemeinschaft
Wasser, (Hrsg.) (2018): Praxistest „Flä-
chen für die Entwicklung von Fließge-
wässern“ LFP Projekt O 9.18. Ergebnis-
bericht und Anwenderhandbuch.
LAWA – Bund-/Länderarbeitsgemeinschaft
Wasser, Hrsg. (2020): Leitlinien der Ge-
wässerentwicklung, Kulturbuchverlag.
LfU – Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz
(2016): Ergebnisbericht „Gewässerent-
wicklungsflächen in Rheinland-Pfalz“
unveröffentlicht (LfU-RP 2016).
LUA NRW – Landesamt für Umwelt Nord-
rhein-Westfalen, Hrsg. (2001): Leit-
bilder für die mittelgroßen bis großen
Abb. 8: Beispiel einer Ergebniskarte mit Darstellung der Gewässerbettfläche und der Gewässerentwick- Fließgewässer in Nordrhein-Westfalen
lungsflächen. (Karte: Planungsbüro Koenzen) – Flusstypen. Essen.
MULEWF RP – Ministerium für Umwelt,
Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau
Literaturverzeichnis Koenzen, U. (2005): Fluss- und Stromauen in und Forsten Rheinland-Pfalz (2015):
Deutschland – Typologie und Leitbilder, Aktion Blau Plus, Gewässerentwick-
Bezirksregierung Köln (2017): Typspezifi- In: Schriftr. Angewandte Landschafts- lung in Rheinland-Pfalz, Mainz.
scher Flächenbedarf für die Sieg. – un- ökologie Heft 65. Münster, Hrsg. BfN. Richter, K. (1999): Landschafts- und Fluß-
veröffentl. Abschlussbericht. Köln. LANUV NRW – Landesamt für Natur, Um- laufveränderungen im Siegtal als
Brunotte, E., Dister, E., Günther-Diringer, D., welt und Verbraucherschutz Nord- Grundlage zur Leitbildfindung. Unver-
Koenzen, U. & Mehl, D. (2009): Fluss- rhein-Westfalen (2015a): Fließgewäs- öffentl. schriftl. Hausarbeit im Rah-
auen in Deutschland: Erfassung und sertypenkarten Nordrhein-Westfalens. men der Ersten Staatsprüfung für das
Bewertung des Auenzustandes, In: LANUV-Arbeitsblatt 25. korrigierte Lehramt (Sekundarstufe I + II). Geo-
Schriftr. Naturschutz und Biologische Fassung Mai 2015. Recklinghausen. graphisches Institut Universität zu
Vielfalt Heft 87. Münster, Hrsg. BfN. LANUV NRW – Landesamt für Natur, Um- Köln.
Döbbelt-Grüne, S., Hartmann, C., Zellmer, U., welt und Verbraucherschutz Nord-
Reuvers, C., Zins, C. & Koenzen, U. (Um- rhein-Westfalen (2015b): Lauftypen
weltbundesamt (UBA) (Hrsg.) (2013): ausgewählter Fließgewässer in NRW
Hydromorphologische Steckbriefe der – Lauftypenkarte. Bearbeitung: FB 54, Kontakt:
deutschen Fließgewässertypen. Oktober 2015. verfügbar unter: http://
Elwas-Web (Hrsg. LANUV NRW) (2017): Re- www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/ Dipl.- Ing. Christoph Linnenweber
gionalisierte Abfluss- und Abfluss- wasser/oberflaechengewaesser/gew- Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz
spendenkennwerte. https://www.el- strukguete/Lauftypen_Fliessgewaes- Kaiser- Friedrich- Str. 7, 55116 Mainz
wasweb.nrw.de ser_NRW_dinA3.pdf (letzter Zugriff: Tel.: 06131-6033-1517
Europäisches Parlament und Rat Der Europä- 1. Februar 2017). christoph.linnenweber@lfu.rlp.de
ischen Union: – Richtlinie 2000/60/EG LAWA – Bund-/Länderarbeitsgemeinschaft Dr. Uwe Koenzen
vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung Wasser, Hrsg. (2006): Leitlinien zur Planungsbüro Koenzen
eines Ordnungsrahmens für Maßnah- Gewässerentwicklung. Ziele und Stra- Wasser und Landschaft
men der Gemeinschaft im Bereich der tegien, Kulturbuchverlag. Schulstraße 37, 40721 Hilden
Wasserpolitik. ABl. L 327 vom 22. De- LAWA – Bund-/Länderarbeitsgemeinschaft Tel: 02103/90884-0
zember 2000, S. 1–73. Wasser, Hrsg. (2013): LAWA AO, Ra- Fax: 02103/90884-19
Geobasis NRW (2017): DGM1 Rohdaten der Kon Monitoring Teil B, Arbeitspapier I
Gemeinden Bonn, Eitorf, Hennef, St. „Gewässertypen und Referenzbedin- M. S. Dipl.-Ing. Joachim Steinrücke
Augustin, Troisdorf, Windeck. https:// gungen“ (Stand: 12. September 2013). ProAqua Ingenieurgesellschaft
www.opengeodata.nrw.de/produkte/ LAWA – Bund-/Länderarbeitsgemeinschaft für Wasser- und Umwelttechnik mbH
geobasis/dgm/dgm1/0c6796e5-9eca- Wasser, (Hrsg.) (2016): LAWA-Verfah- Turpinstraße 19, 52066 Aachen
4ae6-8b32-1fcc5ae5c481 rensempfehlung „Typspezifischer Flä-
Auenmagazin 20 / 2021 9BERICHTE UND PROJEKTE
J. Heyden et al. Zustand der Flussauen in Deutschland 2021 10-14
ZUSTAND DER FLUSSAUEN IN DEUTSCHLAND 2021
Janika Heyden, Bernd Neukirchen, Thomas Ehlert
Der Auenzustandsbericht wurde 12 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung fortgeschrieben. Die Ergebnisse
des Auenzustandsberichts 2021 zeigen, dass bundesweit keine Trendwende bei der naturnahen Entwicklung
von Flussauen erreicht werden konnte. Dennoch sind infolge von Auenrenaturierungen lokal deutliche
Zustandsverbesserungen feststellbar. Um bundesweit signifikante Verbesserungen im Auenzustand zu erreichen,
bedarf es der großflächigen Reaktivierung auentypischer Prozesse und eigendynamischer Entwicklungen
naturnaher Flusslandschaften. Werden die vorhandenen Renaturierungspotenziale künftig für mehr
und großflächigere Maßnahmen genutzt, ist die Erreichung der auenbezogenen politischen und gesetzlichen
Ziele möglich. Mit der Softwareanwendung AuenZEB 1.0 können Verbesserungen des Zustands
renaturierter Auen an kleinen und großen Flüssen selbst beurteilt werden.
Abb. 1: Naturnahe Flussauen mit regelmäßigen Überflutungen sind in Deutschland nach wie vor selten. (Foto: Thomas Ehlert)
Der Auenzustandsbericht 2021 schutz und beim naturverträglichen Hoch- Für die Fortschreibung des Auenzustands-
wasserschutz deutlich. Der Auenzustands- berichts standen neue, aktualisierte und ge-
Mit dem Auenzustandsbericht 2021 haben bericht richtet sich damit gleichermaßen nauere Geoinformationen zur Verfügung.
das Bundesumweltministerium und das an Akteure aus Naturschutz und Wasser- Um diese nutzen zu können, waren An-
Bundesamt für Naturschutz zum zweiten wirtschaft. Die beiden Karten zum Verlust passungen und in Einzelfällen auch Ergän-
Mal eine bundesweite Bestandsaufnahme von Auenflächen (BfN 2021a) und zum Zu- zungen der Methodik von Brunotte et al.
zur Ausdehnung und zum Verlust von Über- stand der noch überflutbaren rezenten Auen (2009) zur bundeseinheitlichen Abgrenzung
schwemmungsflächen sowie zum Zustand (BfN 2021b) ermöglichen eine differenzierte und Bewertung der Auen notwendig. So er-
und zur Nutzung der Flussauen veröffent- Beurteilung des Auenzustands auf Bundes- möglichten beispielsweise aktuelle Daten zu
licht (BMU & BfN 2021). Zusätzlich wurde ebene ebenso wie für einzelne Flussab- Überschwemmungsgebieten und ein hoch
die bundesweite Übersicht zu Auenrenatu- schnitte. Untersuchungsgegenstand waren aufgelöstes digitales Geländemodell eine
rierungsprojekten an Flüssen aktualisiert. wie schon beim ersten Auenzustandsbericht präzisere Abgrenzung der Auen. Auch die
Die Ergebnisse machen sowohl die lokalen von 2009 die Auen von 79 Flüssen mit einem Integration von Biotop- und FFH-Lebens-
und regionalen Erfolge in der naturnahen Einzugsgebiet von mehr als 1.000 Quadrat- raumtypen in die Auenzustandsbewertung
Auenentwicklung als auch die bundesweit kilometern (ohne Tidebereiche) entlang von hat zu einer Qualitätsverbesserung der Er-
weiterhin bestehenden Defizite im Auen- 10.297 Flusskilometern. gebnisse beigetragen.
10 Auenmagazin 20 / 2021BERICHTE UND PROJEKTE
J. Heyden et al. Zustand der Flussauen in Deutschland 2021 10-14
Die grundsätzliche Vorgehensweise der Er- Mit der Auenabgrenzung 2021 umfas- Dass dieses Ziel grundsätzlich erreichbar ist,
fassung von 1-Kilometer-Auensegementen sen die morphologischen Auen der 79 be- zeigt eine bundesweite Studie (Harms et al.
und die der Bewertung zugrunde liegenden trachteten Flüsse eine Fläche von ins- 2018), die Wiederanbindungspotenziale in
Rechenregeln wurden jedoch beibehalten. gesamt 16.185 Quadratkilometern bzw. der Größenordnung von einigen zehntau-
Insgesamt ermöglicht der Auenzustandsbe- 4,5 Prozent der Bundesfläche. Gegenüber send Hektar identifiziert.
richt 2021 somit eine differenziertere Be- 2009 hat die Fläche der rezenten Auen
trachtung der Flussauen in Deutschland. rechnerisch um 11 Prozent zugenommen.
In der Konsequenz bedeutet dies aller- Dieser Zugewinn ist im Wesentlichen auf Zustand der rezenten Flussauen
dings auch, dass die Ergebnisse der Erst- die nun flächendeckend für alle 79 Flüsse
bewertung von 2009 und der Fortschrei- vorliegende Abgrenzung der Überschwem- Der Auenzustand dient als Maß für die öko-
bung von 2021 nur bedingt und im Detail mungsbereiche zurückzuführen (siehe Gün- logische Funktionsfähigkeit der rezenten
nur unter Berücksichtigung der datenseiti- ther-Diringer et al. 2021). Die reale Vergrö- Flussauen, insbesondere ihrer Lebensraum-
gen Grundlagen vergleichbar sind. Hinsicht- ßerung der Auenflächen gegenüber 2009 qualität und ihrer Biotopverbundfunktion.
lich ihrer Kernaussagen sind beide Berichte durch die Schlitzung und Rückverlegung Er bildet das Ausmaß der standörtlichen
jedoch vergleichbar. Die Methodik und Da- von Deichen beträgt 4.183 Hektar. Seit der Veränderungen gegenüber dem potenziell
tengrundlagen zur Auenerfassung und Au- ersten Maßnahme 1983, dem Belassen des natürlichen Referenzzustand nach Koenzen
enzustandsbewertung 2021 werden aus- Deichbruchs am Kühkopf (Oberrhein), wur- (2005) ab und wird in fünf Klassen von Au-
führlich in Günther-Diringer et al. (2021) den insgesamt 65 Rückdeichungsprojekte enzustandsklasse 1 „sehr gering verändert“
beschrieben. entlang der 79 Flüsse abgeschlossen. Der bis Klasse 5 „sehr stark verändert“ einge-
Flächenzugewinn durch diese Maßnahmen teilt. Bei der Auenzustandsbewertung 2021
beträgt insgesamt 7.100 Hektar – eine Ver- (Abbildung 4) werden nur knapp 1 Prozent
Verlust von größerung der überflutbaren Flussauen um der rezenten Auen als sehr gering verän-
Überschwemmungsflächen rund 1,5 Prozent. Das Ziel der Nationalen dert und damit besonders naturnah ein-
Strategie zur biologischen Vielfalt, die na- gestuft. Weitere 8 Prozent sind ökologisch
Auch 2021 können bundesweit nur noch türlichen Überflutungsflächen an Flüssen noch weitgehend funktionsfähig (Auenzu-
ein Drittel der natürlichen Überflutungsflä- um 10 Prozent zu vergrößern (BMU 2007) standsklasse 2).
chen (morphologische Aue) bei Hochwas- wird somit bislang deutlich verfehlt.
ser überflutet werden. Analog zum Auenzu-
standsbericht 2009 sind damit zwei Drittel
der Auenflächen durch Hochwasserschutz-
deiche vom Überflutungsregime der Flüsse
abgeschnitten und stehen daher nicht mehr
als Retentionsraum zur Verfügung. Beson-
ders hohe Verluste von abschnittsweise über
80 Prozent der Überschwemmungsflächen
wurden an den Strömen Rhein, Elbe, Oder
und Donau sowie an Dosse, Ohre, Unstrut,
Schwarzer Elster und den alpinen Zuflüssen
der Donau identifiziert. Demgegenüber sind
z. B. an Ems, Ober- und Mittelweser und den
meisten kleineren Flüssen in Teilbereichen
noch vergleichsweise große Anteile rezenter
Auenflächen vorhanden (vgl. BfN 2021a).
Allerdings werden die Auen auch an solchen
Flussabschnitten aufgrund des hohen Aus-
baugrades der Flüsse vielerorts nicht mehr
durch die ökologisch besonders bedeutsa-
men häufigen und kleinen Hochwasserer-
eignisse überflutet.
Abb. 2: Verlust von
Überschwemmungs-
flächen 2021 beispiel-
Verlust von Überschwemmungsflächen
haft dargestellt
90 bis 100 % 65 bis < 80 % 25 bis < 50 % für das Donau-
80 bis < 90 % 50 bis < 65% < 25 % Einzugsgebiet.
(Karte: verändert nach
BMU & BfN 2021)
Auenzustandsklassen der rezenten Aue
Auenmagazin 20 / 2021
sehr gering verändert sehr stark verändert 11
gering verändert nicht bewertetBERICHTE UND PROJEKTE
J. Heyden et al. Zustand der Flussauen in Deutschland 2021 10-14
Die für den Auenzustandsbericht 2021 Seit den 1980er Jahren, insbesondere aber Etwa die Hälfte dieser Projekte wurde
durchgeführten differenzierten Analysen seit dem Jahr 2000, wurden bundesweit seit Erscheinen des ersten Auenzustands-
zu auentypischen Lebensräumen zeigen, etwa 220 größere Auenrenaturierungs- berichts realisiert, was verdeutlicht, dass
dass diese wenigen naturnahen Auenab- projekte umgesetzt, 167 davon liegen in- die Zahl der Renaturierungen langsam,
schnitte eine hohe Habitatvielfalt aufwei- nerhalb der Gebietskulisse des Auenzu- aber stetig steigt.
sen und einen hohen naturschutzfachlichen standsberichts.
Wert als Lebensraum für auentypische Tier-
und Pflanzenarten besitzen. Auen der Zu-
standsklasse 3, der ein Drittel der rezenten
Flussauen angehören, sind in ihrer natür-
lichen Funktionsfähigkeit bereits deut-
lich verändert, verfügen aber grundsätz-
lich noch über auentypische Eigenschaften.
Dieser „Auencharakter“ ist dem Großteil der
rezenten Flussauen Deutschlands verloren
gegangen: Das verbreitete Auftreten der
Auenzustandsklassen 4 (stark verändert,
32 Prozent) und 5 (sehr stark verändert,
26 Prozent) spiegelt die historisch gewach-
sene und weiterhin sehr hohe Nutzungs-
intensität der Flusslandschaften wider. So
werden nach wie vor gut ein Drittel der re-
zenten Auen als Acker- (26 Prozent) sowie
als Siedlungs-, Verkehrs- und Gewerbeflä-
chen (7 Prozent) genutzt. Ein Großteil der
rezenten Auen ist Grünland (43 Prozent), Verlust von Überschwemmungsflächen
nur etwa 10 Prozent davon werden jedoch 90 bis 100 % 65 bis < 90 % 25 bis < 90 %
extensiv bewirtschaftet. Auch Wälder, die 80 bis < 90 % 50 bis < 90 % < 25 %
16 Prozent der Flussauen bedecken, besit-
zen kaum mehr standorttypische Ausprä-
gungen. Der Anteil der Feuchtgebiete an Auenzustandsklassen der rezenten Aue
den natürlicherweise feuchten und nassen
Auen liegt nur noch bei 2 Prozent. sehr gering verändert sehr stark verändert
gering verändert nicht bewertet Abb. 3: Auenzustand
Insgesamt hat es während der vergangenen deutlich verändert Altaue 2021 beispielhaft
dargestellt für
12 Jahre bundesweit keine wesentlichen stark verändert den Oberrhein.
Veränderungen der Nutzung und des Zu- (Karte: verändert nach
stands der rezenten Auen gegeben. Das ge- BMU & BfN 2021)
genüber der Auenzustandsbewertung 2009
vermehrte Auftreten von Auenzustands-
klasse 5 bei gleichzeitiger Abnahme der
Klassen 3 und 4 ist vor allem auf die verän-
1% 1%
derte Abgrenzung der Auen zurückzuführen, 2009 2021
20 %
wobei vermehrt selten überflutete Bereiche 9% 8%
mit höheren Acker- und Siedlungsanteilen 26 %
als rezente Auen erfasst wurden. Dennoch
sind lokale Veränderungen festzustellen: Ei- 36 % 33 %
34 %
nerseits haben Flächenversiegelungen und 32 %
Nutzungsintensivierungen zu Verschlech- Abb. 4: Zustand der
terungen des Auenzustands geführt. Dort, rezenten Flussauen:
sehr gering verändert stark verändert Verteilung der Auen-
wo Auen und Flüsse umfänglich renatu-
gering verändert sehr stark verändert zustandsklassen
riert worden sind, sind andererseits deutli-
deutlich verändert 2009 und 2021.
che Verbesserungen im Auenzustand fest- (Grafik: verändert nach
zustellen. BMU & BfN 2021)
12 Auenmagazin 20 / 2021BERICHTE UND PROJEKTE
J. Heyden et al. Zustand der Flussauen in Deutschland 2021 10-14
Die Maßnahmen leisten einen wichtigen Die Bewertungsmethodik gliedert sich in Fazit und Ausblick
Beitrag zum Erhalt der biologischen Viel- ein Übersichts- und ein Detailverfahren, das
falt und zum Aufbau eines länderübergrei- erstmals die Bewertung kleinerer Flüsse mit Mit der Fortschreibung des Auenzustands-
fenden Biotopverbundes. Um auf Bundes- einem Einzugsgebiet etwa ab 100 Quadrat- berichts, der Bereitstellung einer länder-
ebene jedoch signifikante Verbesserungen kilometern ermöglicht, die in der bundes- übergreifenden Methodik zur Auenzu-
des Zustands der Flussauen und damit eine weiten Auenzustandsbewertung nicht be- standsbewertung und dem Bewertungstool
Trendwende zu erreichen, bedarf es um- rücksichtigt wurden. Die Grundzüge der von AuenZEB 1.0 setzen das Bundesumwelt-
fangreicher, zusätzlicher Renaturierungs- Koenzen et al. (2020a) und von Günther-Di- ministerium und das Bundesamt für Na-
maßnahmen mit überregionaler Wirkung, ringer et al. (2021) beschriebenen Vorgehen turschutz weitere Impulse für die Auen-
die auentypische Prozesse reaktivieren und zur Auenzustandsbewertung sind identisch. entwicklung in Deutschland. Nach wie vor
eigendynamische Entwicklungen zulassen. Im Detail ergeben sich jedoch Unterschiede, ist das politische Ziel, den Flüssen mehr
da die Auswertung von Landes- und Bundes- Raum zur Reaktivierung und naturnahen
daten für den Auenzustandsbericht 2021 au- Entwicklung von Auen zu geben, hochaktu-
Eigene Auenzustandsbewertung mit tomatisiert erfolgte. Renaturierungserfolge ell und eine beschleunigte Maßnahmenum-
der Software-Anwendung AuenZEB können i. d. R. bereits unmittelbar nach setzung dringend erforderlich. Zur Ablei-
Maßnahmenumsetzung abgebildet werden, tung programmatischer und strategischer
In der Umsetzungspraxis müssen für kon- da die Auenzustandsbewertung größtenteils Aussagen und Zielsetzungen, zur Feststel-
krete Bewertungen und Planungen ergän- auf abiotischen Bewertungsparametern auf- lung von Defiziten und Erfolgen in der Au-
zende Informationen herangezogen wer- baut. Maßnahmen im Ufer- und Auenbereich enentwicklung und der Identifikation künf-
den, die in ihrem Detaillierungsgrad über können mit AuenZEB 1.0 nachvollziehbar do- tiger Handlungsschwerpunkte hat sich der
die Grundlagen des Auenzustandsberichts kumentiert und bewertet werden, sodass Sy- Auenzustandsbericht als geeignetes Werk-
hinausgehen. In einem Forschungsvor- nergien zwischen Naturschutz und Wasser- zeug bewährt. Bereits die Ergebnisse des
haben des Bundesamtes für Naturschutz wirtschaft bei Maßnahmenplanungen oder Auenzustandsberichts 2009 haben Eingang
wurde dafür eine Anleitung für die Erfas- Erfolgskontrollen gut darstellbar sind. Das in umwelt- und naturschutzpolitische Stra-
sung und Bewertung des Auenzustandes Bewertungsverfahren und für die Bewertung tegien und Programme auf Landes- und
an Flüssen (Koenzen et al. 2020a) sowie die notwendige Grundlagen stehen unter www. Bundesebene gefunden und dienen dabei
dazugehörige Software-Anwendung Au- BfN.de zur Verfügung. auch als Maß für ihren Umsetzungsstand.
enZEB 1.0 einschließlich Benutzerhand- Mit dem Auenzustandsbericht 2021 liegen
buch (Koenzen et al. 2020b) erarbeitet. Als weitere Komponente zur Bewertung nun neue Daten vor für die Aktualisierung
Damit können Akteure aus Umsetzungspra- von Auen wird im Auftrag des Bundes- der Indikatoren zur Erfolgskontrolle der Na-
xis oder Wissenschaft künftig eigenstän- amtes für Naturschutz derzeit gerade tionalen Strategie zur biologischen Vielfalt
dige Auenzustandsbewertungen durchfüh- ein Verfahren zur biozönotischen Auen- (BMU 2007), der Deutschen Anpassungs-
ren und diese Detailkartierungen einzelner zustandsbewertung und zur biologischen strategie an den Klimawandel (Die Bun-
Auenabschnitte für Ersterfassungen oder Erfolgskontrolle entwickelt (Januschke desregierung 2008) und des Bundespro-
Erfolgskontrollen von Renaturierungsmaß- et al. 2021) gramms Blaues Band Deutschland (BMVI
nahmen nutzen. & BMUB 2017).
Abb. 5: An der Unteren Havel werden Auen großflächig renaturiert und in ihrer Funktionsfähigkeit wiederhergestellt. (Foto: J. Heyden)
Auenmagazin 20 / 2021 13BERICHTE UND PROJEKTE
J. Heyden et al. Zustand der Flussauen in Deutschland 2021 10-14
Aufbauend auf den Ergebnissen des ers- cherheit, Bundesamt für Naturschutz Neuburg a. d. Donau). ISSN 2190-
ten Auenzustandsberichts und dem da- (Hrsg.) (2021): Auenzustandsbe- 7234. http://www.auenzentrum-neu-
zugehörigen Geodatensatz „Flussauen in richt 2021. Flussauen in Deutsch- burg-ingolstadt.de/auenforum/auen-
Deutschland“ wurden in den letzten 10 Jah- land. Abrufbar unter: https://www. magazin/index.html
ren zudem verschiedene Forschungsarbeiten bfn.de/fileadmin/BfN/wasser/Doku- Koenzen, U. (2005): Fluss- und Stromauen
durchgeführt, wie beispielsweise die bun- mente/AZB_2021/AZB_2021_bf.pdf in Deutschland. Typologie und Leitbil-
desweiten Abschätzungen zu den Ökosys- (10. Mai 2021). der. Angewandte Landschaftsökologie
temleistungen von Flussauen (Scholz et al. BMVI & BMUB – Bundesministerium für 65. Bonn – Bad Godesberg.
2012) und den Potenzialen zur naturnahen Verkehr und digitale Infrastruktur, Koenzen, U., Kurth, A., Mach, S., Modrak, P.,
Auenentwicklung (AG „Fachliche Grundla- Bundesministerium für Umwelt, Na- Gohrbandt, S., Ackermann, W., Ruff, A.
gen“ 2016; Harms et al. 2018). Für kom- turschutz, Bau und Reaktorsicher- & Günther-Diringer, D. (2020a): An-
mende auenbezogene konzeptionelle oder heit (Hrsg.) (2017): Bundesprogramm leitung für die Erfassung und Bewer-
anwendungsbezogene Forschungsaktivi- Blaues Band Deutschland. Eine Zu- tung des Auenzustandes an Flüssen.
täten bietet der Geodatensatz „Flussauen kunftsperspektive für die Wasserstra- Band 1: Grundlagen und Vorgehens-
in Deutschland 2021“ eine aktualisierte ßen – beschlossen vom Bundeskabi- weise. BfN-Skripten 548. Bonn – Bad
Grundlage. Dennoch wird es auch künftig nett am 1. Februar 2017. Bonn. Godesberg.
notwendig sein, die Datenbasis zur Auener- Brunotte, E., Dister, E., Günther-Diringer, D., Koenzen, U., Kurth, A., Mach, S., Modrak, P.,
fassung und Auenzustandsbewertung regel- Koenzen, U. & Mehl, D. (2009): Fluss- Gohrbandt, S., Ackermann, W., Ruff, A.
mäßig zu aktualisieren und fortzuschreiben. auen in Deutschland. Erfassung und & Günther-Diringer, D. (2020b): An-
Dazu gehört auch die Bewertung der tide- Bewertung des Auenzustandes. Na- leitung für die Erfassung und Bewer-
beeinflussten Abschnitte der großen Flüsse. turschutz und Biologische Vielfalt 87. tung des Auenzustandes an Flüssen.
Bonn – Bad Godesberg. Band 2: Benutzerhandbuch zur Soft-
Die Bundesregierung (Hrsg.) (2008): Deut- ware-Anwendung AuenZEB 1.0. BfN-
Literatur sche Anpassungsstrategie an den Kli- Skripten 549. Bonn – Bad Godesberg.
mawandel, vom Bundeskabinett am Scholz, M., Mehl, D., Schulz-Zunkel, C.,
AG „Fachliche Grundlagen“ (Hrsg.) (2016): 17. Dezember 2008 beschlossen. Kasperidus, H. D., Born, W. & Henle,
Fachliche Grundlagen zum Bundes- Günther-Diringer, D., Berner, K., Koenzen, U., K. (2012): Ökosystemfunktionen von
programm „Blaues Band Deutsch- Kurth, A., Modrak, P., Ackermann, W., Flussauen – Analyse und Bewertung
land“. Hannover. Ehlert, T. & Heyden, J. (2021): Methodi- von Hochwasserretention, Nähr-
BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.) sche Grundlagen zum Auenzustands- stoffrückhalt, Kohlenstoffvorrat,
(2021a): Verlust von Überschwem- bericht 2021: Erfassung, Bilanzierung Treibhausgasemissionen und Habi-
mungsflächen. Bundesweite Über- und Bewertung von Flussauen. BfN- tatfunktion. Naturschutz und Biolo-
sichtskarte. Ausgabe 2021. Abrufbar Skripten 591. Bonn-Bad Godesberg. gische Vielfalt 124. Bonn – Bad Go-
unter: https://www.bfn.de/fileadmin/ Harms, O., Dister, E., Gerstner, L., Damm, C., desberg.
BfN/wasser/Dokumente/AZB_2021/ Egger, G., Heim, D., Günther-Diringer,
Karte_Auenverlust_red_final_bf.pdf D., Koenzen, U., Kurth, A. & Modrak, P.
(7. Mai 2021). (2018): Potenziale zur naturnahen Au-
BfN – Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.) enentwicklung. Bundesweiter Über-
(2021b): Auenzustand – rezente Flus- blick und methodische Empfehlungen Kontakt:
sauen. Bundesweite Übersichts- für die Herleitung von Entwicklungs-
karte. Ausgabe 2021. Abrufbar un- zielen. BfN-Skripten 489. Bonn – Bad Bernd Neukirchen,
ter: https://www.bfn.de/fileadmin/ Godesberg. Dr. Thomas Ehlert,
BfN/wasser/Dokumente/AZB_2021/ Januschke, K., Hering, D., Stammel, B., Brun- Janika Heyden
Karte_Auenzustand_red_final_bf.pdf zel, S., Scholz, M., Rumm, A., Satt- Bundesamt für Naturschutz
(7. Mai 2021). ler, J., Foeckler, F., Fischer, C., Ma- Konstantinstr. 110
BMU – Bundesministerium für Umwelt, kiej, A. & Ehlert, T. (in diesem Heft): 53179 Bonn
Naturschutz und Reaktorsicherheit Biozönotische Auenzustandsbewer- E-Mail: Bernd.Neukirchen@bfn.de
(Hrsg.) (2007): Nationale Strategie zur tung zur Erfolgskontrolle von Rena- Tel.: +49 228 8491 1840
biologischen Vielfalt. Berlin. turierungsmaßnahmen an Flussufern
BMU & BfN – Bundesministerium für Um- und in Aue. – Auenmagazin 20/2021,
welt, Naturschutz und nukleare Si- 20–28. (Magazin des Auenzentrums
14 Auenmagazin 20 / 2021BERICHTE UND PROJEKTE
N. Schulte-Kellinghaus Erfolgskontrolle der Wiederherstellung des Biotopverbunds am Rhein 15-19
Vernetzte Lebensräume, mehr Biodiversität
ERFOLGSKONTROLLE DER WIEDERHERSTELLUNG DES BIOTOPVERBUNDS
AM RHEIN MITHILFE VON FERNERKUNDUNGSDATEN
Nikola Schulte-Kellinghaus
Das Konzept zum „Biotopverbund am Rhein“ der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR)
zeigt Potenziale für die Erhaltung, Aufwertung und Vernetzung der wertvollen Biotoptypen entlang des Rheins vom
Bodensee bis zur Nordsee auf, formuliert konkrete Entwicklungsziele für Rheinabschnitte und setzt klare
räumliche Schwerpunkte. Es dient gleichermaßen dem Gewässer-, dem Natur- und dem Hochwasserschutz mit
allen damit einhergehenden Synergieeffekten. Erstmals wurde der Ist-Zustand 2020 des Biotopverbunds entlang
des Rheins vorwiegend mithilfe digitaler Fernerkundung flächendeckend erfasst. Die acht IKSR-Biotoptypengruppen
konnten für den größten Teil der Rheinaue basierend auf Satellitendaten aus dem europäischen Copernicus-
Programm klassifiziert werden. Die Methodik erlaubt es, zukünftig in regelmäßigeren Abständen flächendeckende
Erfolgskontrollen der Wiederherstellung des Biotopverbunds kosteneffizienter durchzuführen.
70 Jahre
internationale Zusammenarbeit
und ihre Fortsetzung
Der Rhein verbindet die Alpen mit der Nord-
see (vgl. Abbildung 1). Er ist 1.233 Kilome-
ter lang und einer der größten Flüsse Eu-
ropas. In seinem Einzugsgebiet leben über
60 Millionen Menschen in neun Staaten. Er
ist eine stark befahrene Wasserstraße, an
deren Ufer sich zahlreiche Städte und In-
dustriestandorte befinden, die von der Lage
am Fluss profitieren. Seit dem 19. Jahrhun-
dert hat der Mensch in das Ökosystem des
Flusses und seiner Auen stark eingegriffen.
Rund 90 Prozent der ursprünglichen Auen-
flächen wurden seit 1800 am Rhein zer-
stört. Mitte des 20. Jahrhunderts war es
schlecht um den Rhein bestellt: Das Wasser
war stark verschmutzt und mehrere Indus-
trieunfälle hatten die Situation zusätzlich
verschärft. 1950 wurde die Internationale
Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR)
gegründet, um Maßnahmen einzuleiten. Die
langjährige internationale Zusammenarbeit
hat maßgeblich dazu beigetragen, dass es
dem Rhein heute wieder besser geht. Die
Wasserqualität hat sich nachweislich er-
holt. Dem Fluss wurde wieder mehr Raum
gegeben und viele rheintypische Tier- und
Pflanzenarten sind zurückgekehrt.
Abb.1: Rheinabschnitte und Teileinzugsgebiete im
Rheinsystem. (Karte: verändert nach IKSR)
Auenmagazin 20 / 2021 15Sie können auch lesen