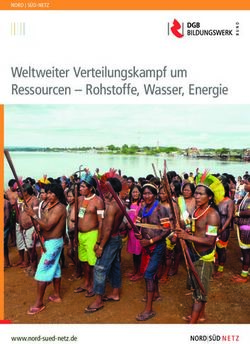ENERGIE Stromnetze in Zeiten der Energiewende Markt oder Staat? Energietechnologien und Energiewandel in Afrika
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
10. Jahrgang . Ausgabe 2 . November 2014
FORSCHUNG & TECHNIK
Stromnetze in Zeiten
der Energiewende
Seiten 30-33
RECHT & WIRTSCHAFT
Markt
oder Staat?
Seiten 38-41
KULTUR & REGIONEN Thema
Energietechnologien und ENERGIE
Energiewandel in Afrika
Seiten 46-49Grusswort
Liebe Leserinnen und Leser,
I ch freue mich, Sie zu einer neuen Ausgabe un-
seres Universitätsmagazins SPEKTRUM begrü-
ßen zu dürfen, das sich diesmal ganz dem Thema
Besonders stolz ist die Universität Bayreuth jedoch
darauf, dass das für die Zukunft so wichtige The-
mengebiet „Energie“ nicht – wie vielleicht andern-
„Energie“ widmet. orts – nur aus natur- und ingenieurwissenschaftli-
cher Sicht betrachtet wird. Vielmehr sind rechts-,
An der Universität Bayreuth ist die Forschung auf wirtschafts- und kulturwissenschaftliche Forschungs-
diesem Gebiet unter anderem im aufstrebenden fragen in die Beschäftigung mit diesem Zukunfts-
Profilfeld „Energieforschung und Energietechnolo- thema eingebettet. Deswegen entstammen die
gie“ verankert. Unsere Profilfelder sind strategisch Beiträge in dieser SPEKTRUM-Ausgabe nicht nur
ausgewählte fächerübergreifende Schwerpunkte, den Bereichen Forschung und Technik, sondern be-
die neben unseren hervorragend ausgewiesenen leuchten das Thema auch aus der Perspektive der
Fachdisziplinen ausschlaggebend für den ausge- Rechts- und Wirtschaftswissenschaften und gehen
zeichneten Ruf unserer Universität in Forschung auf kulturelle und regionale Aspekte ein.
Prof. Dr. Stefan Leible, und Lehre sind. Aufgeteilt in die bereits etablier-
Präsident der Universität ten Advanced Fields und die jüngeren Emerging Die Vielzahl der an unserer Universität bearbei-
Bayreuth.
Fields bündeln wir dort unsere interdisziplinären teten Projekte zum Thema „Energie“, von der in-
Kompetenzen und erzeugen Synergien. ternationalen Ebene bis zur Regionalforschung,
ist wirklich eindrucksvoll. Davon können Sie sich
beim Lesen des vorliegenden SPEKTRUM-Hefts
selbst überzeugen – dabei stellen die abgedruck-
ten Beiträge nur eine Auswahl dar.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und
viele neue Erkenntnisse!
Ihr
Prof. Dr. Stefan Leible
Präsident der Universität Bayreuth
2 Ausgabe 2 . 2014Editorial
K ein Tag vergeht, ohne dass in der Zeitung,
im Fernsehen und in anderen Medien über
das Thema „Energie“ berichtet und diskutiert wird.
im Angebot von Wind- und Sonnenenergie zum
Beispiel durch Speicher und Lastmanagement aus-
zugleichen. Bis heute unterschätzt wird auch die
Meist sind damit Ärger und Sorgen verbunden: gesellschaftspolitische Bedeutung der Energiewen-
persönlich, wenn Strom, Gas, Öl und Kraftstoffe de: Wie weit will und kann man Großkraftwerke
teurer werden; auf kommunaler und regionaler durch eine dezentrale Struktur, Energiekonzerne
Ebene, etwa wenn man fürchtet, dass Windkraftan- durch kommunale, oft genossenschaftliche Initia-
lagen oder Stromtrassen die Landschaft nachteilig tiven ersetzen?
verändern; national, wenn man sich um eine siche-
re und preislich akzeptable Energieversorgung des Bereits diese Beispiele zeigen, dass Energiefragen
Industriestandorts Deutschland sorgt; nicht zuletzt nicht nur wichtig, sondern auch kompliziert, viel-
aber auch global, wenn man an begrenzte fossile fältig und interdisziplinär sind. – Wer wäre also
Ressourcen und drohende Klimaveränderungen besser geeignet als unsere Universität Bayreuth
bei einem zugleich weltweit anzustrebenden men- mit ihrem Profilfeld „Energieforschung und Ener- Prof. Dr.-Ing. Dieter
schengerechten Grundwohlstand denkt. gietechnologie“, durch Forschung, Entwicklung Brüggemann leitet den
Lehrstuhl für Technische Thermo-
und Lehre zur Lösung zumindest einiger der He- dynamik und Transportprozesse
Der in Deutschland geprägte, inzwischen internati- rausforderungen beizutragen? (LTTT) und ist Direktor des Zent-
onal bekannte Begriff der „Energiewende“ fordert rums für Energietechnik (ZET) an
der Universität Bayreuth.
nicht nur eine vollständige Abkehr von der Kern- Dass die ausgewählten Beiträge in diesem Heft Sie
energie, sondern auch eine schrittweise Senkung informieren und anregen, wünscht
des Verbrauchs fossiler Energieträger. Dies alles
soll durch erneuerbare Energien und eine effizien- Ihr
tere Nutzung gelingen. Zunächst weniger bedacht
hatte man die damit verbundene Notwendigkeit,
die sehr großen naturbedingten Schwankungen
Prof. Dr.-Ing. Dieter Brüggemann
Sprecher des Profilfelds
„Energieforschung und Energietechnologie“
Impressum
Spektrum-Magazin der Universität Bayreuth
Auflage: Redaktionsleitung:
3.000 Stück Christian Wißler (V.i.S.d.P.)
Druck:
Herausgeber:
bonitasprint gmbh, Würzburg
Universität Bayreuth
Stabsabteilung PMK – Presse, Satz und Layout:
Marketing und Kommunikation GAUBE media agentur, Bayreuth
95440 Bayreuth Telefon (09 21) 5 07 14 41 Christian Wißler M.A.,
Telefon (09 21) 55 - 53 56 / - 53 24 spektrum@gaube-media.de Fachwirt Public Relations
(BAW), Stabsabteilung PMK der
Telefax (09 21) 55 - 53 25 Bildquellen-Kennzeichnung: Universität Bayreuth, Wissen-
Fotos Titelseite, Editorialseiten:
pressestelle@uni-bayreuth.de sst: www.shutterstock.com schaftskommunikation.
sst. Inhaltsverzeichnis: u.a. Chris-
topher Halloran / Shutterstock.com
Alle Beiträge sind bei Quellenangaben und Belegexemplaren frei zur Veröffentlichung. und fineart-collection / fotolia.com.
Ausgabe 2 . 2014 3Thema
ENERGIE
2 Grußwort
Prof. Dr. Stefan Leible
Präsident der Universität Bayreuth
3 Editorial
Prof. Dr.-Ing. Dieter Brüggemann Forschung & Technik I
Sprecher des Profilfelds „Energie-
forschung und Energietechnologie“ 10 Die Natur als Vorbild:
Licht sammeln und verwerten
3 Impressum
Grundlagenforschung für neue
4 Inhaltsverzeichnis Wege der Energieerzeugung
26 Kontrollierte Kernfusion
Eine vielversprechende
Energiequelle und ein spannendes
Forschungsgebiet
14 30 Stromnetze in Zeiten
Mit hocheffizienten, auf Folien gedruckten Photovoltaikzellen hat die Solarenergie Zukunft. der Energiewende
Neue Herausforderungen
bei der Energieübertragung
Energie global
14 Organische Solarzellen und über große Entfernungen
Hybridsolarzellen
Polymerforschung für die
6 Energieversorgung Umwandlung von Solarenergie Recht & Wirtschaft
im 21. Jahrhundert
18 Fracking – vorwärts
Technische, soziale und
mit Mut zum Risiko? 34 Wettbewerb im Energiesektor
ökonomische Aspekte
Eine Abwägung aus umwelt- durch Regulierung der
wissenschaftlicher Sicht Energienetze
Europäische Erfolgsgeschichte
22 Flüssige Kraftstoffe aus CO2
und bleibende Herausforderung
und regenerativem Strom
Ein zukunftsweisender
18 Forschungsansatz zur Sicherung
38 Markt oder Staat ?
Die Energiebranche zwischen
Fracking: eine verantwortbare Technologie?
der Energieversorgung Wettbewerb und Regulierung
4 Ausgabe 2 . 2014Inhaltsverzeichnis
58
Mit dem „Energiespiel Bayern“ können sich auch
Schülerinnen und Schüler mit Fragen der Energie-
versorgung vertraut machen.
Forschung & Technik II
54 Erneuerbare Energien
im ländlichen Raum 62 Das Zentrum für
Potenziale für die regionale Energietechnik (ZET)
Wertschöpfung Von der Grundlagenforschung bis
zu neuen Produkten und Verfahren
66 Neue Wege der dezentralen
Stromerzeugung
Von der Geothermie zur
industriellen Abwärme
70 Energiegewinnung aus Biogas
Ein Beitrag zur Energiewende
74 Energieeffiziente Fabriken
Ethik
„Green Factory Bayreuth“ –
ein Beispiel für die Kooperation
von Forschung und Wirtschaft
42 Gerechtigkeit in der
78 Neue Werkstoffe steigern
Energieversorgung
die Energieeffizienz
Eine ethische Herausforderung
Innovative Entwicklungen
aus der Materialwissenschaft
86 TechnologieAllianzOberfranken
Kultur & Regionen (TAO)
70 Forschungskooperationen
46 Energietechnologien und Wohin entwickelt sich die Biogas-Technologie? in den Schwerpunktfeldern
Energiewandel in Afrika Von Anlagen wird künftig ein hohes Maß an Energie und Mobilität
Flexibilität gefordert.
Kulturelle und anthropologische
Aspekte von Innovationen
48 Elektrifizierung des Sudans Schule
Ein umstrittenes
Mega-Energieprojekt
58 Erneuerbare Energien
50 Bioenergie-Potenziale im Schulunterricht
in Ostafrika Moderne Unterrichtskonzepte 78
Entwicklungsgeographische Perspek- zu Müllverbrennungsenergie Polymerschaum aus Pflanzen – ein vielversprechen-
des Material auch für die Einsparung von Energie.
tiven künftiger Energieversorgung und Erneuerbaren Energien
Ausgabe 2 . 2014 5Energie global
Dieter Brüggemann
Andreas Jess
Energieversorgung im 21. Jahrhundert
Technische, soziale und ökonomische Aspekte
Der rasant steigende Energiebedarf in den Mega-
städten zählt zu den weltweiten Herausforderungen
im 21. Jahrhundert (Foto: Naufal MQ / Shutterstock.com).
6Der Energieverbrauch Industriestaaten (OECD) 42 Prozent, obwohl der Autoren
im weltweiten Vergleich Anteil an der Weltbevölkerung nur 18 Prozent aus-
P
macht. Entsprechend umgekehrt ist die Situation in
rimärenergie (PE) ist die Energie, die ur- Asien, Lateinamerika und besonders in Afrika. Die
sprünglich als Brennstoff (Kohle, Erdöl, Erd- Zahlen des jährlichen Pro-Kopf-Energieverbrauchs
gas, Biomasse) oder als Wasserkraft, Kernenergie, einiger Länder unterstreichen dieses Ungleich-
Wind- und Solarenergie zur Verfügung steht. Sie gewicht: In den USA liegt dieser bei 7,1 toe, in
wird durch Umwandlungsprozesse, die mit Verlus- Deutschland bei 3,7 toe, wohingegen er in China
ten behaftet sind, in Sekundärenergieträger wie und Brasilien (noch) bei 1,8 bzw. 1,4 toe, in Indien
Strom oder in Kraftstoffe wie Benzin und Dieselöl und Äthiopien bei nur 0,6 bzw. 0,4 toe liegt.
umgewandelt. Durch eine wiederum mit Verlusten
verbundene Übertragung zum Verbraucher wird
sie schließlich zur nutzbaren Endenergie. Energie und Wohlstand:
Wieviel steht jedem Menschen zu?
Prof. Dr.-Ing. Dieter Brügge-
Abbildung 1 zeigt die Anteile einzelner Primärener- mann leitet den Lehrstuhl
gieträger am deutschen sowie am weltweiten Pri- Wie hoch ist der Energieverbrauch, den jeder für Technische Thermodynamik und
Transportprozesse (LTTT) und ist Di-
märenergieverbrauch. Es wird deutlich, dass bereits Mensch für einen ausreichenden Wohlstand benö-
rektor des Zentrums für Energietech-
heute schon regenerative Energien in Deutschland tigt? Um diese Frage zu beantworten, ist der Human nik (ZET) an der Universität Bayreuth.
(mit einem Anteil von 16 Prozent) eine im weltwei- Development Index (HDI) der Vereinten Nationen
ten Vergleich (mit durchschnittlich etwa 8 Prozent) hilfreich. Es handelt sich dabei um einen Wohlstands-
deutlich größere Rolle spielen. Allerdings sind fos- indikator, der mit jeweils gleicher Gewichtung das
sile Energieträger (Erdöl, Erdgas, Kohle) derzeit Pro-Kopf-Einkommen (kaufkraftkorrigiert), die me-
immer noch die dominierenden PE-Träger (D: 76 dizinische Versorgung (Lebenserwartung) und den
Prozent, Welt: 81 Prozent). Der Rest wird durch Bildungsgrad eines Landes berücksichtigt. Bei Ent-
Kernenergie und vor allem in Entwicklungsländern wicklungsländern ist der HDI kleiner als 0,5; bei
noch durch die sogenannte traditionelle Biomasse Schwellenländern liegt er zwischen 0,5 und 0,8;
gedeckt, die zumeist mit der Abholzung bestehen- bei Industrieländern ist der HDI größer als 0,8.
der Wälder verbunden ist und daher nicht als rege-
nerativ und klimaneutral betrachtet werden kann. In Ländern, die einen HDI-Wert größer als 0,8 er-
reicht haben, liegt der jährliche PE-Verbrauch bei
Um den Energieverbrauch eines Landes oder einer mindestens etwa 2 toe pro Kopf (siehe Abb. 2). Ein
Region zu charakterisieren und Energieträger ver- höherer Verbrauch führt allerdings nicht zu einer Prof. Dr.-Ing. Andreas Jess ist
gleichen zu können, werden häufig Rohöläquiva- merklichen Steigung des HDI, also des Wohlstands Inhaber des Lehrstuhls für
Chemische Verfahrenstechnik an der
lente verwendet. 1 Tonne Erdöl (1 toe) entspricht und Wohlergehens. Dies ist ein deutlicher Hinweis Universität Bayreuth.
einer Energie von 42 Mio. kJ (Kilojoule) oder 42 GJ darauf, dass hier eine Grenze erreicht wird, von der
(Gigajoule). Der derzeitige deutsche PE-Verbrauch an eine weitere Steigerung des Energieverbrauchs
beträgt 310 Mio. toe pro Jahr; weltweit sind es nicht zu rechtfertigen ist. Regionen und Länder,
13 Mrd. toe. die einen Wert von 2 toe deutlich überschreiten
– wie etwa Nordamerika, Australien, Japan und
Der Primärenergieverbrauch ist regional sehr un- Europa, darunter auch Deutschland – sollten sich
gleich verteilt (Tabelle 1): So beträgt der Anteil daher in der Pflicht sehen, Maßnahmen für eine
am globalen Energieverbrauch der wohlhabenden noch effizientere Energienutzung zu ergreifen.
Abb. 1: Anteile einzelner Energieträger
am Primärenergieverbrauch (PEV) in
4,2 %
trad. Biomasse
Deutschland und weltweit 2013. Bei der hier
Kernenergie (7,6 %)
(6,7 %) verwendeten Substitutionsmethode wird
Erdgas Wasser (1,7 %)
angenommen, dass der Strom aus den Ener-
22,2 %
20,6 %) gieträgern, denen kein Heizwert beigemessen
werden kann (Kernkraft, Wasserkraft, Wind und
Kohle regenerativ
Biomasse (8,5 %) 6,3 % Photovoltaik) die entsprechende Stromer-
23,9 % 16,3 % 27,8 %
8,5 % zeugung in konventionellen Kraftwerken mit
einem Wirkungsgrad von rund 40 Prozent
Wind (3,9 %)
Erdöl 30,6 %
1,1 % substituiert, d.h. 1 kWh Strom = 2,5 kWh PE.
31,6 % Solar (2,2 %) 0,9 % Berechnungen (A. Jess) auf der Basis der Anga-
0,2 % ben von BP (Statistical Review of World Energy)
und der International Energy Agency (IEA).
Ausgabe 2 . 2014 7Energie Global
Anteil an der Anteil am globalen
Region
Weltbevölkerung Primärenergieverbrauch
OECD 18% 42% (1,9 toe) verbraucht. Falls die Weltbevölkerung, wie
prognostiziert, also bis zum Jahr 2050 auf 9 Mrd.
ehemalige UDSSR & 56%
5% 26% 9% Menschen ansteigt, ist davon auszugehen, dass der
nicht-OECD-Europa 4 toe pro Kopf und Jahr
globale Energieverbrauch von derzeit 13 Mrd. auf
Mittlerer Osten 3% 5% mindestens 17 Mrd. toe pro Jahr ansteigt.
Asien 52% 34%
44%
Lateinamerika 7% 74% 5%
1,1 toe pro Kopf und Jahr Grenzen des Verbrauchs fossiler
Afrika 15% 5% Energieträger: Reserven und Ressourcen
100%
Welt 100% 100% 100% Reserven eines Energieträgers sind die derzeit ge-
1,9 toe pro Kopf und Jahr
sicherten und wirtschaftlich abbaubaren Vorräte;
Ressourcen sind die zusätzlich nachgewiesenen und
vermuteten Vorräte. Abbildung 3 zeigt die entspre-
chenden Werte für die fossilen Rohstoffe Erdöl,
Erdgas und Kohle in Gigatonnen (Gt) Kohlenstoff
(C). Berücksichtigt man die derzeitigen jährlichen
Verbrauchszahlen (3,4 Gt Kohlenstoff in Form von
Erdöl, 2 Gt als Erdgas und 4 Gt als Kohle) ergeben
sich auf der Basis der Reserven sogenannte statische
Reichweiten von 53 Jahren für Erdöl, 59 Jahren für
Erdgas und 140 Jahren für Kohle. Legt man die
Ressourcen zugrunde, kommt man auf deutlich hö-
here Werte von 170 Jahren für Erdöl, 1.000 Jahren
für Erdgas und 3.000 Jahren für Kohle. Die letztge-
nannten Werte sind sicherlich viel zu optimistisch,
da man nur einen geringen Anteil der Ressourcen
wirtschaftlich und technisch nutzen können wird.
Aber die häufig zu lesende baldige Verknappung
der fossilen Energieträger ist unbegründet.
↑ Wohlergehen: Human Development Index (2012) Es gibt aber mindestens zwei andere gute Gründe,
→ jährlicher Pro-Kopf-Primärenergieverbrauch in ausgewählten Ländern in toe (2010/11) die für eine deutlich verminderten Verbrauch fos-
siler Energien sprechen:
Tabelle 1: Regionale Verteilung des glo- Eine deutliche Senkung des Energieverbrauchs in
balen Primärenergieverbrauchs (2011). den Industrieländern ist auch deshalb angezeigt, Die Reserven von Erdöl und Erdgas konzen-
Daten: International Energy Agency (IEA), Key
World Energy Statistics 2013. weil zu erwarten ist, dass der Wohlstand in einigen trieren sich auf wenige Regionen (vor allem
Entwicklungs- und Schwellenländern – zum Bei- Mittlerer Osten, Russland), die aus europäi-
Abb. 2: Wohlergehen im Verhältnis zum spiel in China, Indien oder Brasilien – in den kom- scher Sicht politisch problematisch sind oder
jährlichen Pro-Kopf-Primärenergiever-
menden Jahrzehnten steigen wird. Abbildung 2 werden können.
brauch. Um den Maximalwert 1 zu erreichen,
wäre eine Lebenserwartung von 84 Jahren, zeigt zwei bemerkenswerte Ausnahmen vom (ge- Vermutlich weitaus bedeutsamer sind die von
eine durchschnittliche Bildungs-/Schulbe- strichelt angedeuteten) Trend: Sowohl Russland der Mehrzahl der Klimaexperten prognostizier-
suchsdauer von 13 Jahren und ein jährliches
(und auch andere Länder der ehemaligen UdSSR) ten Folgen eines gleichbleibend hohen Anteils
Pro-Kopf-Bruttonationaleinkommen von
87.000 Dollar erforderlich; alle drei Faktoren als auch Südafrika haben einen im Vergleich zum fossiler Energieträger am globalen PE-Ver-
werden gleich gewichtet. HDI-Daten aus: Uni- Wohlergehen (HDI < 0,8) besonders hohen jähr- brauch: Die in Form von Kohlendioxid gebun-
ted Nations Development Programme (UNDP),
lichen Pro-Kopf-Energieverbrauch von rund 3 bzw. dene Masse an Kohlenstoff in der Erdatmo-
Human Development Report 2013.
5 toe, also eine geringe Energieeffizienz. sphäre liegt derzeit bei 850 Gt (Abb. 3). Ohne
eine drastische Senkung dieses fossilen Anteils
Ungeachtet einer gewissen Streubreite lässt sich aus wird diese im Jahr 2050 bei über 1.000 Gt lie-
Abbildung 2 eines klar entnehmen: Es scheint ein gen. Die Folge wäre – so die Prognosen des
Verbrauch von ungefähr 2 toe/Jahr für einen ausrei- International Panel of Climate Change (IPCC)
chenden Lebensstandard erforderlich zu sein. Inter- – eine Erhöhung der globalen Mitteltempe-
essanterweise entspricht dieser Wert ungefähr dem ratur um 2°C gegenüber dem Beginn der in-
Wert, den im weltweiten Durchschnitt jeder Mensch dustriellen Revolution im 18. Jahrhundert. Um
8 Ausgabe 2 . 2014Energie Global
die Klimaerwärmung zumindest langfristig zu Reserven (gesicherte, Ressourcen (zusätzlich Abb. 3: Reserven und
derzeit wirtschaftlich nachgewiesene und Ressourcen fossiler
begrenzen, wird daher eine möglichst weitge-
abbaubare Vorräte) in Gt C vermutete Vorräte) in Gt C Energieträger. Eigene
hende Umstellung von fossilen hin zu alterna- Berechnungen (A. Jess) auf
tiven Energieträgern angestrebt. der Basis der Angaben von
Schaub, G., Turek, T.: Energy
flows, material cycles and
global development. Sprin-
Energiepolitische Entscheidungen ger, Heidelberg, 2011, und
von anderen Quellen.
im internationalen Vergleich
Die meisten Staaten stimmen den genannten
Zielen zwar grundsätzlich zu, unternehmen aber
sehr unterschiedliche Anstrengungen, um diese
zu erreichen. Dies sollte nicht überraschen, denn
bereits die Ausgangslage, also der bisherige An-
teil der erneuerbaren im Vergleich zu fossilen und
nuklearen Energien ist sehr unterschiedlich. Dies
hängt zum Teil mit natürlichen Gegebenheiten
Abb. 4: Zeitliche
(z.B. Wasserkraft) zusammen und ist zum Teil auf Entwicklung der
die unterschiedliche gesellschaftliche Akzeptanz Anteile fossiler, nuklearer
energiepolitischer Entscheidungen (z.B. Kernener- und regenerativer Energien
am Primärenergieverbrauch
gie) zurückzuführen. ausgewählter Staaten von
1965 bis heute (Kreis) in
Solche Unterschiede werden in Abbildung 4 sicht- 5-Jahresschritten (Punkte).
Die Eckpunkte im Dreiecks-
bar, in der die Wege ausgewählter Staaten im Ener- diagramm stehen jeweils
giemix dargestellt sind. So erkennt man, dass die für 100 Prozent fossile,
deutsche „Energiewende“ tatsächlich zu einer drasti- nukleare und regenerative
Energien. Für Deutschland
schen Änderung geführt hat und nach Beschlusslage ist zudem ein Trendszenario
weiter führen wird (gestrichelter Verlauf), während bis 2050 dargestellt. Daten:
z.B. die USA sich deutlich weniger verändert haben. BP 2014; Prognos/EWI/GWS
2014; Umrechnung gemäß
Substitutionsmethode (vgl.
dazu Abb. 1).
Werden wir energieeffizienter?
Ein Schlüssel zur weiteren positiven Entwicklung der
Energiesituation liegt zweifellos in der Erhöhung der
Energieeffizienz in allen Bereichen. Tabelle 2 zeigt
sehr deutlich, dass wir im Wesentlichen durch tech-
nische Entwicklungen bereits erhebliche Fortschritte
erzielt haben. Es ist noch unklar, ob auch in privaten Kann man ein Fazit ziehen?
Haushalten und im straßengebundenen Individual- Stromerzeugung
– 10,7%
verkehr Änderungen des Nutzerverhaltens eine grö- Die Energieversorgung bei weltweit wachsendem (kWh Strom)
ßere Rolle spielen werden. Bedarf ist eine wichtige Frage und wird dies auch Stromverbrauch
noch lange Zeit bleiben. Sie ist nicht allein tech- – 10,9%
(E Bruttoinlandsprodukt)
Häufig allerdings werden Effizienzsteigerungen, nisch zu lösen, sondern erfordert die Einbeziehung
vieler weiterer Aspekte. Diese sind unter Anderem Industrie
die durch technischen Fortschritt erreicht wurden, – 19,3%
(E Bruttoproduktionswert)
überdeckt; und zwar dadurch, dass zugleich höhere wirtschaftlicher Natur (Energie muss bezahlbar sein),
Anforderungen an die Leistung gestellt werden. Ein politisch bedingt (z.B. Abhängigkeiten von anderen Gewerbe, Handel und
Beispiel hierfür bietet der Pkw: Der Antrieb unserer Staaten), aber auch ethisch motiviert (z.B. wachsen- Dienstleistungen – 33,3%
Autos ist heute sehr viel effizienter als vor drei, vier der Energiebedarf für einen globalen Wohlstand). (E Bruttowertschöpfung)
oder fünf Jahrzehnten. Allerdings ist das heutige Private Haushalte
Durchschnittsfahrzeug auch deutlich leistungsstär- – 24,0%
(m2 Wohnfläche)
ker, schwerer und mit zahlreichen Komponenten für Tabelle 2: Der Energieverbrauch in Relation zu den
in Klammern angegebenen Bezugsgrößen ist in Verkehr
Sicherheit und Komfort ausgestattet, was die mögli- – 32,0%
Deutschland zwischen 1990 und 2012 deutlich gesunken (Tonnen- und Personen-km)
che Kraftstoffeinsparung kompensiert. (Daten: BMWi 2014).
Ausgabe 2 . 2014 9Forschung & Technik I
Jürgen Köhler
Die Natur
als Vorbild:
Licht sammeln
und verwerten
Grundlagenforschung
für neue Wege der
Energieerzeugung
Wie lässt sich die Energie des Sonnenlichts möglichst
effizient in elektrische oder chemische Energie
umwandeln und verwerten? Pflanzen und Bakterien liefern
dafür wertvolle Anhaltspunkte (sst).D
synthese sehr erfolgreich vor. Pflanzen, Algen und Autor
ie Energiemenge, die während einer Stun- einige Bakteriengruppen sind in der Lage, Sonnen-
de von der Sonne auf die Erde einstrahlt, strahlung unter den unterschiedlichsten Lebensbe-
entspricht in etwa der Energiemenge, die von der dingungen einzufangen und umzusetzen.
gesamten Menschheit im Verlauf eines Jahres ver-
braucht wird. Wenn man sich dies vor Augen führt, Wenn ein Molekül eines für Solarzellen geeigneten
dann wundert es nicht, dass beim Umbau der organischen Materials ein Lichtteilchen (Photon)
Energiewirtschaft Solarzellen eine wichtige Rolle absorbiert, übernimmt es die Energie des Photons.
spielen. Jedoch sind die heute üblichen Photovol- Dadurch gerät es in einen angeregten Zustand.
taikanlagen, die aus hochreinen Halbleitermateria- Leider findet ein solcher Absorptionsvorgang un-
lien bestehen, sehr rohstoff- und energieintensiv in ter normaler Sonneneinstrahlung nur ca. 1-mal
der Herstellung. Daher sind sie gerade für Entwick- pro Sekunde pro Molekül statt – viel zu selten, um
lungsländer, in denen oft sehr viel Sonnenlicht zur eine effiziente Energieversorgung zu gewährleis-
Verfügung stehen würde, unerschwinglich. ten. Die Zahl der Photonen, die von der Sonne zur
Erde gelangen, ist zwar unvorstellbar groß, doch Prof. Dr. Jürgen Köhler ist
sind die Moleküle auch unvorstellbar klein, so dass Inhaber des Lehrstuhls für
Experimentalphysik IV und Sprecher
sich beide Effekte kompensieren.
des Graduiertenkollegs 1640 „Photo-
physik synthetischer und biologi-
„Können wir scher multichromophorer Systeme“
an der Universität Bayreuth.
„Lichternte“ in der Natur
von der Natur lernen,
Energie aus Licht Bei der Photosynthese hat die Natur dieses Prob-
lem gelöst, indem sie Light Harvesting (Lichternte)
zu gewinnen?“ betreibt und das Licht in speziellen Strukturen sam-
melt. Eine Schlüsselfunktion haben dabei Proteine, Abb. 1 und 2: Gleichartige Probleme,
gleichartige Lösungen. Links: Para-
die als „Licht-Antennen“ fungieren; sie werden da- bolspiegel (Antenne) zur Sammlung von
Große Hoffnungen setzt man deshalb auf Solarzel- her auch als Antennenproteine bezeichnet. Jedes Sonnenstrahlung für die Erwärmung von
len der nächsten Generation, die aus organischen dieser Proteine enthält eine Vielzahl von Farbstoff- Wasser. Rechts: Mutmaßliche Anordnung
von Pigment-Protein-Komplexen (Antennen-
Materialien aufgebaut sind. Dass organische Mate- molekülen (Pigmenten). Die Farbstoffmoleküle proteinen) in der Membran von photosyn-
rie zu diesem Zweck durchaus geeignet ist, macht nehmen Lichtenergie auf und übertragen diese mit thetischen Bakterien. Die grün markierten
uns die Natur seit Jahrmilliarden mit der Photo- extrem hoher Geschwindigkeit auf benachbarte Strukturen enthalten zahlreiche Pigmente,
die die Funktion haben, Licht zu absorbieren.
Die aufgenommene Energie wird in die Mitte
zur rot markierten Struktur geleitet, wo eine
Ladungstrennung ausgelöst wird.
Ausgabe 2 . 2014 11Forschung & Technik I
Farbstoffmoleküle: zunächst auf Moleküle inner-
halb desselben Antennenproteins, dann auf Mole-
Grundlagenforschung für Solarzellen der Zukunft: küle in einem angrenzenden Antennenprotein. So
durchläuft die absorbierte Lichtenergie eine Kette
ein DFG-gefördertes Graduiertenkolleg mehrerer Antennenproteine, bis sie schließlich in
einem Reaktionszentrum ankommt. Hier werden
die Prozesse der Photosynthese in Gang gesetzt,
die aus der Lichtenergie chemische Energie erzeu-
gen.
Mit dieser Arbeitsteilung zwischen den „Licht-
Antennen“ und einem Reaktionszentrum gelingt
es Pflanzen und einigen Bakterienarten, die Ener-
gie des Sonnenlichts, dem sie in der Natur aus-
gesetzt sind, in chemische Energie zu verwandeln.
Gegenstand aktueller Forschung ist die Frage, ob
die Prozesse der Sammlung und Verwertung von
Licht, wie sie in Pflanzen und Bakterien ablaufen,
als Blaupause für neue Formen der Energiegewin-
nung dienen können.
In einer gemeinsamen Initiative, dem Graduiertenkolleg 1640, arbeiten seit Oktober 2010 zahl-
reiche Bayreuther Forschungsgruppen aus der Bioinformatik, der Chemie und der Physik zum
Experimentell kann man solche Vorgänge mit den
Thema „Photophysik synthetischer und biologischer multichromophorer Systeme“. Als Chro-
verschiedensten Methoden der Laserspektrosko-
mophore bezeichnet man Moleküle, die in Wechselwirkung mit Licht treten können – also ge-
pie untersuchen. Dazu muss man wissen, dass die
nau solche Moleküle, wie sie für die Entwicklung von Solarzellen der nächsten Generation rele-
oben beschriebenen Energie- und Ladungstrans-
vant sind. Der Weg hin zur Entwicklung von Solarmodulen aus organischen Materialien ist noch
ferprozesse auf einer ultraschnellen Zeitskala von
sehr weit. Es bedarf der interdisziplinären Grundlagenforschung, wie sie in Bayreuth betrieben
einigen Pikosekunden ablaufen. Daher kommen
wird, um das komplexe Zusammenspiel der zugrunde liegenden Prozesse zu entschlüsseln.
hier spezielle Laser zum Einsatz, die ultrakurze Im-
pulse aussenden können. Eine Pikosekunde ist eine
Diese Initiative wurde bisher von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit rund 3,1 Mio.
Billionstel Sekunde (10-12 s). In dieser Zeit legt ein
Euro gefördert. Eingebettet in die hervorragende Forschungsinfrastruktur an der Universität
Lichtstrahl eine Strecke von nur 0,3 mm zurück.
Bayreuth, bietet sie derzeit 25 jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein interdis-
Zum Vergleich: Vom Mond bis zur Erde benötigt
ziplinäres Ausbildungsprogramm und vermittelt Schlüsselqualifikationen jenseits des natur-
ein Lichtstrahl nur unwesentlich länger als eine Se-
wissenschaftlichen Fachwissens. Bislang sind rund 70 Publikationen in renommierten, interna-
kunde.
tional begutachteten Fachzeitschriften daraus hervorgegangen.
• www.multichromophores.uni-bayreuth.de
Abb. 3: Laserspektroskopie in einem
Physiklabor der Universität Bayreuth.
12 Ausgabe 2 . 2014Forschung & Technik I
Interdisziplinäre Zusammenarbeit
in der Forschung zur Solarenergie
Neue Einsichten in den Energietransport
An der Universität Bayreuth werden aber nicht nur
biologische Systeme untersucht, um aus pflanzli- Dr. Richard Hildner, der heute an der Universität Bayreuth forscht,
chen Lichtsammelprozessen neue Erkenntnisse für hat während seiner Zeit als Postdoktorand am Institute for Photo-
den Bau organischer Solarzellen abzuleiten. Es nic Sciences (ICFO) in Casteldefels (Spanien) überraschende Ent-
werden ebenso auch Lichtsammelprozesse in che- deckungen gemacht:
misch synthetisierten Systemen erforscht und da-
raufhin getestet, ob man aus ihnen einfache und Wenn Lichtenergie ihren Weg durch die Antennenmoleküle bis
zugleich kostengünstige Solarzellen bauen kann. zum Reaktionszentrum nimmt, arbeiten die Farbstoffmolekü-
Dabei kann es sehr aufwändig sein, Moleküle mit le in einem gleichmäßigen Takt: ein Phänomen, das die Physik
den geforderten Eigenschaften im Labor herzustel- als quantenmechanisch kohärenten Transport bezeichnet. Auf Dr. Richard Hildner ist
len und anschließend zu erproben. Eine alternative diese Weise kann sich die Energie wie eine Welle ungehindert für seine herausra-
durch ein Antennenprotein bewegen. genden Forschungsarbeiten
Vorgehensweise besteht darin, gewisse Eigenschaf- mit dem Wissenschaftspreis
ten von Molekülgruppen theoretisch – sozusagen Die Lichtenergie durchläuft keineswegs immer die gleichen 2014 des Universitätsver-
am Reißbrett – zu untersuchen und dann gezielt Ketten von Farbstoffmolekülen auf ihrem Weg durch die An- eins Bayreuth ausgezeich-
tennenproteine. Die Transportwege ändern sich ständig. net worden. 2013 erhielt
Voraussagen über deren Eignung zu treffen. er den Sturge Prize, eine
bedeutende Auszeichnung
Daher berühren sich Forschungsarbeiten zum Light Variabilität der Transportwege und Kohärenz – diese Kombination für den wissenschaftlichen
ist für den Energietransport in Pflanzen und Bakterien charakte- Nachwuchs auf dem Gebiet
Harvesting, das in Pflanzen und Bakterien abläuft, der Physik.
mit neuen Projekten in der Polymerwissenschaft, ristisch.
die auf die Konzeption hocheffizienter Solarzel-
len abzielen.1 Insgesamt sind an der Universität Wie sich bei diesen Forschungsarbeiten herausstellte, erfüllt
Bayreuth verschiedene Arbeitsgruppen aus der diese Kombination einen biologischen Zweck: Die Energie findet
Physik und der Chemie mit Lichtsammelprozessen immer den jeweils günstigsten Pfad durch ein Antennenprotein.
befasst. Einige sind dabei eher in der Grundlagen- Dies trägt wesentlich dazu bei, dass der Transport der Lichtenergie
forschung angesiedelt, andere interessieren sich auch dann effizient verläuft, wenn sich bestimmte Voraussetzun-
stärker für konkrete technische Anwendungen. Das gen ändern – sei es, dass die Temperatur schwankt; sei es, dass sich
gemeinsame Ziel ist es, möglichst genau zu verste- die innere Struktur der Antennenproteine ändert.
hen, welche Vorgänge in Lichtsammelstrukturen
ablaufen und wie diese von den Eigenschaften der
1 Im folgenden Beitrag von Prof. Dr. Mukundan
verwendeten Moleküle abhängen.
Thelakkat werden einige dieser Forschungsar-
beiten an der Universität Bayreuth vorgestellt.
Internationale Konferenzreihe: „Lichternte“ auf Kloster Banz
Forschung auf dem Gebiet des Light Harvesting lebt von der
Zusammenarbeit von Fachleuten aus unterschiedlichen Diszi-
plinen, insbesondere der Biologie, Chemie und Physik, und vom
wechselseitigen Austausch neuer Forschungsideen und -kon-
zepte. Zu diesem Zweck veranstalten Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler, die an der Universität Bayreuth zu Fragen der
Energiegewinnung aus Licht arbeiten, regelmäßig eine internati-
onale Konferenz. Sie findet seit 2007 im Zweijahresrhythmus un-
ter dem Leitthema „Light-Harvesting Processes (LHP)“ auf Kloster
Banz statt. Mehr als hundert Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus allen Kontinenten nehmen jedesmal daran teil.
• Termin für das nächste Treffen: 8. bis 12. März 2015
Kloster Banz bei Bad Staffelstein.
• Weitere Informationen: www.lhp-bayreuth.de Foto: Simon Koopmann, CC-BY-SA-2.0-DE
Ausgabe 2 . 2014 13Forschung & Technik I
Mukundan Thelakkat
Organische Solarzellen
und Hybridsolarzellen
Polymerforschung für die Umwandlung von Solarenergie
Organische Photovoltaikzellen auf bedruck-
ten Folien werden im Rahmen des europäi-
schen Projekts LARGECELLS im Freien getestet.
14W
Abb. 1: Auch im indischen Bangalore
wurden Module gedruckter organischer
enn es um die effiziente und kosten-
Photovoltaikzellen getestet. Hier: Aufbau
günstige Erzeugung von Solarstrom eines Experiments.
geht, gibt es heute vielversprechende Alternativen
zu klassischen Siliziumzellen: Organische Solarzellen
aus Kunststoff und Hybridsolarzellen, die im groß-
flächigen Format mit so genannten „Roll to Roll“-
Druckverfahren (R2R) hergestellt werden können.
Unter Hybridsolarzellen versteht man die Verwen-
dung einer Kombination von anorganischen und
organischen Halbleitermaterialien. An diesen zu-
kunftsweisenden Technologien war und ist die Uni-
versität Bayreuth mit mehreren Projekten beteiligt.
Autor
LARGECELLS –
ein europäisch-indisches Projekt
Organische Photovoltaikzellen (OPV), die aus
Kunststoff bestehen, eignen sich ideal für die An-
wendung auf Textilien oder im Bauwesen, da sie
sehr leicht, flexibel und großflächig einsetzbar
sind. Damit diese OPV-Zellen wettbewerbsfähiger
werden, müssen sie eine noch höhere Energieef- innovative Ideen, tragfähige neue Konzepte und
fizienz und Lebensdauer aufweisen. Zudem ist es Forschungskooperationen, die von Synergie-Effek-
erforderlich, dass großflächige Module mittels op- ten erheblich profitierten.
timierter „Roll to Roll“-Druckverfahren hergestellt
werden, um die Produktionskosten zu senken. Um die Energieeffizienz der OPV-Zellen zu erhöhen, Prof. Dr. Mukundan Thelakkat
haben die an LARGECELLS beteiligten Wissenschaft- leitet die Arbeitsgruppe „An-
Diesen Herausforderungen stellt sich das Projekt lerinnen und Wissenschaftler neue, für Solarzellen gewandte Funktionspolymere“ am
Lehrstuhl Makromolekulare Chemie I
LARGECELLS, das im September 2010 an den Start besonders geeignete polymere Funktionsmateriali- (Leitung: Prof. Dr. Hans-Werner
ging. Im Rahmen des 7. Forschungsrahmenpro- en hergestellt. Vor allem durch die Synthese licht- Schmidt).
gramms der Europäischen Union wurde das ge- absorbierender Donormaterialien ist es gelungen,
meinsame Projekt mit Indien über vier Jahre mit eine höhere Effizienz in der Energieumwandlung zu
1,64 Mio. Euro gefördert. An dem von Prof. Dr. erreichen. Der Wirkungsgrad der Solarzellen, d.h.
Mukundan Thelakkat geleiteten Konsortium der das in Prozent dargestellte Verhältnis von erzeugter
EU waren zusammen mit der Universität Bayreuth elektrischer Energie zur einfallenden Lichtenergie,
auch die TU Eindhoven (Niederlande), Dänemarks konnte so bedeutend gesteigert werden.
Technische Universität (DTU) und die Ben-Gurion
Universität (Israel) beteiligt. Das indische Konsor- Insbesondere wurde im Rahmen von LARGECELLS Abb. 2: Mit organischen
tium hingegen wurde separat vom Department Photovoltaikzellen
ein Polymer auf der Basis eines Diketopyrrolopyr-
bedruckte Folie.
of Science and Technology – einer Abteilung im rols entwickelt. Es handelt sich hierbei um den
indischen Wissenschaftsministerium – gefördert. Farbstoff, dem Ferraris ihre rote Farbe verdanken.
Insgesamt nahmen fünf hochkarätige wissenschaft- Im Labor konnte damit ein Wirkungsgrad von 7,4
liche Institutionen aus Indien teil, die bei der Erfor- Prozent erzielt werden. Durch die Realisierung von
schung neuer Materialien für Solarzellen und bei übergeordneten Solarzellen, die zwei oder mehr
deren Erprobung im Freien sehr eng mit ihren EU- Solarzellen aus verschiedenen Materialien enthal-
Partnern kooperierten. Darüber hinaus entwickelte ten, ließ sich der Wirkungsgrad auf 8,9 Prozent
sich ein lebhafter Austausch sowohl von Wissen- (bei Tandem-Zellen) bzw. auf 9,6 Prozent (bei
schaftlerinnen und Wissenschaftlern als auch auf Triple-Zellen) steigern. Außerdem erreichte das
der Ebene der Studierenden. Einige Studierende Projekt einen Wirkungsgrad von rund 4 Prozent
aus Indien bzw. der EU haben Forschungsaufent- bei R2R-gedruckten großflächigen flexiblen Solar-
halte von bis zu drei Monaten an den jeweiligen zellen, die ohne das relativ teure Indiumzinnoxid
Partnerinstitutionen absolviert. So entstanden (indium tin oxide, ITO) auskommen.
Ausgabe 2 . 2014 15Forschung & Technik I
Die Steigerung der Energieeffizienz war aber nur satz der Nanotechnologie. Gemeinsam wollen sie
ein Aspekt von LARGECELLS. Die Forschungsarbei- umweltschonende Anwendungen entwickeln, und
ten zielten zugleich darauf ab, die Lebensdauer der zwar in den drei Schwerpunkten „Organische Pho-
Solarmodule zu erhöhen. Um die Langzeitstabili- tovoltaik“, „Energiespeicher“ und „Thermoelektrizi-
tät der neuen OPV-Zellen zu testen, wurden diese tät“. Im Rahmen dieses Projektverbunds, den der
Module verschiedenen Testszenarien unterzogen Freistaat Bayern mit knapp drei Millionen Euro
– nicht nur im Labor, sondern auch im Freien, wo finanziert, starteten zehn Einzelprojekte im Jahr
zu Testzwecken eine künstliche beschleunigte Alte- 2013.
rung der OPV-Zellen herbeigeführt wurde. Insge-
samt wurden die neuen OPV-Solarmodule 9.000 Eines dieser Projekte ist an der Universität Bay-
Stunden lang in Outdoor-Anlagen getestet. Die Er- reuth angesiedelt.1 Es zielt darauf ab, die Ver-
gebnisse dieser Tests werden die weitere Entwick- träglichkeit von Komponenten für die organische
lung optimierter Trägermaterialien unterstützen. Photovoltaik zu verbessern. Es befasst sich insbe-
sondere mit leicht verfügbaren und unbedenkli-
chen Stoffen, die es ermöglichen, auf den großflä-
UMWELTnanoTECH – chigen Einsatz ressourcen- und energieintensiver
ein Bayerischer Projektverbund Materialien zu verzichten. Zu diesem Zweck sollen
Abb. 3: Chemische Synthese und Reini- Nanostrukturen in organischen Solarzellen und
gung von Materialien in einem Labor Unter dem Dach des Bayerischen Projektverbunds Hybridsolarzellen kontrolliert und damit deren
der Universität Bayreuth.
„Umweltverträgliche Anwendungen der Nano- Wirkungsgrad und Langzeitstabilität erhöht wer-
technologie“ (UMWELTnanoTECH) – arbeiten den. Von besonderem Interesse ist dabei die um-
Hochschulen und Forschungsinstitute bayernweit weltverträgliche Verarbeitung aus nicht-chlorier-
an Projekten zum verantwortungsbewussten Ein- ten Lösungsmitteln.
Blick ins Innere einer organischen Solarzelle Exzitone haben eine äußerst kurze Lebensdauer.
Deshalb wäre es vorteilhaft, wenn sie bis zur D-A-
Im Gegensatz zu anorganischen Halbleitern wer- Grenzfläche einen möglichst kurzen Weg zurückle-
den in organischen Halbleitermaterialien unter gen müssen. Der Weg ist umso kürzer, je dünner die
Beleuchtung keine freien Ladungsträger erzeugt, Absorptionsschicht der Solarzelle ist. Doch damit die
sondern Elektronen-Loch-Paare. Ein solches Paar Solarzelle viel Lichtenergie absorbieren kann, muss die
besteht aus einem Elektron, das sich aufgrund Absorptionsschicht umgekehrt möglichst dick sein.
der Absorption von Energie in einem angeregten Um dieses Dilemma zu lösen, wurden neuartige Solar-
Zustand befindet, und einer Elektronenfehlstelle zellen entwickelt, die auf der Nanostrukturierung der
(Loch). Die Elektronen-Loch-Paare – sie werden in D-A-Absorptionsschicht beruhen: die Multischicht-
der Forschung als Exzitonen bezeichnet – müssen solarzelle und die Polymerblendsolarzelle: Letzere er-
getrennt und ihre Bestandteile zu den Elektroden hält man durch die Mischung des Donormaterials (D)
der Solarzellen abtransportiert werden. Nur dann und des Akzeptormaterials (A). Um die Polymerblend-
können organische Solarzellen effizient arbeiten. solarzelle optimal weiterzuentwickeln, müssen stabile
Nanostrukturen – wie z.B. in einem D-A-Blockcopoly-
Damit die Exzitonen getrennt werden, müssen sie mer (Abb. 4) – vertikal ausgerichtet werden.
innerhalb der Solarzelle auf eine Grenzfläche tref-
fen, die aus zwei Materialkomponenten besteht: Alle diese Solarzellentypen können im großflächigen
einem elektronenreichen Donormaterial (D) und Abb 4: Verschiedene Architekturen der Format mittels „Roll to Roll“-Druckverfahren herge-
einem elektronenarmen Akzeptormaterial (A). In photoaktiven Schicht dienen der Erzeugung stellt werden. Die Arbeitsgruppe „Angewandte Funk-
von D-A-Grenzflächen für die Ladungstrennung.
der Regel wird ein langkettiges Halbleiterpolymer tionspolymere“ an der Universität Bayreuth widmet
als Donor und ein Fulleren-Derivat als Akzeptor ver- sich unterschiedlichen Aspekten dieser zukunftswei-
wendet. Aber das Fulleren-Derivat kann auch beliebig mit anorganischen senden Technologie. Dabei werden neue Materialien synthetisiert, völlig
Halbleitermaterialien ersetzt werden; in diesem Fall spricht man von einer neue Konzepte zu Donor-Akzeptor-Solarzellen entwickelt und die Nano-
Hybridsolarzelle. strukturbildung und -stabilisierung in diesen Systemen erforscht.
16 Ausgabe 2 . 2014Forschung & Technik I
Abb. 5: Schematischer Aufbau einer
Hybrid-Perowskitsolarzelle (links) und
Querschnitt einer solchen Solarzelle in einer
rasterelektronenmikroskopischen Aufnahme
(rechts).
SolTech – Ein Highlight aus diesem Keylab ist die rasante
ein Verbund bayerischer Universitäten Entwicklung von hocheffizienten Hybrid-Perows-
kitsolarzellen. In der Regel besteht eine Perowskit-
Im Projekt „Solar Technologies go Hybrid“ (Sol- Solarzelle aus einem bleihaltigen anorganischen
Tech), das 2012 an den Start ging, kooperieren fünf Halbleitersalz (Perowskit: CH3NH3PbI3) und ei-
bayerische Universitäten: die Universität Bayreuth, nem organischen Lochleiter (Spiro-OMeTAD)
die FAU Erlangen-Nürnberg, die LMU München, im Schichtaufbau (Abb. 4). Auf diesem Gebiet
die TU München und die Universität Würzburg. Ge- wurden in den letzten zwei Jahren bedeutsame
meinsam und interdisziplinär wollen sie die Grund- Fortschritte bezüglich der Effizienz erzielt. Der
lagenforschung auf dem Gebiet der Umwandlung Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Mukundan Thelak-
von Solaranergie in elektrischen Strom oder in kat gelang es im Jahr 2014, einen Wirkungsgrad
transportable und lagerbare Brennstoffe vorantrei- von rund 15 Prozent zu erreichen. Ein wichtiges
ben. Mit diesem Ziel haben sich die Projektpartner Ziel der Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet ist
in fünf „Key Labs“ organisiert, die auf die Expertise es zudem, das toxische Element Blei durch nicht-
der einzelnen Universitäten spezialisiert sind: toxische Substanzen zu ersetzen und die Lebens-
dauer der neuen Hybrid-Perowskitsolarzellen zu
Bayreuth: Makromolekulare Materialien erhöhen. Anknüpfend an die vielversprechenden
Erlangen: Kohlenstoffreiche Hybride Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet, startete
LMU München: Anorganische und hybride 2014 ein vom Bundesministerium für Bildung und
Nanosysteme Forschung (BMBF) gefördertes Forschungsprojekt,
TU München: Hybridsysteme mit Nanomate- das sich mit technologierelevanten Fragen in
rialien Bezug auf Hybrid-Perowskitsolarzellen befassen
Würzburg: Supramolekulare Materialien für wird. Eine Forschungsgruppe an der Universität
Photovoltaik und Photokatalyse Bayreuth 3 ist in dieses – vom Fraunhofer-Institut
für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg koordi-
Die Forschung des am Bayreuther Institut für Ma- nierte – Vorhaben eingebunden.
kromolekülforschung (BIMF) angesiedelten Key
Labs „Makromolekulare Materialien“ umfasst:
Weitere Projekte
1) das Design und die Synthese von Funktions-
materialien/Polymeren Zusätzlich zu den genannten Solarzell-Forschungs-
2) grundlegende physikalische Untersuchungen vorhaben arbeiten mehrere Arbeitsgruppen aus
Linktipps
zur Photophysik sowie zum Energie- und La- der Chemie und der Physik an der Universität
dungstransport Bayreuth in grundlagenorientierten Verbundpro- • www.largecells.eu
3) die theoretische Behandlung dieser Prozesse jekten. So ist das Graduiertenkolleg 1640 „Pho- • www.soltech-go-hybrid.de
in Modellen und realen Systemen tophysik synthetischer und biologischer multi-
4) die Herstellung von Bauelementen und deren chromophorer Systeme“ auf die Photophysik von
Charakterisierung Ladungstransfer und -transport in unterschiedli-
chen Materialien spezialisiert. Die plasmonische
1 Die Leitung liegt bei Prof. Dr. Mukundan Thelakkat.
Am Bayreuther Keylab sind sechs Arbeitsgruppen Lichteinkopplung in Hybridsolarzellen ist wie-
2 Diese Arbeitsgruppen werden geleitet von Prof. Dr.
der Universität Bayreuth beteiligt.2 Zusätzlich wur- derum eine wichtige Frage des DFG-Sonderfor- Anna Köhler, Prof. Dr. Jürgen Köhler, Prof. Dr. Stefan
de hier eine Juniorprofessur (Prof. Dr. Sven Hütt- schungsbereichs 840 „Von partikulären Nanosys- Kümmel, Prof. Dr. Hans-Werner Schmidt, Prof. Dr.
temen zur Mesotechnologie“ auf dem Gebiet der Peter Strohriegl und Prof. Dr. Mukundan Thelakkat.
ner) im Rahmen des Verbundprojekts SolTech neu
3 Auch dieses Projekt wird von Prof. Dr. Mukundan
eingerichtet. Solarenergieforschung. Thelakkat geleitet.
Ausgabe 2 . 2014 17Forschung & Technik I
Stefan Peiffer
Fracking –
vorwärts
mit Mut
zum Risiko ?
Eine Abwägung aus umwelt-
wissenschaftlicher Sicht
Fracking im Kern County in Kalifornien: Mit einer
Tiefpumpe wird das Erdöl, wenn der natürliche
Lagerstättendruck nicht ausreicht, zutage gefördert
(Foto: Christopher Halloran / Shutterstock.com).„F
das notorische Beschwichtigen seitens interessierter
racking“, ein Begriff mit hohem emotiona- Kreise auf den Plan, wonach die Einwände schon
len Inhalt, vergleichbar mit Hochspannungs- bekannt und das Fracking mittlerweile eine bereits
Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) oder Atomkraft, eingespielte Technik sei, die sich aus Sicht des Um-
der in der Bevölkerung in höchstem Maße Unruhe weltschutzes gut beherrschen lasse.
erzeugt. Im Raum Bayreuth hat dieses Schlagwort
noch dazu eine regionale Komponente, seit eine Doch auch wenn tatsächliche oder potenzielle öko-
britische Firma beim Bayerischen Wirtschaftsmi- logische Folgen im einzelnen hochumstritten sind, „Fracking beinhaltet
nisterium den Antrag gestellt hat, den Untergrund gibt es jedoch keinen Zweifel: Fracking beinhaltet
der nördlichen Oberpfalz im Hinblick auf die Ge- eine Vielzahl von Umweltrisiken, die Experten aus
eine Vielzahl von
winnung von Öl und Gas zu erkunden. Da eine den USA in einem hervorragenden Überblicksauf- Umweltrisiken.“
herkömmliche Förderung im Raum Weiden nicht satz 2 ausführlich zusammengefasst haben. Daher
möglich ist, liegt der Schluss nahe, dass es sich soll es im folgenden darum gehen, das Fracking
um eine Exploration in Bezug auf eine sogenann- aus der Sicht eines „Umweltnaturwissenschaftlers
te unkonventionelle Nutzung von Schiefergas und mit hydrologischer Brille“ kritisch zu erörtern.
Erdöl handelt. Diese Nutzung wird in der Regel
durch ein hydraulisches Aufbrechen des gas- und
ölführenden Gesteins ermöglicht – also durch das Einpressen von Chemikalien
hydraulic fracturing oder kurz fracking. in tiefe Gesteinsschichten
Bei der sogenannten unkonventionellen Gas- und
Eine boomende Technologie Ölförderung durch Fracking werden spezielle Flüs-
mit ökologischen Risiken sigkeiten (Fracfluide) entlang von zementierten
Bohrlöchern in die Lagerstätten gepumpt. Sie ent-
Über den technischen Ablauf des Frackings kann halten Stützmittel und/oder chemische Zusätze,
man sich mittlerweile im Internet einen vorzügli- die benötigt werden, um den Untergrund „auf-
chen Überblick verschaffen.1 Die Technologie wird zubrechen“ und die entstandenen Risse zu stabi-
seit Ende der 1940er Jahre, auch in Deutschland, lisieren.3 Aus dem aufgebrochenen Gestein kann
in unterschiedlichen Zusammenhängen eingesetzt: darin eingepresstes Gas entweichen und gefördert
werden. Die Lagerstätten befinden sich in Europa
bei der Erschließung tiefer Grundwasserleiter bzw. in Deutschland in einer Tiefe zwischen 3.000
für die Wassergewinnung und 4.000 Metern. In den USA hingegen liegen
bei der Verbesserung des Wärmetransports sie sehr viel näher an der Oberfläche und daher
bei der tiefen Geothermie in unmittelbarer Nähe von Grundwasserleitern, die
vor allem bei der Erdöl- und Erdgasförderung in einer Tiefe zwischen 500 und 600 Metern ver-
laufen und für die Trinkwassernutzung bedeutsam
Autor
Und dennoch scheiden sich die Geister, wenn es sind. Nach Beenden des Fracking-Vorgangs fließt
um dieses Thema geht. Warum ist das so? das unter Druck stehende Öl-Wasser-Gas-Gemisch
als sogenannter „Flowback“ wieder zurück.
Die öffentliche Diskussion hat zunächst einmal mit
dem Boom zu tun, den die Fracking-Technik in den
letzten Jahren insbesondere in den USA, aber auch Undichte Bohrlöcher
in anderen Ländern ausgelöst hat. Dieser Boom hat
die USA nach 40 Jahren wieder zum Ölexporteur 3.000 bis 4.000 Meter tief unter dem Erdboden:
gemacht und lässt die Energiepreise in den USA Eine solche Entfernung klingt beruhigend, und in
deutlich sinken. Naturgemäß entsteht daraus ein der Tat scheint es unwahrscheinlich, dass Verun-
großes Interesse, diese Technik auch in Deutschland reinigungen in dieser Tiefe (häufig handelt es sich
zur Anwendung zu bringen. Denn es sind auch hier um salziges tiefes Grundwasser) eine nennenswerte
Lagerstätten von Erdöl und Schiefergas vorhan- Rolle spielen. Doch die Musik spielt natürlich in
Prof. Dr. Stefan Peiffer ist
den, die mit der Fracking-Technologie ausgebeutet den kilometerlangen Bohrlöchern und Transport-
Inhaber des Lehrstuhls für
werden könnten. Der katastrophale Umgang mit wegen, die von der Erdoberfläche nach unten und Hydrologie und Geschäftsführender
dieser Technik in den USA, was Umweltschäden wieder zurück nach oben führen. Welche Umwelt- Direktor des Bayreuther Zentrums
für Ökologie und Umweltforschung
betrifft, lässt jedoch die Bevölkerung entsprechend risiken bestehen hier? Infolge von Fracking wurden
(BayCEER) an der Universität Bayreuth.
argwöhnisch darauf blicken. Dies wiederum ruft in einigen Fällen Verunreinigungen des Trinkwas-
Ausgabe 2 . 2014 19Forschung & Technik I
Abb. 1: Fracking in der Bakken Formation sers mit Kohlenwasserstoffen beobachtet. Diese
in North Dakota/USA (Foto: Joshua
Doubek, CC-BY-SA-3.0).
Kontaminationen sind offenbar meist auf undichte
Bohrlöcher zurückzuführen. Eine kürzlich erschiene-
ne Studie in den USA vermutet, dass in der Regel
nicht das Aufsprengen des Gesteins in der Tiefe für
Verschmutzungen des Grund- und Trinkwassers
verantwortlich sei, die in der Tat in Zusammenhang
mit Fracking aufgetreten sind. Vielmehr seien die
Kontaminationen durch Undichtigkeiten entlang
von Bohrlöchern 4,5 entstanden, die durch Grund-
wasserschichten hindurchstoßen, die für die Trink-
wassergewinnung genutzt werden. Von daher liegt
die Argumentation nahe, dass Umweltrisiken eine
Frage der Technik und minimierbar seien, wenn
man nur einen entsprechenden Ausbaustandard
verwendet. Doch es gibt auch weitere Bedenken.
von 120 Litern in Deutschland entspricht diese
„Wollen wir ein (noch) unbekanntes Restrisiko tragen, um Wassermenge in etwa dem täglichen Wasserver-
eine Technologie zu fördern, die fossile Rohstoffe produ- brauch der Stadt Bayreuth. Die Bereitstellung einer
derart hohen Wassermenge hat nicht unerhebliche
ziert, bei deren Verbrennung Treibhausgase entstehen?“ Auswirkungen auf den Wasserhaushalt. Dies ist
insbesondere in trockenen Gebieten des mittleren
Westens der USA ein Problem, kann aber auch in
Hoher Wasserverbrauch, trockenen Gebieten Deutschlands Konsequenzen
starke Verunreinigungen haben. In den USA wird das Wasser häufig in Tank-
wagen angeliefert, mit entsprechenden Risiken
Insgesamt werden pro Fracking-Vorgang rund von Unfällen und Ölverschmutzungen in Böden
10.000 m3 Wasser verbraucht. Bei einem durch- und Oberflächengewässern.
schnittlichen Wasserverbrauch pro Kopf und Tag
Die verschiedenen Chemikalien (u. a. Biozide, Ten-
side, Gele und Säuren), die in den für das Fracking
verwendeten Flüssigkeiten enthalten sind, haben
darin einen Gesamtanteil von 0,5 bis 2 Volumen-
prozent. Es fallen daher als Flowback erhebliche
Wassermengen an (4.000 bis 5.000 m3 pro Boh-
rung), die verunreinigt sind. Zu dieser Verschmut-
zung tragen auch Inhaltsstoffe des tiefen Grund-
wassers bei, wie etwa Salz, aber auch Erdöl und
Kohlenwasserstoffe. Bevor das Wasser entweder
endgültig entsorgt oder für den Frackingprozess
wiederverwendet wird, muss es behandelt und
aufbereitet werden. In den USA lagert man das
kontaminierte Wasser in großen Becken, was je-
doch in Deutschland rechtlich nicht möglich ist.
Insgesamt handelt es sich bei einer Fracking-Boh-
rung um einen mittelgroßen Industriekomplex,
der im Hinblick auf Technik und Verkehr von einer
leistungsstarken Infrastruktur abhängt. Diese wie-
Abb. 2: Prinzip der
derum zieht das Risiko einer Kontamination von
Erdgasgewinnung
durch Fracking (Grafik: Böden und Oberflächenwasser sowie einen nicht
Bilderzwerg / fotolia.com). unerheblichen Landverbrauch nach sich.
20 Ausgabe 2 . 2014Sie können auch lesen